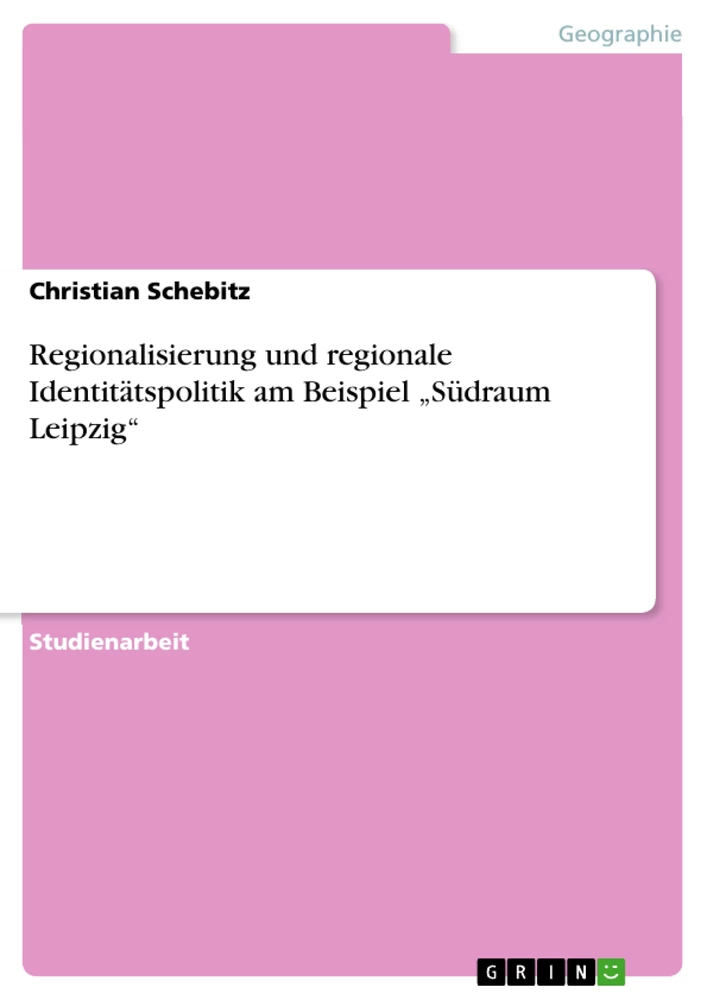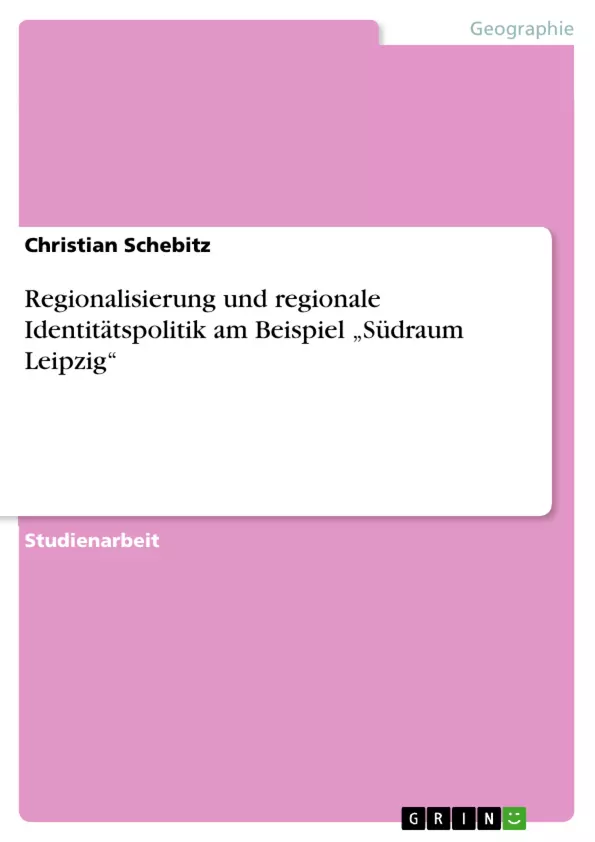Die Welt befindet sich im Wandel. Globalisierung, Klimawandel und Finanzkrise sind dabei nur drei Schlagwörter, die diesen Wandel und die zugehörigen Probleme im globalen Maßstab beschreiben. Auch Europa vollzieht einen Umbruch. Die Europäisierung schreitet voran, die Staatengemeinschaft wächst zusammen, um den neuen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen. Trotz EU müssen die europäischen Staaten den aktuellen Problemen auch individuell entgegen treten. Für die Bundesrepublik Deutschland kommen (auch zwanzig Jahre danach) noch die Umbrüche der Wende hinzu. Gerade in Deutschland sind die räumlichen Disparitäten noch stark ausgeprägt. Hinzu kommt ein wachsender Vertrauensverlust der Politik.
Angesichts der aktuellen Problemlagen (von regionalen bis globalen Ausmaßes) gewinnt paradoxerweise die Region wieder an Bedeutung. Regionalisierung beziehungsweise Regional Governance kursiert seit etwa den Achtziger Jahren in Politik und Wissenschaft; oft als Zauberformel zur Lösung aller Probleme angesehen. Was ist Regionalisierung? Trotz eines nicht mehr ganz jungen Konzepts, gibt es auf diese Frage keine einheitliche Antwort. Regionalisierung wird in jedem Land etwas unterschiedlich definiert. Auch die Perspektive, aus der sie betrachtet wird (beispielsweise Politik oder Wirtschaft), entscheidet über die Definition. Allgemeingültig kann wohl die Aussage gelten, dass Regionalisierung eine neue Form von Politik ist.
Dieses Begriffsverständnis soll im Weiteren noch geschärft werden. Danach soll beschrieben werden, welchem Wandel der Staat ausgesetzt ist und wie es zur Aufwertung der Region in jüngster Vergangenheit gekommen ist. Im Anschluss daran werden die Grenzen von Regionalisierung aufgezeigt. In Überleitung zum zweiten Abschnitt wird die Frage geklärt, was symbolische Regionalpolitik ist und welcher Unterschied zu Imagepolitik besteht. Danach befasst sich diese Arbeit mit der Regionalisierung des Südraums Leipzigs, in der die Frage beantwortet werden soll, ob und wie der Südraum die Transformation von einer politischen Programmregion zu einer Wahrnehmungs- und Identitätsregion vollzog.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Regionalisierung
- Merkmale von Regionalisierung
- Vorteile der Region
- Grenzen der regionalen Selbststeuerung
- Symbolische Regionalpolitik
- Transformation einer politischen Programmregion in eine Wahrnehmungs- und Identitätsregion am Beispiel des Leipziger Südraums
- Substantialisierung
- Evaluative Auszeichnung
- Mediale (Re-) Präsentation
- Alltagsnahe territoriale Vermessung
- Institutionelle Reorganisation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Regionalisierung und seiner Bedeutung im Kontext der aktuellen Herausforderungen wie Globalisierung, Klimawandel und Finanzkrise. Sie analysiert den Wandel des Staates und die Aufwertung der Region als neue Form der Politik, die sich durch Dezentralisierung, Stärkung der Selbststeuerung und Kooperation von Akteuren auf regionaler Ebene auszeichnet.
- Merkmale von Regionalisierung und ihre Rolle in der Entwicklungspolitik
- Vorteile der Region im Hinblick auf Flexibilität, Clusterbildung und demokratische Willensbildung
- Grenzen der regionalen Selbststeuerung und die Herausforderungen für die regionale Politik
- Transformation von politischen Programmregionen zu Wahrnehmungs- und Identitätsregionen
- Die Rolle der symbolischen Regionalpolitik und ihre Bedeutung im Kontext der Identitätsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die aktuelle Problemlage im Kontext von Globalisierung, Klimawandel und Finanzkrise dar und führt in die Thematik der Regionalisierung ein. Sie erläutert den Wandel des Staates und die Aufwertung der Region als neue Form der Politik.
- Regionalisierung: Dieses Kapitel definiert Regionalisierung als Strategie der Modernisierung und erläutert ihre Merkmale, Vorteile und Grenzen. Es beleuchtet die Rolle von Kooperation und Netzwerken sowie die Herausforderungen für die regionale Selbststeuerung.
- Transformation einer politischen Programmregion in eine Wahrnehmungs- und Identitätsregion am Beispiel des Leipziger Südraums: Dieses Kapitel analysiert die Transformation des Leipziger Südraums von einer politischen Programmregion zu einer Wahrnehmungs- und Identitätsregion. Es untersucht die Prozesse der Substantialisierung, evaluativen Auszeichnung, medialen (Re-) Präsentation, alltagsnahen territorialen Vermessung und institutionellen Reorganisation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen Regionalisierung, Regional Governance, regionale Identitätspolitik, Wahrnehmungsregion, Identitätsregion, politische Programmregion, Transformation, Cluster, Kooperation, Netzwerke, dezentrale Politik, Selbststeuerung, europäische Integration, Leipziger Südraum.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Regionalisierung in der modernen Politik?
Regionalisierung beschreibt die Aufwertung der Region als politische Ebene, um globale Probleme wie den Klimawandel oder die Globalisierung lokal besser steuern zu können.
Was ist der „Südraum Leipzig“ in diesem Kontext?
Der Südraum Leipzig dient als Beispiel für eine Region, die sich von einer reinen politischen Programmregion zu einer Identitätsregion mit eigener Wahrnehmung entwickelt hat.
Was versteht man unter „Regional Governance“?
Es bezeichnet neue Formen der Steuerung durch Netzwerke und Kooperationen zwischen staatlichen und privaten Akteuren auf regionaler Ebene.
Was ist der Unterschied zwischen Imagepolitik und symbolischer Regionalpolitik?
Während Imagepolitik oft nur auf die Außenwirkung zielt, versucht symbolische Regionalpolitik, Identität nach innen zu stiften und die Region emotional zu verankern.
Warum gewinnen Regionen trotz der EU an Bedeutung?
Regionen bieten Flexibilität, ermöglichen Clusterbildung und fördern die demokratische Willensbildung näher am Bürger, was das Vertrauen in die Politik stärken kann.
- Quote paper
- Christian Schebitz (Author), 2009, Regionalisierung und regionale Identitätspolitik am Beispiel „Südraum Leipzig“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/149550