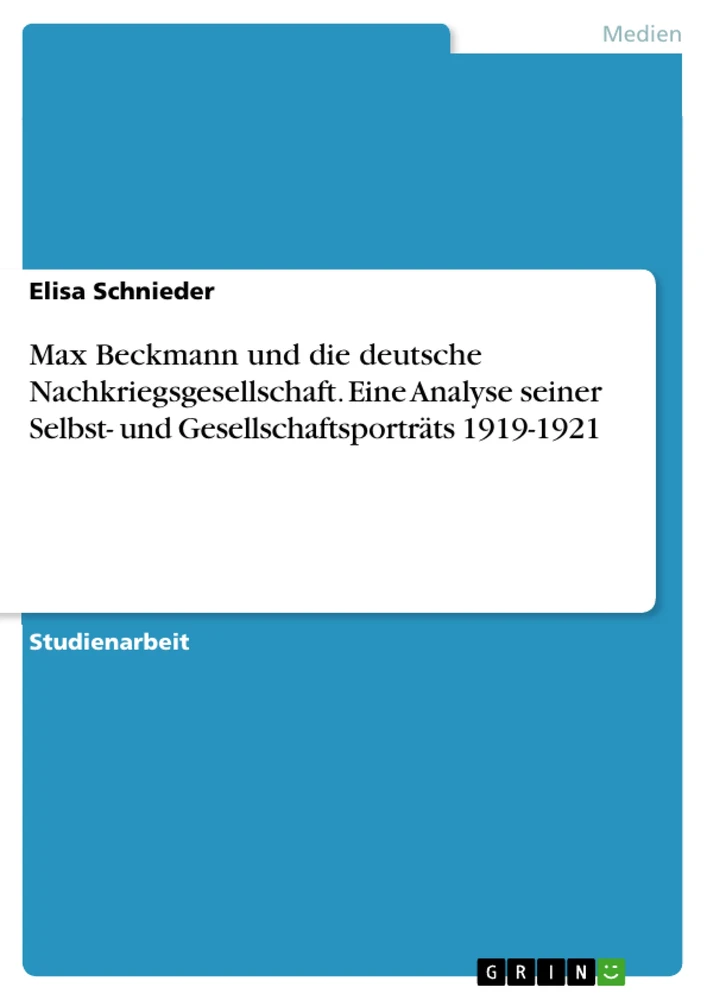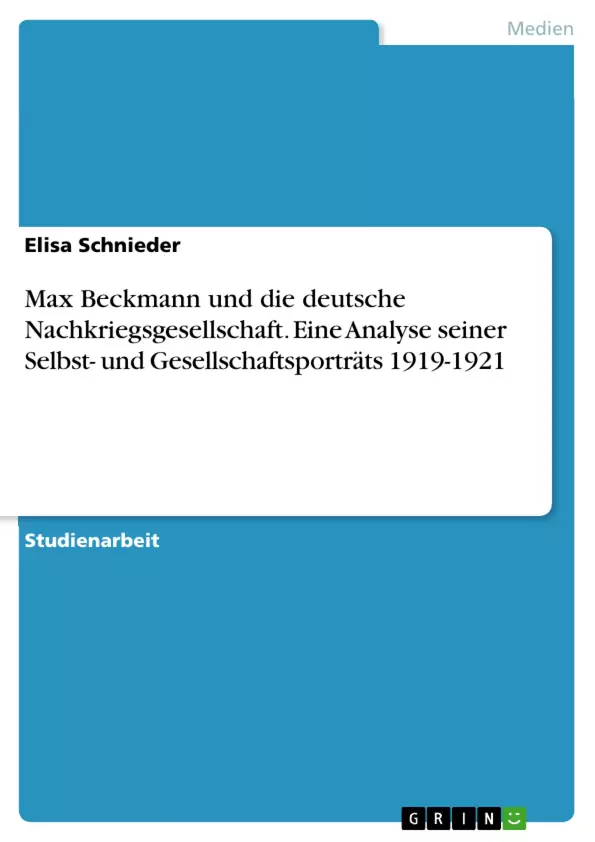Max Beckmann zählt zu den bedeutendsten deutschen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Diese Arbeit untersucht seine Entwicklung vom Impressionismus zur Neuen Sachlichkeit nach dem Ersten Weltkrieg und beleuchtet seine Sicht auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Nach einem traumatischen Kriegserlebnis änderte sich Beckmanns künstlerischer Fokus auf das Wesentliche hinter dem Sichtbaren. Die Arbeit konzentriert sich auf seine Selbstbildnisse und gesellschaftlichen Porträts aus den Jahren 1919 und 1921, interpretiert diese und vergleicht sie mit zeitgenössischen Künstlern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Symbolik in Beckmanns Gemälden, um seine Position und Perspektive innerhalb der Gesellschaft zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gemälde
- „...wie auch ein Trauermarsch schön ist“
- „Unser Herz und unsere Nerven müssen wir preisgeben...”
- „...nur als eine Szene im Theater der Unendlichkeit...”
- „...je schwerer und tiefer die Erschütterung über unser Dasein in mir brennt...”
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Selbstbildnisse und gesellschaftlichen Porträts von Max Beckmann in den Jahren 1919 und 1921. Ziel ist es, diese Werke zu interpretieren und ihre Bedeutung im Kontext der deutschen Nachkriegsgesellschaft zu beleuchten. Zudem werden Vergleiche mit anderen deutschen Künstlern dieser Zeit gezogen und die Symbolik der Beckmann'schen Accessoires untersucht.
- Max Beckmanns künstlerische Entwicklung im Kontext des Ersten Weltkriegs
- Die Darstellung von Gewalt und Trauma in der Nachkriegsgesellschaft
- Die Rolle des Künstlers als Beobachter und Dokumentar
- Die Symbolik in Beckmanns Gemälden und ihre Bedeutung für die Interpretation
- Vergleiche mit anderen Künstlern der Neuen Sachlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Max Beckmann als einen der wichtigsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts vor und beschreibt seine künstlerische Entwicklung vom Impressionismus zur Neuen Sachlichkeit. Sie skizziert die Situation der deutschen Nachkriegsgesellschaft und stellt die Forschungsfragen der Arbeit vor.
Gemälde
„...wie auch ein Trauermarsch schön ist“
Dieses Kapitel analysiert das Gemälde „Die Nacht“ (1919) und untersucht die Darstellung von Gewalt, Trauma und gesellschaftlichem Verfall in der Nachkriegsgesellschaft. Die Szene zeigt eine Familie in einem kleinen, stickigen Raum, die von Gewalt zerrüttet wird. Der „Gehängte“ repräsentiert den Vater, die entblößte Frau die Mutter und der Junge das Kind. Die Gewalt wirkt allgegenwärtig und die Leidenden scheinen ihrem Schicksal ausgeliefert.
„Unser Herz und unsere Nerven müssen wir preisgeben...”
„...nur als eine Szene im Theater der Unendlichkeit...”
„...je schwerer und tiefer die Erschütterung über unser Dasein in mir brennt...”
Schlüsselwörter
Max Beckmann, Neue Sachlichkeit, Selbstbildnis, gesellschaftliches Porträt, Gewalt, Trauma, Nachkriegsgesellschaft, Symbolik, deutsche Kunst, Vergleich, Künstler, Beobachter, Dokumentar, Interpretation
- Quote paper
- Elisa Schnieder (Author), 2018, Max Beckmann und die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Eine Analyse seiner Selbst- und Gesellschaftsporträts 1919-1921, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1493587