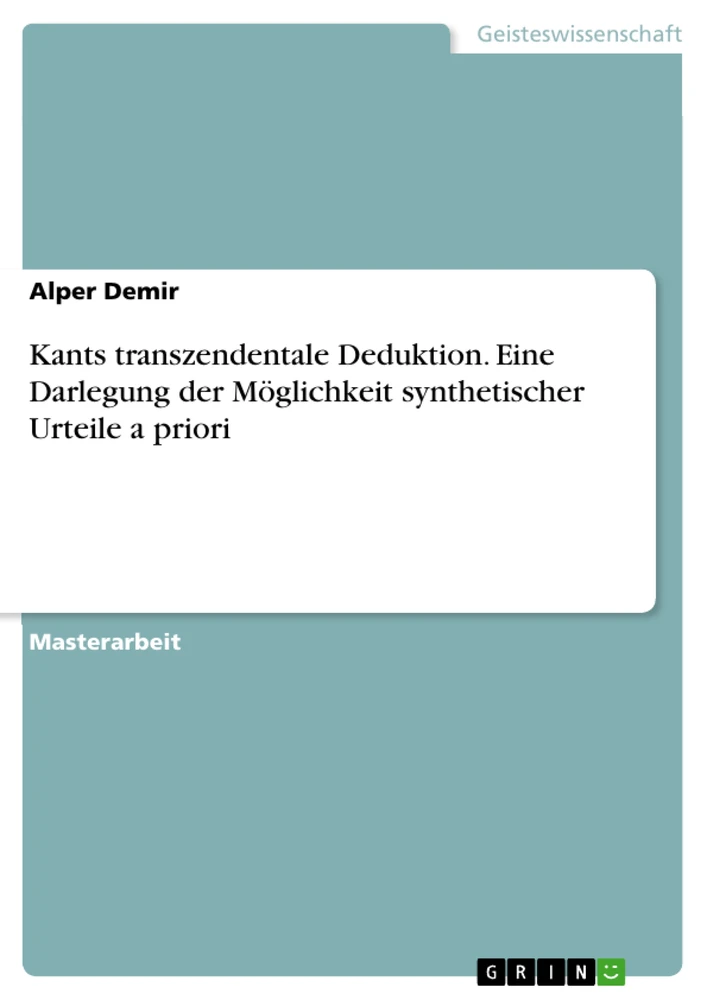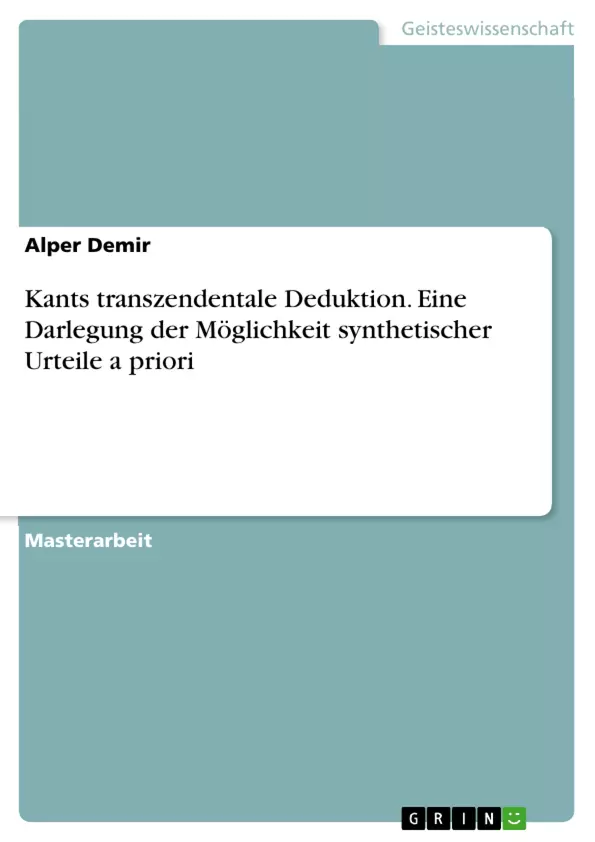Die Hausarbeit zur transzendentalen Deduktion in Kants "Kritik der reinen Vernunft" untersucht die Möglichkeit synthetischer Urteile a priori. Sie beginnt mit Kants Auseinandersetzung mit Humes empiristischer Position, die besagt, dass alle Erkenntnis aus der Erfahrung stammt. Kant argumentiert, dass der Verstand a priori Strukturen besitzt, die die Bedingungen für die Möglichkeit von Erfahrung selbst setzen. Die transzendentale Deduktion zeigt auf, wie diese Strukturen, wie Raum, Zeit und Kategorien wie Kausalität, synthetische Urteile a priori ermöglichen.
"Erfahrung ist ohne Zweifel das erste Produkt, welches unser Verstand hervorbringt". Mit diesem kontraintuitiven Zitat beginn Kant seine erste Ausgabe der "Kritik der reinen Vernunft". Es stellt sich bereits zu Beginn die Frage, was er damit aussagen könnte, wenn doch die Erfahrung – wie die Empiristen meinen – die einzige Quelle der Erkenntnis sei. Demnach hatte David Hume vor Kant dargelegt, dass jede (nicht triviale) Erkenntnis, das Wissen über Kausalbeziehungen inkludiert, sich aus der Erfahrung ableitet und somit nur wahrscheinlich, doch nicht notwendig sein kann. Aus dem Induktionsproblem resultiert die empirische Fallibilität (Fehlbarkeit) des Wissens: "the contrary of every matter of fact is still possible". Daraus folgt, dass es logisch genauso gültig ist zu behaupten, dass morgen die Sonne aufgeht, wie zu behaupten, dass sie nicht aufgeht. Da die Erfahrung der Ausgangspunkt des Wissens ist, sei ein unerfahrener Denker überhaupt kein Denker. Weder könnten wir aus einer Ursache (Feuer) notwendig die Folge (Rauch) noch aus einem Ereignis (Rauch) notwendig die Ursache (Feuer) erschließen. Die notwendige Verknüpfung zwischen den Begriffen (Ursache und Wirkung) könne nicht erfahrungsunabhängig (d.i. a priori) begründet werden. Daher ist es nicht der Verstand, sondern die Gewohnheit, die die Erkenntnis leite: "Custom, then, is the great guide of human life".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundbegriffe
- Kategorien
- Transzendental
- 'Gegenstände' der Erfahrung
- Dogmatismus, Skeptizismus und die Kritik
- Von dem Unterschied analytischer und synthetischer Urteile
- Analytische Urteile
- Analytische Urteile als Erläuterungsurteile
- Analytische Urteile a priori
- Synthetische Urteile a posteriori
- Kant über synthetische Urteile a posteriori
- Humes skeptischer Einwand
- Urteile über Kausalbeziehung als synthetische Urteile a posteriori?
- Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?
- Zusammenfassung des Kapitels über die Urteilsarten
- Transzendentale Deduktion (A) - Wie ist Erfahrung möglich?
- Einführung in die transzendentale Deduktion (A, 1. Abschnitt)
- Zweiter Abschnitt der A-Deduktion - die Synthesen
- Synthesis der Apprehension und Reproduktion
- Die Synthesis der Rekognition
- Zusammenführung und Diskussion der Synthesen
- Dritte Abschnitt der A-Deduktion
- Deduktion von „oben“ (A 115–119)
- Deduktion von „unten“ (A 120 ff.)
- Resümee und Vergleich des dritten Abschnitts
- Grundzüge der transzendentalen Deduktion (B) – ein Vergleich
- Das Verhältnis von Ich, Welt und ursprünglicher Synthese - § 16
- Grundlegender Vergleich zur A-Deduktion
- Eine transzendentale Abschlussreflexion
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der transzendentalen Deduktion (A) aus Immanuel Kants 'Kritik der reinen Vernunft'. Sie analysiert die Argumentation Kants im zweiten Abschnitt der Deduktion und beleuchtet die drei Synthesen, die laut Kant jeder Erfahrung zugrunde liegen. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der Frage, wie synthetische Urteile a priori möglich sind und welche Rolle die Erfahrung und die Bedingungen der Erfahrung dabei spielen.
- Analyse der drei Synthesen im zweiten Abschnitt der A-Deduktion
- Rekonstruktion und Einordnung des Begriffs des 'transzendentalen Gegenstandes = x'
- Vergleich der A- und B-Deduktion, insbesondere im Hinblick auf den Paragrafen 16 der B-Ausgabe
- Darlegung des Hume'schen Einwandes gegen die Möglichkeit synthetischer Urteile a priori und seine Bedeutung für Kants Argumentation
- Kritisches Hinterfragen der transzendentalen Deduktion und ihrer Bedeutung für die heutige Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den historischen Kontext der transzendentalen Deduktion skizziert und die Problematik des synthetischen Urteils a priori anhand von Humes Einwand deutlich macht.
Das zweite Kapitel führt grundlegende Begriffe Kants ein, darunter die Kategorien, das Transzendentale und die 'Gegenstände' der Erfahrung. Das Unterkapitel 2.3 über die 'Gegenstände' der Erfahrung dient zugleich als Einleitung in Kants transzendentale Ästhetik.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit verschiedenen Arten von Urteilen, insbesondere mit dem Unterschied zwischen analytischen und synthetischen Urteilen und der Unterscheidung von a priori und a posteriori. Der Fokus liegt dabei auf Humes Einwand gegen die Möglichkeit synthetischer Urteile a priori.
Kapitel 4 widmet sich Kants transzendentaler Deduktion (A), wobei der zweite Abschnitt der Deduktion im Vordergrund steht. In diesem Abschnitt werden die drei Synthesen vorgestellt, die laut Kant jeder Erfahrung zugrunde liegen. Der zweite Abschnitt wird anschließend mit dem dritten Abschnitt verglichen, in dem Kant die objektive Gültigkeit synthetischer Urteile a priori sowohl von „oben“ als auch von „unten“ argumentiert.
Kapitel 5 befasst sich mit dem Paragrafen 16 der B-Deduktion, der wichtige Hinweise zum Verhältnis von Ich, Welt und ursprünglicher Synthesis liefert.
Die Arbeit gipfelt in einer transzendentalen Abschlussreflexion (Kapitel 6), in der die einzelnen Abschnitte der transzendentalen Deduktion synthetisiert werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Arbeit sind: transzendentale Deduktion, synthetische Urteile a priori, Erfahrung, Kategorien, Humes Einwand, 'transzendentaler Gegenstand = x', Ich, Welt, ursprüngliche Synthesis, Paragraf 16, A-Deduktion, B-Deduktion.
- Quote paper
- Alper Demir (Author), 2022, Kants transzendentale Deduktion. Eine Darlegung der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1490704