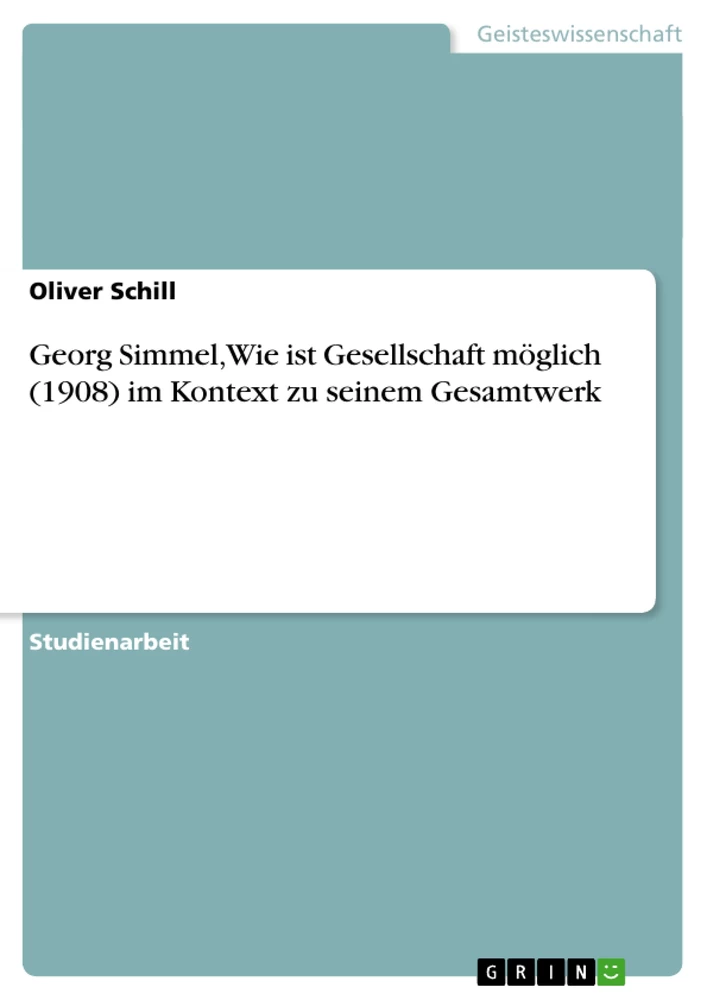Georg Simmel gilt als einer der wichtigsten Theoretiker der modernen Soziologie. Er entwickelte zu Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts in einer relativ kurzen Zeitspanne um 1900 genau wie jeweils seine großen Zeitgenossen Max Weber und Emile Durkheim, eine eigene „Soziologie“. Dank des Schaffens dieser großen Wissenschaftler beginnt sich die Soziologie in dieser Zeit als eigenständige Disziplin zu konstituieren und von den bisherigen Sozial- und Gesellschaftswissenschaften des 19. Jahrhunderts abzugrenzen. Diese durchaus sprunghafte Entwicklung steht unmittelbar in Zusammenhang mit der einsetzenden Selbstreflexion in den Wissenschaften bezüglich der Gesellschaftsordnung, vor allem in der Philosophie und der Wirtschaftsordnung. Als erste große Repräsentanten dieses neuen Wissenschaftszweiges sind eben Simmel, Weber und Durkheim zu nennen und werden deswegen auch mit recht als sogenannte „Klassiker der Soziologie“ bezeichnet. Ihre Theorien bilden den Hintergrund vor dem sich jeder folgende soziologische Theorieansatz bewähren mußte und noch heute muß.
Schon zu Lebzeiten war Simmel einer der bekanntesten deutschen Soziologen im Inn- aber vor allem im Ausland. Geboren am 01. März 1885 in Berlin als Sohn eines Berliner Kaufmanns jüdischer Abstammung, wird er nach dem Tod seines Vaters 1874 in die Verantwortung seines Verwandten Julius Friedländers gegeben, seines Zeichens Gründer und Inhaber der Musikedition Peters. Aus dessen Nachlaß erbt Simmel später ein beträchtliches Vermögen, so daß die langwierige akademische Laufbahn, die sich bei ihm durch oftmaliges Anecken und Neid unter Kollegen sogar noch länger und schwieriger gestaltete, finanzieren und durchstehen konnte. Nach dem Erlangen des Reifezeugnisses 1876, nahm Simmel das Studium der Geschichte und der Philosophie, sowie in den Nebenfächern Kunstgeschichte und Völkerpsychologie in Berlin auf. Promoviert wird er 1881 beim zweiten Anlauf mit der zuvor als Preisschrift gekrönten Arbeit über „Das Wesen der Materie nach Kants Physischer Monadologie“. Die zur Habitilation eingereichten „Kantische[n] Studien“ (1883) werden zwar auf Anhieb akzeptiert, aber das Kolloquium muß er wiederholen. Doch 1885 kann er dann schließlich nach einigen Hürden seine Lehrtätigkeit als Privatdozent mit Vorlesungen über kantische Ethik, Pessimismus und Darwinismus in Berlin aufnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Überblick über das Gesamtwerk und die Entwicklung Simmels
- Die Erste Schaffensphase Simmels (1881 – 1900)
- Die Zweite Schaffensphase Simmels (1900 – 1908)
- Die Dritte Schaffensphase Simmels (1908 – 1918)
- Die Einordnung von „Wie ist Gesellschaft möglich“ in das Gesamtwerk
- Simmels Beziehung und Affinität zu Kant
- Der junge Simmel unter dem wissenschaftlichen Einfluß Kants
- Die Anlehnung an Kant in „Wie ist Gesellschaft möglich“
- Die Bedingungen und Formen der Vergesellschaftung nach Simmel
- Das erste soziologische Apriori
- Das zweite soziologische Apriori
- Das dritte soziologische Apriori
- Schlußgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Georg Simmels Schrift „Wie ist Gesellschaft möglich“ (1908) im Kontext seines Gesamtwerks und im Vergleich zu Kants Frage „Wie ist Natur möglich?“. Der Fokus liegt auf der Rezeption und Weiterentwicklung von Kants Philosophie durch Simmel und der Analyse der soziologischen Grundbedingungen und Formen der Vergesellschaftung nach Simmel.
- Simmels Entwicklung als Soziologe und seine Einordnung in das Gesamtwerk
- Simmels Bezug zu Kant und die Rezeption Kantscher Ideen in „Wie ist Gesellschaft möglich“
- Analyse der soziologischen Grundbedingungen und Formen der Vergesellschaftung nach Simmel
- Vergleich zwischen Simmels und Kants Fragen nach der Möglichkeit von Gesellschaft und Natur
- Relevanz von Simmels Werk für die moderne Soziologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über Simmels Gesamtwerk und dessen Entwicklung in drei Phasen. Es beleuchtet die wichtigsten Einflüsse auf Simmels Denken und seine frühen Schriften.
- Kapitel Zwei untersucht die Beziehung und Affinität Simmels zu Kant, insbesondere seine Auseinandersetzung mit Kants Philosophie in seiner frühen Phase und in „Wie ist Gesellschaft möglich“.
- Das dritte Kapitel analysiert Simmels Theorie der Vergesellschaftung und beschreibt die drei soziologischen Apriori, die die Grundlage für seine soziologische Analyse bilden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Georg Simmel, „Wie ist Gesellschaft möglich“, Soziologie, Vergesellschaftung, Kant, Philosophie, Apriori, Moderne, Gesellschaftstheorie, Klassiker der Soziologie. Die Arbeit beschäftigt sich mit den Grundbedingungen und Formen der Vergesellschaftung nach Simmel und untersucht die Relevanz seines Denkens für die moderne Soziologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Anliegen von Simmels "Wie ist Gesellschaft möglich"?
Simmel untersucht die apriorischen Bedingungen, die es Individuen überhaupt erst ermöglichen, sich zu einer Gesellschaft zu verbinden (Vergesellschaftung).
Wie bezieht sich Simmel auf Immanuel Kant?
Analog zu Kants Frage "Wie ist Natur möglich?", fragt Simmel nach den geistigen Voraussetzungen, unter denen Menschen einander als soziale Wesen wahrnehmen.
Was sind die drei soziologischen Apriori?
Dazu gehören die Typisierung des Anderen, die Erkenntnis, dass jeder Mensch auch ein Nicht-Soziales ist, und die Idee der sozialen Positionierung im Ganzen.
Warum gilt Simmel als Klassiker der Soziologie?
Zusammen mit Weber und Durkheim begründete er die Soziologie als eigenständige Disziplin und lieferte die theoretische Basis für moderne Gesellschaftsanalysen.
In welche Phasen lässt sich Simmels Werk unterteilen?
Sein Werk wird oft in drei Phasen unterteilt: die frühe (1881-1900), die mittlere (1900-1908) und die späte Phase (1908-1918), in der er sich verstärkt der Kulturphilosophie widmete.
- Quote paper
- Oliver Schill (Author), 2002, Georg Simmel, Wie ist Gesellschaft möglich (1908) im Kontext zu seinem Gesamtwerk, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/14902