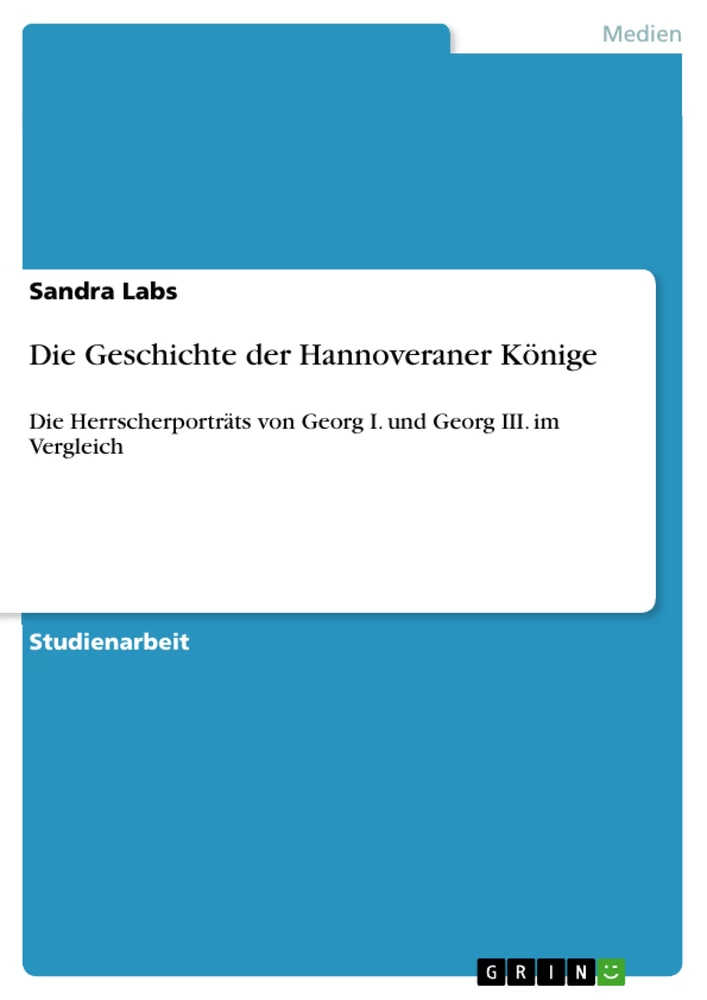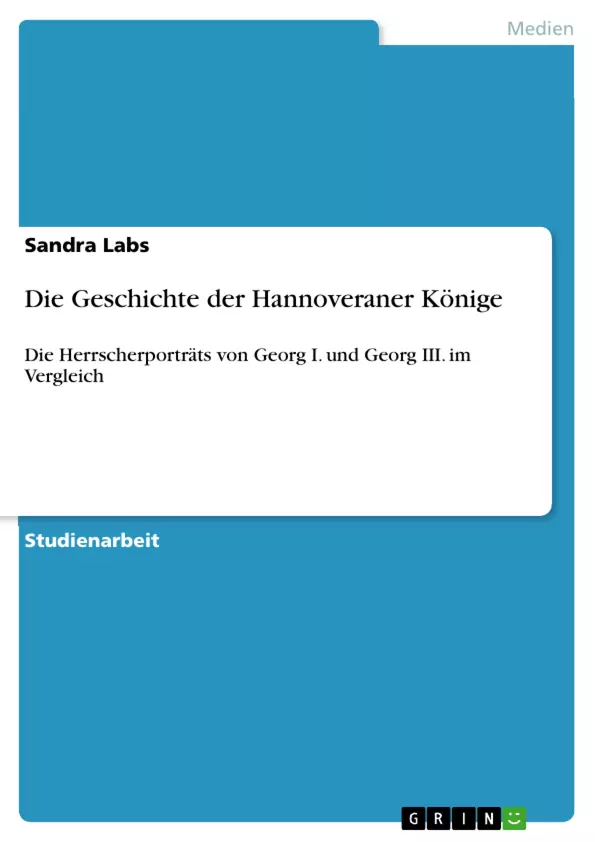Die Hannoveraner bestiegen Anfang des 18. Jh. den englischen Thron. Bis auf Georg III. waren alle Könige der Dynastie sehr unbeliebt beim Volk. Um sich als englische Herrscher zu etablieren begann Georg der I. sich die Neuerungen der Porträtkunst zu nutze zu machen um sein Image zu verbessern. Georg III. verstand es letztlich sogar mittels seiner Königsporträts seine eigen Person zu promoten, und die Herzen der Engländer zu gewinnen.
In der Arbeit zeige ich den Wandel der Herrscherbilder vom absolutistischen Porträt bis zum conversation piece auf und vollziehe dabei die Geschihcte der Hannoveraner Könige nach.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Einsetzung der Hannoveraner und deren Stellung in England
- Georg I.
- Die ersten Jahre Georgs I.
- Versuch der Herrschaftskonsolidierung durch die Porträtkunst unter Georg I.
- Die Bedeutung und Selbstinszenierung Georgs III.
- Georg III. und der politische Nutzen des Conversation Piece
- Georg III. als „Patriot King“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Integration des deutschen, absolutistisch geprägten Hauses Hannover in die englische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts anhand der Porträtmalerei. Die Arbeit analysiert, wie die Herrscherbildnisse Georgs I. und Georgs III. die jeweilige politische und gesellschaftliche Situation widerspiegelten und zur Selbstinszenierung der Könige dienten. Im Fokus steht die Frage, wie die Könige ihre Position in der parlamentarischen Monarchie visualisierten und wie sich dies im Wandel der Porträtkunst manifestierte.
- Die Einsetzung der Hannoveraner in England und die Herausforderungen der Integration.
- Die Rolle der Porträtmalerei in der Herrschaftslegitimation und Selbstinszenierung der Hannoveraner Könige.
- Der Vergleich der Porträtstrategien von Georg I. und Georg III. im Kontext des gesellschaftlichen Wandels.
- Die Entwicklung der Porträtmalerei im 18. Jahrhundert in England und ihre Beziehung zur neuen Mittelschicht.
- Die Veränderung des Herrscherbildnisses vom absolutistischen Ideal zum Bild des Amtsträgers.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufstieg Londons zum globalen Handelszentrum im 18. Jahrhundert und den damit verbundenen sozialen Aufstieg einer neuen Elite. Sie erläutert, wie sich die Porträtmalerei als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen darstellt, mit dem Fokus auf die Auflösung der Standesgrenzen und die Entstehung neuer Porträtformen wie Kinderbildnissen und Conversation Pieces. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach der Position des englischen Königs in der parlamentarischen Monarchie und der Darstellung dieser Position in der Porträtkunst, im Vergleich zum absolutistischen Herrscherbild, wie es beispielsweise bei Ludwig XIV. zu sehen ist. Die methodische Vorgehensweise, die Untersuchung der Integration der Hannoveraner, der gesellschaftlichen und politischen Zustände zu Zeiten Georgs I. und III., sowie deren Auswirkungen auf die Porträtkunst, wird skizziert.
Die Einsetzung der Hannoveraner und deren Stellung in England: Dieses Kapitel beschreibt die konstitutionelle Monarchie Englands nach der Glorious Revolution und dem Act of Settlement von 1701, welcher die Thronfolge auf die protestantischen Nachkommen Sophie von der Pfalz festlegte und somit das Haus Hannover auf den englischen Thron brachte. Es wird der Übergang von den Stuarts zu den Hannoveranern beleuchtet, die Herausforderungen der Integration eines deutschen und absolutistisch geprägten Königshauses in die englische Gesellschaft werden erörtert. Die Personalunion zwischen Hannover und Großbritannien und die damit verbundenen Vor- und Nachteile werden angesprochen, sowie die besondere Beziehung der Hannoveraner Könige zu ihrem Ursprungsland Hannover.
Georg I.: Dieses Kapitel behandelt die ersten Jahre der Herrschaft Georgs I. und den Versuch, durch Porträtkunst die Herrschaftskonsolidierung zu unterstützen. Es wird analysiert, wie Georg I. seine Position in der englischen Gesellschaft, trotz anfänglicher Unbeliebtheit, durch gezielte Darstellung in der Porträtkunst zu festigen versuchte. Im Kontext des gesellschaftlichen Wandels wird die Bedeutung der Porträtmalerei für die Selbstinszenierung des Monarchen diskutiert und mit der geringen Anzahl seiner Porträts im Vergleich zu seinem Nachfolger Georg III. in Verbindung gebracht.
Die Bedeutung und Selbstinszenierung Georgs III.: Dieses Kapitel fokussiert auf die Herrschaft Georgs III. und die gezielte Nutzung von Porträts – insbesondere Conversation Pieces – zur politischen Selbstinszenierung und zur Stärkung seiner Popularität als "Patriot King". Die deutlich höhere Anzahl an Porträts Georgs III. im Vergleich zu seinem Vorgänger wird im Kontext seiner Beliebtheit und seiner erfolgreichen Integration in die englische Gesellschaft interpretiert. Die Kapitel analysiert, wie sich die Porträtstrategie Georgs III. von der seines Vaters unterschied und welche Rolle die Kunst bei der Gestaltung seines öffentlichen Images spielte.
Schlüsselwörter
Hannoveraner, englische Königshaus, Porträtmalerei, 18. Jahrhundert, parlamentarische Monarchie, Herrschaftslegitimation, Selbstinszenierung, Georg I., Georg III., Conversation Piece, gesellschaftlicher Wandel, Personalunion, Absolutismus, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: "Die Hannoveraner Könige in England: Eine Analyse der Porträtmalerei als Instrument der Herrschaftslegitimation und Selbstinszenierung"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Integration des deutschen Hauses Hannover in die englische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Porträtmalerei als Mittel der Herrschaftslegitimation und Selbstinszenierung der Könige Georg I. und Georg III. Es wird untersucht, wie die Herrscherbildnisse die jeweilige politische und gesellschaftliche Situation widerspiegelten und wie die Könige ihre Position in der parlamentarischen Monarchie visualisierten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Einsetzung der Hannoveraner in England und den Herausforderungen der Integration, der Rolle der Porträtmalerei in der Herrschaftslegitimation, dem Vergleich der Porträtstrategien von Georg I. und Georg III., der Entwicklung der Porträtmalerei im 18. Jahrhundert in England und ihrer Beziehung zur neuen Mittelschicht, sowie der Veränderung des Herrscherbildnisses vom absolutistischen Ideal zum Bild des Amtsträgers.
Welche Könige stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf die Herrscherfiguren Georg I. und Georg III. Der Vergleich ihrer Porträtstrategien und die unterschiedliche Anzahl und Art ihrer Porträts im Kontext ihrer jeweiligen Herrschaft und gesellschaftlichen Akzeptanz bilden einen zentralen Bestandteil der Arbeit.
Welche Rolle spielt die Porträtmalerei in der Analyse?
Die Porträtmalerei dient als primäre Quelle zur Analyse der Herrschaftslegitimation und Selbstinszenierung der Hannoveraner Könige. Die Arbeit untersucht, wie die Könige durch gezielte Darstellung in der Porträtkunst ihre Position in der englischen Gesellschaft zu festigen versuchten und wie sich die Porträtkunst im Wandel der Zeit und der gesellschaftlichen Veränderungen veränderte.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Herausforderungen der Integration der Hannoveraner, zu Georg I. mit Fokus auf dessen Herrschaftskonsolidierung durch Porträtkunst, zu Georg III. und seiner Selbstinszenierung als "Patriot King" mittels Porträts, insbesondere Conversation Pieces, sowie ein Fazit. Die Arbeit enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit untersucht die Integration der Hannoveraner, die gesellschaftlichen und politischen Zustände zu Zeiten Georgs I. und III. und deren Auswirkungen auf die Porträtkunst. Die Methode basiert auf der Analyse von Porträts und deren Kontextualisierung innerhalb der historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Englands im 18. Jahrhundert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind nicht explizit in den bereitgestellten Informationen enthalten. Die Arbeit analysiert den Wandel der Porträtstrategien der beiden Könige im Kontext der parlamentarischen Monarchie und des gesellschaftlichen Wandels in England. Die Schlussfolgerungen beziehen sich wahrscheinlich auf die Wirksamkeit der Porträtkunst als Instrument der Herrschaftslegitimation und Selbstinszenierung unter Berücksichtigung des Wandels vom absolutistischen Ideal zum Bild des Amtsträgers.)
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Hannoveraner, englisches Königshaus, Porträtmalerei, 18. Jahrhundert, parlamentarische Monarchie, Herrschaftslegitimation, Selbstinszenierung, Georg I., Georg III., Conversation Piece, gesellschaftlicher Wandel, Personalunion, Absolutismus, Integration.
- Quote paper
- Sandra Labs (Author), 2009, Die Geschichte der Hannoveraner Könige, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/148618