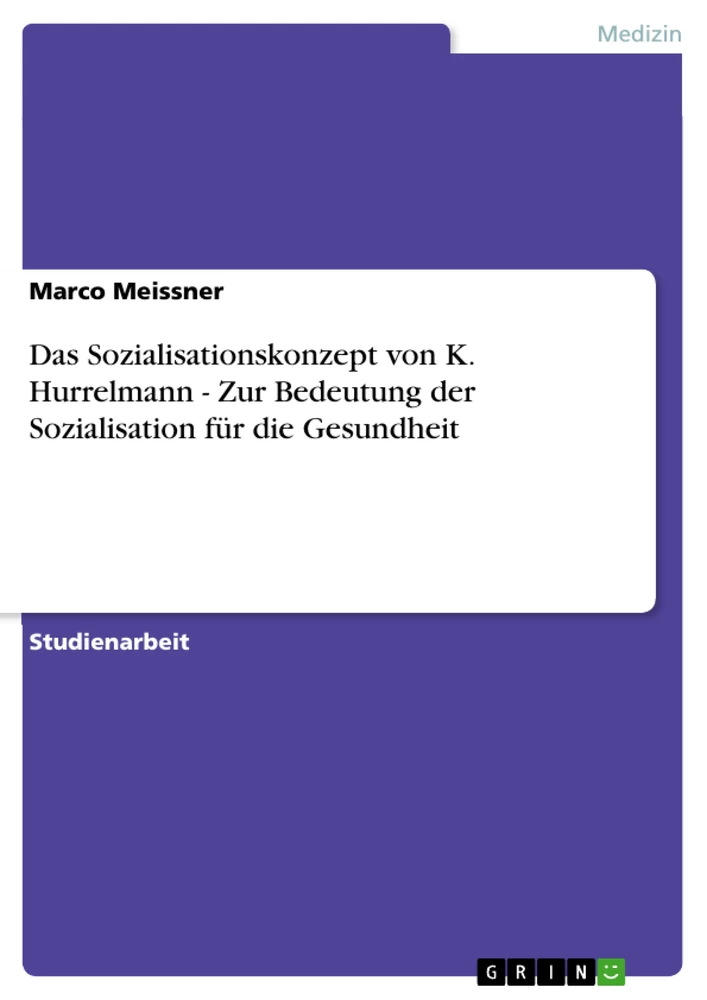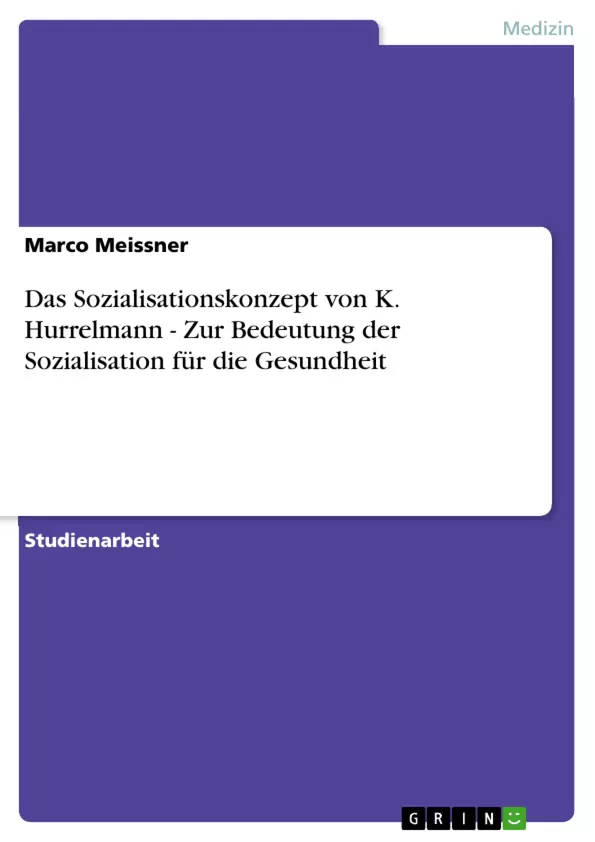Jeder Mensch hat das Bedürfnis „gesund“ zu sein. Gesundheit kann somit als das höchste Gut des Menschen bezeichnet werden.
Gesundheit wird im Alltag oft unreflektiert als die Abwesenheit von Krankheit definiert.
Was bezeichnet der Begriff „Gesundheit“ eigentlich?
Den meisten dürfte hier sofort die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Sinn kommen. Der zufolge Gesundheit ein Zustand des voll-ständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen ist („Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.“ (WHO: 1946)).
Seit 1946 wird der Gesundheitsbegriff der WHO in der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit diskursiv betrachtet.
Begründet durch die Dominanz der Medizin konzentriert sich unsere Gesellschaft vorrangig auf die Heilung von Krankheiten und weniger auf die Erhaltung der Gesundheit.
In den 1970er Jahren kam es in Deutschland zur (Wieder-) Entstehung der Gesundheitswissenschaften als wissenschaftliche Disziplin die ihren Fokus auf den Erhalt und die Förderung der Gesundheit richtet. Diese Disziplin war in den Jahren vor 1933 in Deutschland bereits recht weit entwickelt. Damals unter dem Namen „Sozialhygiene“ als „Wissenschaft von der Erhaltung und Mehrung der Gesundheit“ (Hurrelmann 2006b: 11). Der Missbrauch dieser wissenschaftlichen Disziplin durch das NS-Regime führte dazu, dass die Gesundheitswissenschaften nur zögerlich wiederentstehen konnten.
Im Folgenden möchte ich nun das Sozialisationskonzept von Klaus Hurrelmann zusammenfassend darstellen und seine Bedeutung für die Gesundheitswissenschaften erörtern.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung in die Problemstellung
2. Sozialisation und Gesundheit
2.1. Definitionen von Gesundheit und Krankheit
2.2. Sozialisationstheorien
2.2.1. Der soma-psycho-sozio-ökonomische Ansatz
2.2.2. Das Konzept der Entwicklungsaufgaben
2.2.3. Das Sozialisationsmodell
2.3. Gesundheits- und Persönlichkeitsentwicklung
2.4. Belastungsfaktoren und Bewältigungsstrategien
2.5. Krankheitsursachen und Risikofaktoren
2.6. Ressourcen und Bedingungsfaktoren
3. Gesundheitsverhalten und Gesundheitsentwicklung im Lebensverlauf
3.1. Die Schlüsselrolle des Gesundheitsverhaltens
3.2. Gesundheitsbedingende Einflussfaktoren im Kindesalter
3.2.1. Familienstrukturen
3.2.2. Interaktions- und Kommunikationsmuster
3.3. Gesundheitsbedingende Einflussfaktoren im Jugendalter
3.4. Gesundheitsbedingende Einflussfaktoren im Erwachsenenalter
3.5. Gesundheitsbedingende Einflussfaktoren im hohen Alter
4. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
1. Einführung in die Problemstellung
Jeder Mensch hat das Bedürfnis „gesund“ zu sein. Gesundheit kann somit als das höchste Gut des Menschen bezeichnet werden.
Gesundheit wird im Alltag oft unreflektiert als die Abwesenheit von Krankheit definiert.
Was bezeichnet der Begriff „Gesundheit“ eigentlich?
Den meisten dürfte hier sofort die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Sinn kommen. Der zufolge Gesundheit ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen ist („Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.“ (WHO: 1946)).
Seit 1946 wird der Gesundheitsbegriff der WHO in der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit diskursiv betrachtet.
Begründet durch die Dominanz der Medizin konzentriert sich unsere Gesellschaft vorrangig auf die Heilung von Krankheiten und weniger auf die Erhaltung der Gesundheit.
In den 1970er Jahren kam es in Deutschland zur (Wieder-) Entstehung der Gesundheitswissenschaften als wissenschaftliche Disziplin die ihren Fokus auf den Erhalt und die Förderung der Gesundheit richtet. Diese Disziplin war in den Jahren vor 1933 in Deutschland bereits recht weit entwickelt. Damals unter dem Namen „Sozialhygiene“ als „Wissenschaft von der Erhaltung und Mehrung der Gesundheit“ (Hurrelmann 2006b: 11). Der Missbrauch dieser wissenschaftlichen Disziplin durch das NS-Regime führte dazu, dass die Gesundheitswissenschaften nur zögerlich wiederentstehen konnten.
Im Folgenden möchte ich nun das Sozialisationskonzept von Klaus Hurrelmann zusammenfassend darstellen und seine Bedeutung für die Gesundheitswissenschaften erörtern.
2. Sozialisation und Gesundheit
Im Verlauf der Vergesellschaftung wirken verschiedene Faktoren auf den einzelnen Menschen ein. Ökologische, soziale und ökonomische Bedingungen fördern bzw. hemmen die Entwicklung von physischer und psychischer Gesundheit. Die durch diese Bedingungen beeinflusste Persönlichkeitsentwicklung trägt im gesamten Lebensverlauf entscheidend zur Entwicklung des Gesundheitsstatus bei.
2.1 Definitionen von Gesundheit und Krankheit
In der einschlägigen Literatur finden sich stark disziplinär geprägte Definitionen von Gesundheit und Krankheit.
Oft wird Gesundheit als das Fehlen von Krankheit bzw. Krankheit als eine Störung der Gesundheit betrachtet.
Häufig kommt es zur Konzentration auf einen Aspekt (gesund/krank).
Dörner/ Plog definieren Krankheit als „... Störungen im Ablauf der Lebensvorgänge, die mit einer Herabsetzung der Leistungsfähigkeit einhergehen und meist mit wahrnehmbaren Veränderungen des Körpers verbunden sind. (Dörner, Plog 2000, 34). Eine Definition des Gesundheitsbegriffes nehmen sie allerdings nicht vor. Daher kann auch hier Gesundheit nur als das fehlen von Krankheit betrachtet werden.
Das klinische Wörterbuch Pschyrembel definiert Gesundheit als „... das subjektive Empfinden des Fehlens körperl., geistiger und seel. Störungen od. Veränderungen bzw. ein Zustand, in dem Erkr. u. pathol. Veränderungen nicht nachgewiesen werden können“ (Hildebrandt 1998: 571).
Krankheit wird dort als „ Störung der Lebensvorgänge in Organen od. im gesamten Organismus mit der Folge von subjektiv empfundenen bzw. objektiv feststellbaren körperl., geistigen bzw. seelischen Veränderungen“ (Hildebrandt 1998: 867) beschrieben.
Aus den verschiedenen Definitionsversuchen lässt sich ableiten, dass es bislang keine allgemeingültige Definition von Gesundheit gibt.
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sorgte die 1946 in der Gründungsakte der WHO festgeschriebene Definition von Gesundheit für eine bis heute anhaltende konstruktive Diskussion um diesen Begriff. Hurrelmann kritisiert die subjektiv akzentuierte Sichtweise von Gesundheit und Krankheit. Die sich auf den zentralen Begriff des „Wohlbefindens“ konzentriert und die subjektive Selbstempfindung zum ausschließlichen Entscheidungskriterium erhebt. Ebenfalls als utopisch anzusehen ist die Zielvorstellung des „völligen Wohlbefindens“. Weiterhin ist eine präzise Definition von „sozialer Gesundheit“ auch mit dieser mehrdimensionalen Definition nicht möglich. Auch stehen sich die Begriffe Gesundheit und Krankheit diametral gegenüber (Hurrelmann 2006a: 118-119).
Hurrelmann wendet sich von den anpassungsmechanistischen Vorstellungen Durkheims ab und stellt folgende Definition für den Sozialisationsbegriff auf:
„Sozialisation bezeichnet nach dieser Definition den Prozess, in dessen Verlauf sich der mit der biologischen Ausstattung versehene menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet, die über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen weiterentwickelt. Sozialisation ist die lebenslange Aneignung von und Auseinandersetzung mit den natürlichen Anlagen, insbesondere den körperlichen und psychischen Grundmerkmalen, die für den Menschen die >>innere Realität<< bilden, und der sozialen und physikalischen Umwelt, die für den Menschen die >> äußere Realität << bilden.“
(Hurrelmann 2006a:15-16)
Hurrelmann geht davon aus, dass der Mensch zwar stark von seiner Umwelt beeinflusst wird, sie aber zugleich auch aktiv gestaltet. Mit diesem Hintergrund entwickelt Hurrelmann eine Definition von Gesundheit, welche als Weiterentwicklung der WHO-Definition gesehen werden kann.
„Gesundheit bezeichnet den Zustand des Wohlbefindens einer Person, der gegeben ist, wenn diese Person sich körperlich, psychisch und sozial in Einklang mit den jeweils gegebenen inneren und äußeren Lebensbedingungen befindet. Gesundheit ist nach diesem Verständnis ein angenehmes und durchaus nicht selbst-verständliches Gleichgewichtsstadium von Risiko- und Schutzfaktoren, das zu jedem lebensgeschichtlichen Zeitpunkt immer erneut hergestellt werden muss. Gelingt das Gleichgewicht, dann kann dem Leben Freude und Sinn abgewonnen werden, ist eine produktive Entfaltung der eigenen Kompetenzen und Leistungspotenziale möglich und steigt die Bereitschaft sich gesellschaftlich zu integrieren und zu engagieren.“ (HURRELMANN 2006: 7)
2.2 Sozialisationstheorie
Sozialisation beschreibt einen lebenslang andauernden komplexen Austausch-, Anpassungs- und Entwicklungsprozess. Welcher zwischen Individuum und seiner Umwelt stattfindet. Wobei sich der Begriff Umwelt gleichermaßen auf ökologisch-ökonomische Rahmenbedingungen, Schichtzugehörigkeit und soziale Bindungen bezieht.
Die Sozialisationstheorie beschäftigt sich mit der zentralen Frage, wie ein Mensch mit seiner genetischen Ausstattung an Trieben und Bedürfnissen und seinem angeborenen Temperaments- und Persönlichkeitsmerkmalen zu einem selbstständigen Subjekt mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion wird und es schafft, dabei die Anforderungen von Kultur, Ökonomie, und ökologischer Umwelt zu be- wältigen(Hurrelmann 2006: 128).
2.2.1 Der soma-psycho-sozio-ökonomische Ansatz
Nach Hurrelmann bezieht sich die Realitätsverarbeitung auf vier ineinandergreifende Systeme. Welche durch ihr Wechselspiel die Gesundheitsentwicklung beeinflussen.
Hurrelmann benennt hierzu die Systeme
- Körper (Soma),
- Psyche,
- soziale Umwelt und
- physische (Öko-) Umwelt
Diese Systeme müssen im Lebenslauf im Gleichgewicht gehalten werden. Äußere und innere Anforderungen dürfen nicht dauerhaft in einem Widerspruch zueinander stehen. Sonst kann die innere Realität nicht produktiv verarbeitet werden und eine aktive Auseinandersetzung mit der äußeren Realität wird gehemmt. (Hurrelmann 2006: 129)
2.2.2 Das Konzept der Entwicklungsaufgaben
Hurrelmanns Sozialisationsmodell bedient sich des Konzeptes der Entwicklungsaufgaben, welches den Erziehungswissenschaften entstammt. Hier geht er ursprünglich von drei Lebensphasen
- Kindesalter,
- Jugendalter,
- Erwachsenenalter aus (Hurrelmann 2007: 37).
Für die Gesundheitssoziologie sind diese drei Lebensphasen allerdings nicht ausreichend, so das Hurrelmann diese um die Phase des hohen Alters erweitert.
Die verschiedenen Lebensphasen stellen an das Individuum spezifische Anforderungen an die Auseinandersetzung mit der äußeren und inneren Realität. Damit positive Impulse für die Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsdynamik entstehen können muss es dem Individuum gelingen die an es im Lebenslauf gestellten Entwicklungsaufgaben im körperlichen, psychischen, sozialen und ökologischen Bereich mit Hilfe der sozialen Umwelt zu bewältigen.
Die Entwicklungsaufgaben beziehen sich auf alle genannten Systeme:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
- Quote paper
- Marco Meissner (Author), 2010, Das Sozialisationskonzept von K. Hurrelmann - Zur Bedeutung der Sozialisation für die Gesundheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/148485