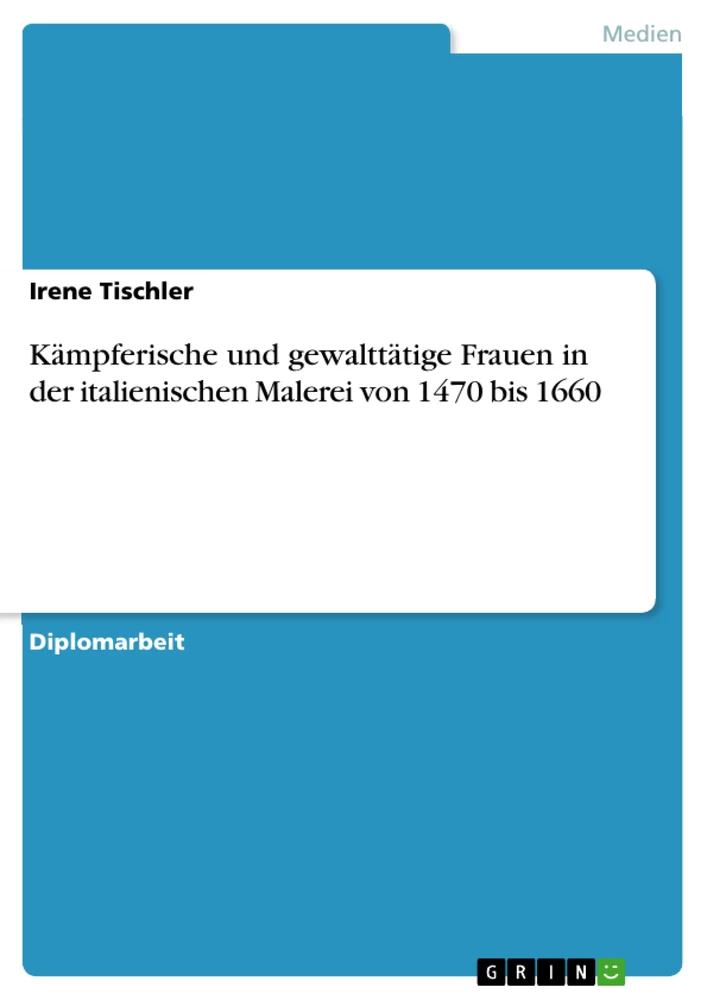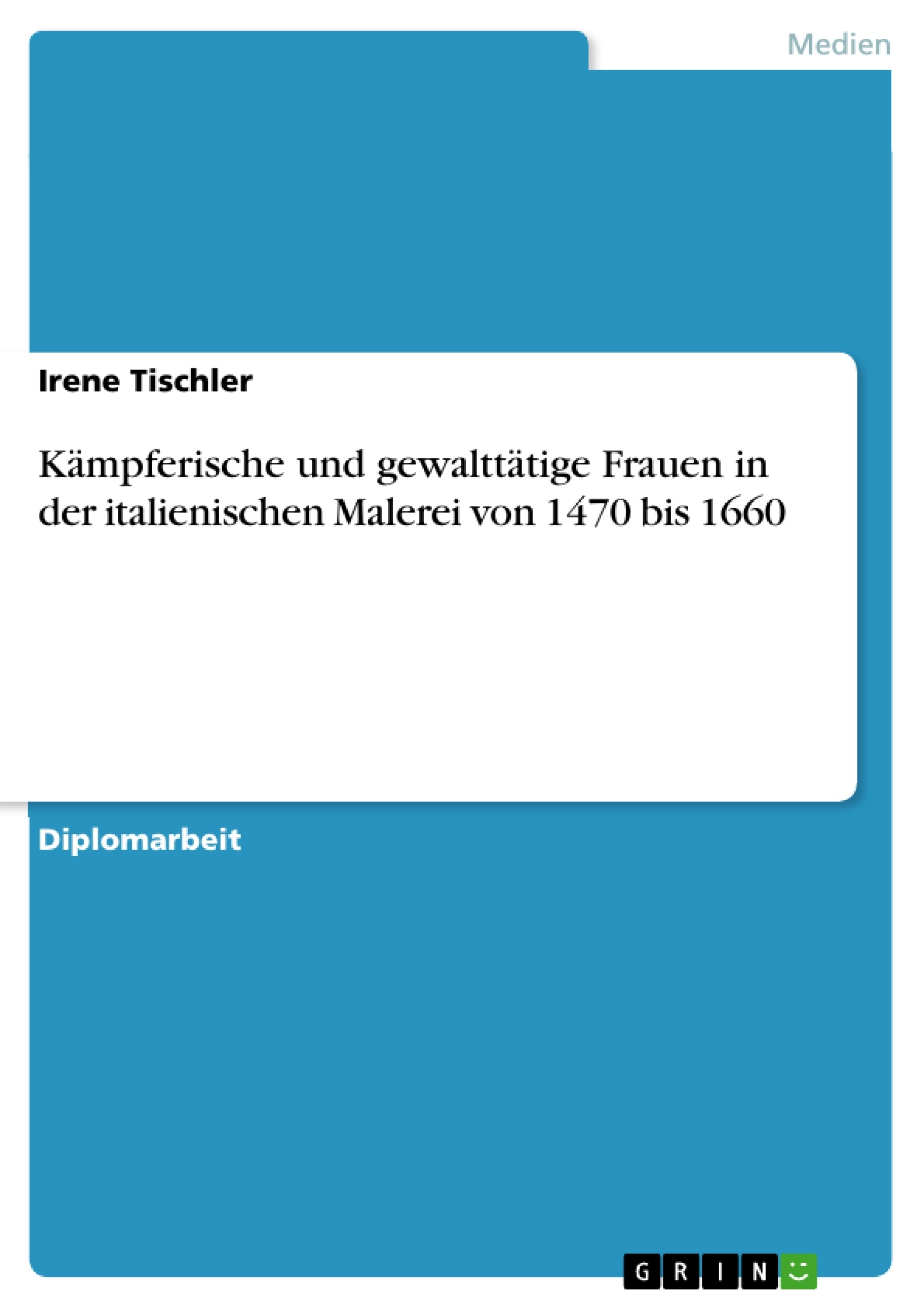Wenn brave Mädchen/Frauen in den Himmel kommen, böse aber überall hin, was
passiert dann mit mordenden Göttinnen, gepanzerten Jungfrauen nach der Schlacht, listigen Heroinen oder Fürstinnen, die Tugend und gewaltige Macht für sich beanspruchen?
Die vorliegende wissenschaftliche Abschlussarbeit stellt den Versuch dar, auf Fragen des Bildthemas der kämpferischen und gewalttätigen Frauen differenzierte Antworten zu finden.
Bildanalytisch vorgehend, wurde zuerst eine ikonographische Beschreibung des Dargestellten geleistet, deren Ergebnisse dann zu einem Vergleich mit primären Quellen, wie zeitgenössischer und klassischer Literatur herangezogen wurden. Anschließend vervollständigten indirekte Quellen, die die zeitgenössischen, kulturellen und gesellschaftlichen Verhältnisse beleuchten, die Verortung des Kunstwerks, also ihre Bezugsetzung zu AutorIn, Umfeld und eventuellen Pendants und die Erkenntnisse der aktuellen, wissenschaftlichen Sekundärliteratur den Bedeutungshorizont der Bilder.
Die rekonstruierte Bildaussage macht deutlich wie der scheinbare Widerspruch des Themas der kämpferischen/bewaffneten und gewalttätigen/handgreiflichen Frau zur traditionellen, dominierenden Auffassung der Frau als passives, (geistig) schwaches, abhängiges, friedfertiges/gewaltloses etc. Wesen in der italienischen Malerei dieses Zeitraumes verarbeitet wurde. Mittels verschiedener Analysekategorien konnte nachgewiesen werden, dass sich bildliche Repräsentationen von so charakterisierten Frauen in hochkomplexen Kontexten von Gewalt, Macht und Autonomie bewegen.
Das thematisch sehr umfangreiche Gebiet wurde beschränkt auf zwei heidnische Heroinen, nämlich Erminia, der sarazenischen Prinzessin und Camilla, der Heerführerin der römischen Epoche, die römischen Göttinnen Minerva und Diana und die alttestamentarischen Figuren Jaël und Judit, welche daraufhin anhand 17 ausgewählter malerischer Bildwerke besprochen wurden.
Die bildlichen Repräsentationen von kämpferischen und gewalttätigen Frauen in der italienischen Malerei von 1470 bis 1660 – das wurde in differenzierten Analysen nachgewiesen – sind somit nicht Ausdruck eines Vorzeichenwechsels der Geschlechterverhältnisse und -Identitäten, vielmehr erbrachte meine Diplomarbeit den Nachweis der Komplexität, Ambivalenz und Polydimensionalität des Diskurses über dieses Thema in Kontexten von Gewalt, Macht und Autonomie.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung
- Stellungen und Bedeutungen von Frauen in der Zeit von 1470 bis 1660
- Thema „Kämpferische und gewalttätige Frauen“ in jener Zeit
- Heidnische Heroinen
- Literarische Quellen – Allgemeine Ikonographie
- Bild 1: Guercino: Erminia und der Schäfer
- Bild 2: Sandro Botticelli: Camilla bändigt den Kentauren
- Griechische Göttinnen: Minerva
- Literarische Quellen – Allgemeine Ikonographie
- Bild 3: Artemisia Gentileschi: Minerva
- Bild 4: Andrea Mantegna: Minerva verjagt die Laster aus dem Garten der Tugend
- Bild 5: Elisabetta Sirani: Minerva kleidet sich an
- Griechische Göttinnen: Diana
- Literarische Quellen – Allgemeine Ikonographie
- Bild 6: Tiziano Vecellio: Tod des Aktaion
- Bild 7: Tintoretto: Tod der Niobiden
- Biblische Gestalten: Jaël
- Literarische Quellen – Allgemeine Ikonographie
- Bild 8: Artemisia Gentileschi: Jaël und Sisera
- Bild 9: Lodovico Cardi Cigoli: Jaël und Sisera
- Biblische Gestalten: Judit
- Literarische Quellen – Allgemeine Ikonographie
- Bild 10: Fede Galizia: Judit mit dem Kopf des Holofernes
- Bild 11: Giorgione: Judit mit dem Haupt des Holofernes
- Bild 12: Cristofano Allori: Judit mit dem Haupt des Holofernes
- Bild 13: Botticelli: Die Rückkehr Judits nach Betulia
- Bild 14: Michelangelo Buonarroti: Judit und Holofernes
- Bild 15: Artemisia Gentileschi: Judit und ihre Hausangestellte (Pitti)
- Bild 16: Caravaggio: Judit tötet Holofernes
- Bild 17: Artemisia Gentileschi: Judit tötet Holofernes (Uffizi)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht malerische Werke aus der Zeit von 1470 bis 1660, die Frauenfiguren darstellen, die kämpferische oder gewalttätige Züge aufweisen. Die Studie analysiert verschiedene weibliche Gestalten aus der heidnischen und biblischen Mythologie und beleuchtet deren Darstellung in der italienischen Malerei. Ziel ist es, die Visualisierung von Frauen in kämpferischen und gewalttätigen Rollen im Kontext der italienischen Kunstgeschichte zu verstehen und deren ikonographische Bedeutung zu analysieren.
- Darstellung von Frauen in kämpferischen und gewalttätigen Rollen
- Ikonographie und Symbolik der ausgewählten Frauenfiguren
- Bedeutung von Gender und Gewalt in der italienischen Kunst
- Einfluss literarischer Quellen und zeitgenössischer Kunsttheorien
- Analyse der jeweiligen Bilder und deren Kontextualisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit analysiert insgesamt siebzehn Gemälde, die unter drei Kategorien zusammengefasst werden: sterbliche heidnische Heroinen, römische Göttinnen und biblische Gestalten.
- Kapitel IV: Analysiert die Darstellung der heidnischen Heroinen Erminia und Camilla anhand von Guercinos Erminia und der Schäfer und Botticellis Camilla bändigt den Kentauren. Die Darstellung der kämpferischen Frau und deren Abwendung vom Krieg werden untersucht.
- Kapitel V: Untersucht die Darstellung der Göttin Minerva anhand von Gentileschis Minerva, Mantegnas Minerva verjagt die Laster aus dem Garten der Tugend und Siranis Minerva kleidet sich an. Die verschiedenen Aspekte der Göttin, ihre Rolle als Kämpferin, Friedensbringerin und Förderin der Künste, werden analysiert.
- Kapitel VI: Analysiert die Darstellung der Göttin Diana anhand von Tizians Tod des Aktaion und Tintorettos Tod der Niobiden. Die Göttin wird als mächtige und zornig-rächende Figur untersucht und die unterschiedliche Darstellung der Gewalt und der Strafe in beiden Bildern werden verglichen.
- Kapitel VII: Untersucht die Darstellung der biblischen Gestalt Jaël anhand von Gentileschis Jaël und Sisera und Cigolis Jaël und Sisera. Die beiden Bilder werden auf ihre ikonographische Bedeutung und die Darstellung der Tötung Siseras hin analysiert.
- Kapitel VIII: Analysiert die Darstellung der biblischen Gestalt Judit anhand von Galizias Judit mit dem Kopf des Holofernes, Giorgiones Judit mit dem Haupt des Holofernes, Alloris Judit mit dem Haupt des Holofernes, Botticellis Die Rückkehr Judits nach Betulia, Michelangelos Judit und Holofernes, Gentileschis Judit und ihre Hausangestellte und Caravaggios Judit tötet Holofernes. Die verschiedenen Interpretationen der Judit-Erzählung und die unterschiedlichen Schwerpunkte in der Darstellung der Tötung Holofernes werden untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der Kämpferischen und Gewalttätigen Frauen in der italienischen Malerei, der Ikonographie von Frauenfiguren, der Bedeutung von Gender und Gewalt in der Kunst, der italienischen Kunstgeschichte, der Renaissance und dem Barock. Zentrale Begriffe sind: Heroine, Göttin, Allegorie, Judit, Jaël, Minerva, Diana, Mythologie, Bibel, Ikonographie, Kunsttheorie, Gender, Gewalt, Bildanalyse, Malerei, Renaissance, Barock.
Häufig gestellte Fragen
Welche Frauenfiguren werden in der italienischen Malerei analysiert?
Die Arbeit untersucht heidnische Heroinen (Erminia, Camilla), Göttinnen (Minerva, Diana) und biblische Gestalten (Jaël, Judit).
Wie wird Gewalt durch Frauen in dieser Epoche dargestellt?
Die Darstellungen sind komplex und ambivalent; sie zeigen Frauen in Kontexten von Macht, Autonomie und oft göttlich legitimierter Gewalt.
Welche Rolle spielt die biblische Figur Judit?
Judit, die Holofernes tötet, ist ein zentrales Motiv, das von Malern wie Caravaggio und Artemisia Gentileschi sehr unterschiedlich interpretiert wurde.
Was unterscheidet Minerva von Diana in der Kunst?
Minerva wird oft als weise Kämpferin und Friedensbringerin dargestellt, während Diana häufiger als zornige Rächerin (z.B. Tod des Aktaion) erscheint.
War das Thema ein Zeichen für geänderte Geschlechterrollen?
Die Arbeit zeigt, dass dies weniger ein Vorzeichenwechsel der Rollen war, sondern eher ein Ausdruck der Komplexität des Diskurses über Macht und Geschlecht.
- Arbeit zitieren
- Irene Tischler (Autor:in), 2004, Kämpferische und gewalttätige Frauen in der italienischen Malerei von 1470 bis 1660, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/146514