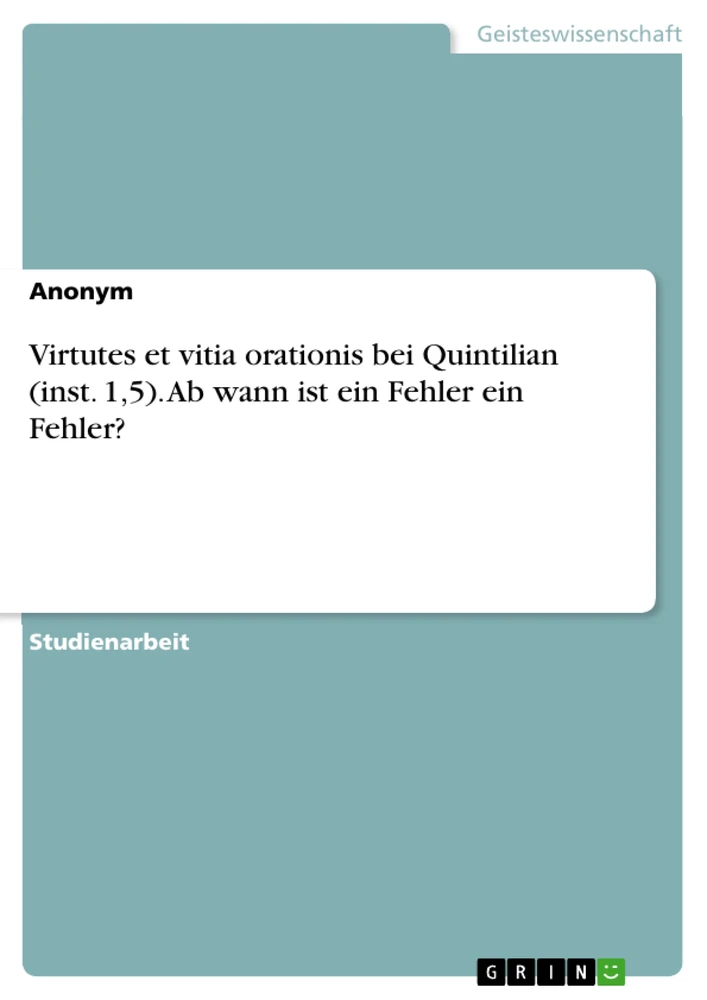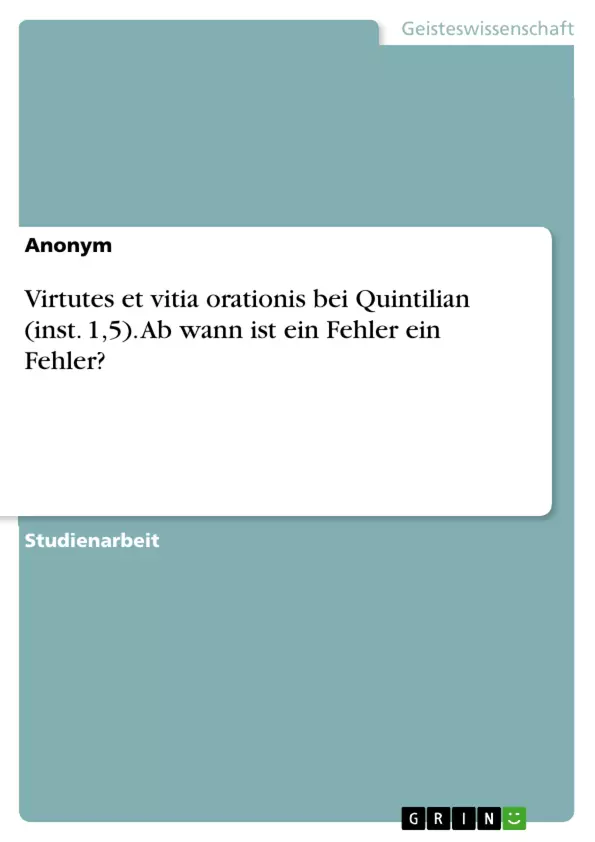In der vorliegenden Arbeit wird neben den virtutes orationis am Beispiel des barbarismus einer der beiden vitia orationis behandelt. Daran schließt sich die Betrachtung der Sprachnormierungskriterien an, um zu analysieren, ab wann bei Quintilian ein Fehler als ebensolcher gilt.
Marcus Fabius Quintilianus (ca. 35–100 n. Chr.) behandelt in seinem zwölf Bücher umfassenden Hauptwerk institutio oratoria die Ausbildung zu einem Redner und damit verbunden die Rhetorik allgemein. Beim Verfassen des Werkes konnte er auf seine langjährige Berufserfahrung als Lehrer zurückgreifen: Nach seiner Ausbildung in Rom kehrte er ca. 57 n. Chr. in seine Heimat, die Provinz Hispania, zurück und arbeitete dort als Anwalt, Redner und Rhetor. Im Jahr 68 n. Chr. begleitete Quintilian den Statthalter seiner Provinz und späteren Kaiser Galba nach Rom und bekleidete dort ab 70 n. Chr. unter Vespasian zwanzig Jahre lang eine öffentliche Professur für Rhetorik. Am Ende seines Lebens verfasste er aufbauend auf seiner Erfahrung und seinem Wissen ein Lehrwerk für Lehrer, die institutio oratoria (inst. 1,4,17). Im Zuge der elementaren Ausbildung von Schülern und Schülerinnen thematisiert Quintilian in den Kapiteln vier bis acht des ersten Buchs den Themenkomplex der Grammatik. Diese Kapitel sind der erste vollständig erhaltene Text zur römischen ars grammatica. Quintilian präsentiert eine kurze Zusammenfassung der ars, welche er in zwei Teilgebiete untergliedert: die recte loquendi scientia, bzw. ratio loquendi und die poetarum enarratio, bzw. enarratio auctorum (inst. 1,4,2 und 1,9,1). Im Zuge dessen liefert er im fünften Kapitel des ersten Buches eine gründliche Darstellung der virtutes et vitia orationis. Besonderen Augenmerk widmet er den Bereichen barbarismus und soloecismus. Für Quintilian gehören diese beiden Bereiche der Grammatik zwar zum elementaren Sprachunterricht (inst. 1,5,7), aber seine Ausführungen enthalten nicht die Standardbeispiele, sondern ausgewählte Problemfälle, die der Lehrerbildung dienen. Die vitia kontrastiert er mit den virtutes orationis und zeigt dabei auf, dass diese beiden Kategorien nicht trennscharf sind, sondern verschiedene Kriterien wie literarische Tradition und Sprachgebrauch dazu führen können, dass Fehler lizensiert werden und vitium auch zur virtus werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Text inst. 1,5,5-10
- Übersetzung inst. 1,5,5–7
- Kontextualisierung
- Makrokontextualisierung
- Mikrokontextualisierung
- virtutes orationis
- vitia orationis
- Beispiel barbarismus
- Ab wann ist ein Fehler ein Fehler?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Ausführungen Marcus Fabius Quintilianus' zum Thema "Barbarismus" in seiner Institutio oratoria. Sie befasst sich insbesondere mit der Frage, wann ein Sprachfehler für Quintilian als solcher gilt.
- Definition des Barbarismus nach Quintilian
- Bedeutung der Sprachnormierungskriterien in Quintilian's Zeit
- Beziehung zwischen Fehler und "virtus" (Tugend) in der Rede
- Analyse der Fehlerklassifizierung und der Rolle der literarischen Tradition
- Einordnung von Quintilian's Ausführungen in den Kontext der römischen ars grammatica
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Einleitung stellt Quintilian und sein Werk Institutio oratoria vor, mit Fokus auf die Bedeutung der Grammatik in seiner Lehre. Die Arbeit konzentriert sich auf das 5. Kapitel des 1. Buches, das sich mit den virtutes et vitia orationis, insbesondere mit dem Barbarismus, befasst.
- Text inst. 1,5,5-10: Präsentation des relevanten Textes aus Quintilian's Institutio oratoria, in dem er den Barbarismus als Fehler in einzelnen Wörtern definiert.
- Übersetzung inst. 1,5,5-7: Übersetzung des Textes ins Deutsche, um eine verständliche Interpretation zu ermöglichen.
- Kontextualisierung: Erörterung des makroskopischen und mikroskopischen Kontextes von Quintilian's Ausführungen. Der makroskopische Kontext betrifft die allgemeine Bildungslandschaft in der römischen Antike, insbesondere Quintilian's eigene Rolle als Rhetoriker und Lehrer. Der mikroskopische Kontext befasst sich mit der Einordnung des 5. Kapitels in das gesamte Werk der Institutio oratoria und der Beziehung zur römischen ars grammatica.
- virtutes orationis: Vorstellung der drei "Tugenden" der Rede nach Quintilian: Fehlerlosigkeit, Verständlichkeit und Schmuck. Analyse der Unterschiede zu Theophrast's Tetrade von Rede-Tugenden.
- vitia orationis: Vorstellung der Fehlertypen, die Quintilian in seiner Institutio oratoria behandelt, mit Fokus auf den Barbarismus und Soloecismus. Diskussion über die Abgrenzung von grammatischen und rhetorischen Fehlern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche Sprachnormierung, Rhetorik, Grammatik und Fehlerklassifizierung im Werk von Quintilian. Zentraler Begriff ist der Barbarismus, der im Kontext der virtutes et vitia orationis analysiert wird. Weitere wichtige Aspekte sind die literarische Tradition, die Bedeutung der Sprachnormierungskriterien und die Beziehung zwischen Fehler und Tugend in der Rede.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Virtutes et vitia orationis bei Quintilian (inst. 1,5). Ab wann ist ein Fehler ein Fehler?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1462194