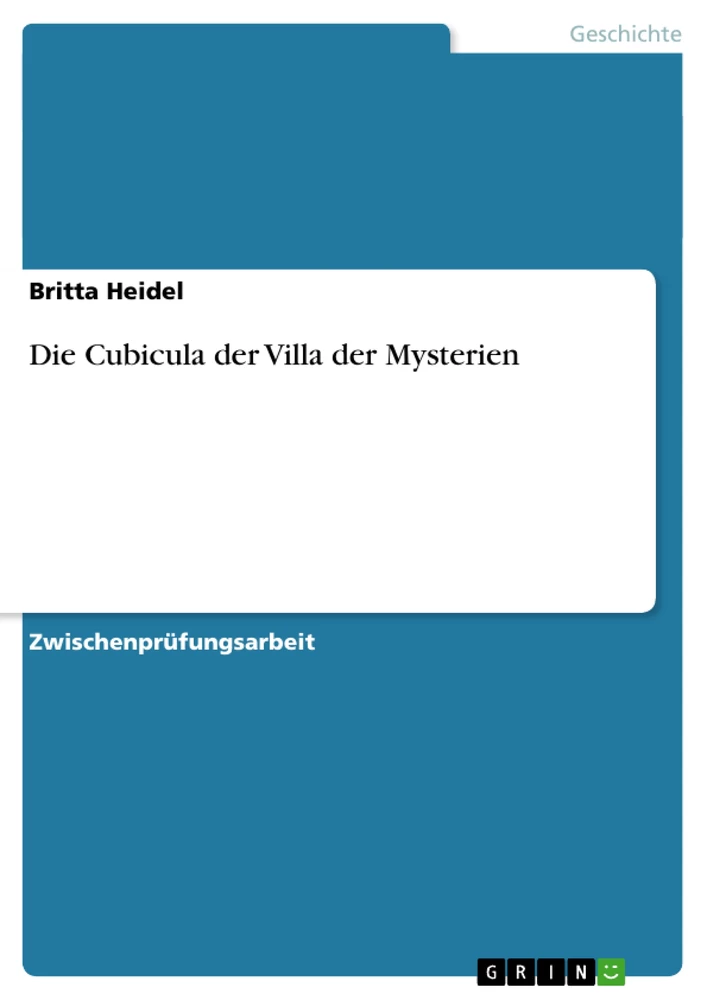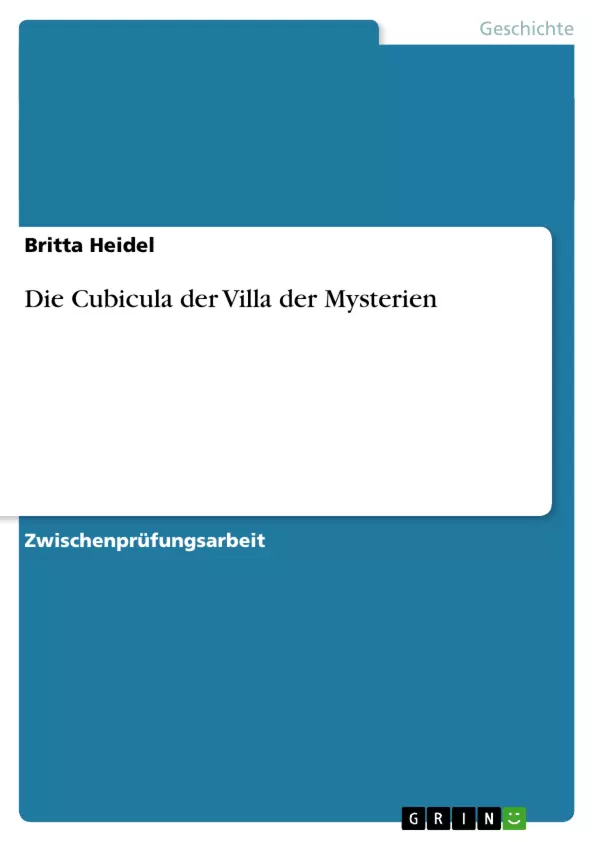In der Archäologie besteht die Schwierigkeit, eine eindeutige Verbindung zwischen den Bezeichnungen und die damit verbundene Deutung von Wohnräumen und ihre Funktion innerhalb des Hauses klar darzustellen. Der Archäologe steht hierbei vor zwei schwerwiegenden Problemen:
I. Auftretende Missverständnisse bei der Verwendung antiker Termini in der Gleichsetzung von alten und neuen Bezeichnung von Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs.
II. Problem der über Deskription hinausgehenden Anwendung antiker Termini und ihre Übertragung auf archäologische Funde.
Im neuzeitliche Denken wird seit Beginn des 18. Jahrhunderts im europäischen Raum in der Wohnkultur eine klare Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz vorgesehen. Auch eine konkrete Trennung zwischen öffentlichen und privaten Räumen findet erst in dieser Zeit statt. So werden den Gemächern differenzierte Funktionen zugewiesen. Eine Anwendung dieser Vorstellung auf ein antikes Wohnhaus ist nicht möglich und spiegelt diese Gegebenheiten nur unzureichend wieder.
Anhand der Wanddekoration der einzelnen Räume und Ihrer qualitativen Gestaltung wird ersichtlich, welche Bedeutung diesen Gemächern beigemessen wurde. In detektivischer Kleinarbeit wird erst deutlich, welche Räume der Öffentlichkeit zugänglich und welche Privatgemächer waren.
Leider ist die ursprüngliche Dekoration der Mysterienvilla nur zum Teil bekannt. Einige Wandmalereien sind durch Neue ersetzt worden oder es wurden nicht alle Wände des 2. Stils in der Literatur berücksichtigt. Die Cubicula 19 bis 21 weisen laut Beyen hauptsächlich konservative Malereien vor und zählen zu den unbedeutenen und schlecht erhaltenen Zimmern. So sind vorwiegend Abbildungen der besser erhaltenen Dekorationen der Prunkräume im Westtrakt publiziert worden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Schwierigkeit der Anwendung der antiken Termini
- 1.1 Die römische Wohnkultur
- 1.2 Bedeutung der Cubicula
- 2. Die Villa der Mysterien
- 2.1 Lage und Entdeckung
- 2.2 Ursprünglicher Aufbau und ihre Umbauphasen
- 3. Künstlerische Gestaltung der „Ruheräume“ in der Villa der Mysterien
- 3.1 Merkmale des zweiten Stils
- 3.2 Cubiculum 3
- 3.3 Cubiculum 4
- 3.4 Cubiculum 8
- 3.5 Cubiculum 16
- 4. Die Stellung der Cubicula zu den jeweiligen Prunkräumen der Villa der Mysterien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Cubicula in der Villa der Mysterien in Pompeji. Ziel ist es, die Funktion und Bedeutung dieser Räume im Kontext der römischen Wohnkultur zu klären und ihre künstlerische Gestaltung im zweiten pompejanischen Stil zu analysieren. Dabei werden die Schwierigkeiten der Interpretation antiker Termini berücksichtigt.
- Die Herausforderungen der archäologischen Interpretation römischer Wohnräume
- Die Funktion der Cubicula in der römischen Villa
- Die künstlerische Gestaltung der Cubicula in der Villa der Mysterien
- Der Vergleich der Cubicula mit repräsentativen Räumen der Villa
- Die soziale Bedeutung der Raumgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Schwierigkeit der Anwendung der antiken Termini: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Interpretation römischer Wohnräume aufgrund der Mehrdeutigkeit antiker Termini. Es werden die Probleme der Gleichsetzung antiker und moderner Bezeichnungen sowie die Übertragung antiker Begriffe auf archäologische Funde herausgestellt. Der Unterschied zwischen der modernen Auffassung von Wohn- und Arbeitsbereichen und der antiken Realität wird deutlich gemacht. Die Analyse der Wanddekorationen als Indikator für die soziale Bedeutung der Räume wird als Methode vorgestellt. Die unvollständige Kenntnis der ursprünglichen Dekoration der Villa der Mysterien und die Fokussierung auf besser erhaltene Räume werden erwähnt.
1.1 Die römische Wohnkultur: Das Kapitel beschreibt die zentrale Rolle des römischen Wohnhauses, insbesondere der Villa, im sozialen Leben. Das Atrium als repräsentativer Mittelpunkt und Schauplatz gesellschaftlicher Ereignisse wird hervorgehoben. Die Trennung zwischen öffentlichen und privaten Räumen wird im Kontext der römischen Oberschicht erörtert, wobei die Architektur und Ausstattung als Ausdruck des sozialen Status verstanden werden. Die Zugänglichkeit von Räumen wie Vestibulum, Atrium, Tablinum und Peristyl im Gegensatz zu den privaten Gemächern (Oeci, Triclinia und Cubicula) wird differenziert dargestellt. Die Frage nach der Funktion der Cubicula wird eingeführt.
1.2 Bedeutung der Cubicula: Die irreführende Übersetzung von "cubiculum" als "Schlafzimmer" wird kritisiert. Die Bedeutung der Bezeichnung wird in Bezug auf die Ausstattung (mindestens eine Kline) und die damit verbundene Körperhaltung erklärt. Das Kapitel betont, dass die Bezeichnung allein keine eindeutige Aussage über die Nutzung zulässt und weitergehende Analysen notwendig sind.
2. Die Villa der Mysterien: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Lage und Entdeckung der Villa der Mysterien sowie ihren ursprünglichen Aufbau und die verschiedenen Umbauphasen. Es legt den Grundstein für das Verständnis des Kontextes, in dem die Cubicula zu betrachten sind.
3. Künstlerische Gestaltung der „Ruheräume“ in der Villa der Mysterien: Dieses Kapitel analysiert die künstlerische Gestaltung ausgewählter Cubicula (3, 4, 8, 16) in der Villa der Mysterien, fokussiert auf den zweiten pompejanischen Stil. Es beschreibt die Merkmale dieses Stils und geht detailliert auf die spezifischen Wandmalereien und deren Bedeutung in den jeweiligen Räumen ein. Es wird die künstlerische Ausführung und ikonographische Elemente untersucht, um Rückschlüsse auf die Funktion und die soziale Bedeutung der Räume zu ziehen.
4. Die Stellung der Cubicula zu den jeweiligen Prunkräumen der Villa der Mysterien: Dieses Kapitel vergleicht die Cubicula mit den prunkvollen Räumen der Villa, um deren Stellung innerhalb des Gesamtkomplexes zu bestimmen und die Hierarchie der Räume im Kontext der römischen Wohnkultur zu beleuchten. Es wird die soziale Bedeutung der unterschiedlichen Raumtypen diskutiert.
Schlüsselwörter
Cubicula, Villa der Mysterien, Pompeji, römische Wohnkultur, Wandmalerei, zweiter pompejanischer Stil, Archäologie, Raumfunktion, soziale Bedeutung, antike Termini.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Die Cubicula in der Villa der Mysterien in Pompeji"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Cubicula in der Villa der Mysterien in Pompeji. Sie analysiert deren Funktion, Bedeutung im Kontext der römischen Wohnkultur und deren künstlerische Gestaltung im zweiten pompejanischen Stil. Ein besonderer Fokus liegt auf den Schwierigkeiten der Interpretation antiker Termini und deren Übersetzung in die heutige Sprache.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Funktion und Bedeutung der Cubicula in der Villa der Mysterien zu klären und ihre künstlerische Gestaltung zu analysieren. Dabei werden die Herausforderungen der archäologischen Interpretation römischer Wohnräume, die Funktion der Cubicula in der römischen Villa, deren künstlerische Gestaltung und der Vergleich mit repräsentativen Räumen der Villa berücksichtigt. Die soziale Bedeutung der Raumgestaltung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Schwierigkeit der Anwendung der antiken Termini (inkl. 1.1 Die römische Wohnkultur und 1.2 Bedeutung der Cubicula); 2. Die Villa der Mysterien; 3. Künstlerische Gestaltung der „Ruheräume“ in der Villa der Mysterien; und 4. Die Stellung der Cubicula zu den jeweiligen Prunkräumen der Villa der Mysterien.
Welche Schwierigkeiten werden bei der Interpretation der Cubicula erwähnt?
Die Arbeit hebt die Mehrdeutigkeit antiker Termini hervor. Die Übersetzung von "cubiculum" als "Schlafzimmer" wird als irreführend kritisiert. Die unvollständige Kenntnis der ursprünglichen Dekoration der Villa und die Fokussierung auf besser erhaltene Räume werden ebenfalls als Herausforderungen genannt. Die Arbeit betont die Notwendigkeit weitergehender Analysen über die bloße Bezeichnung hinaus.
Wie wird die römische Wohnkultur beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die zentrale Rolle des römischen Wohnhauses, insbesondere der Villa, im sozialen Leben. Das Atrium wird als repräsentativer Mittelpunkt und Schauplatz gesellschaftlicher Ereignisse hervorgehoben. Die Trennung zwischen öffentlichen und privaten Räumen und die Architektur/Ausstattung als Ausdruck des sozialen Status werden diskutiert. Die Zugänglichkeit verschiedener Räume (Vestibulum, Atrium, Tablinum, Peristyl) im Gegensatz zu den privaten Gemächern (Oeci, Triclinia, Cubicula) wird differenziert dargestellt.
Welche Rolle spielt der zweite pompejanische Stil?
Der zweite pompejanische Stil ist zentral für die Analyse der künstlerischen Gestaltung der Cubicula. Die Arbeit beschreibt die Merkmale dieses Stils und untersucht detailliert die Wandmalereien und deren ikonographische Elemente in den ausgewählten Cubicula (3, 4, 8, 16), um Rückschlüsse auf die Funktion und soziale Bedeutung der Räume zu ziehen.
Wie werden die Cubicula im Kontext der Villa der Mysterien betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Cubicula im Kontext der Gesamtarchitektur der Villa der Mysterien. Sie vergleicht sie mit den prunkvollen Räumen der Villa, um deren Stellung innerhalb des Gesamtkomplexes und die Hierarchie der Räume im Kontext der römischen Wohnkultur zu bestimmen. Die soziale Bedeutung der unterschiedlichen Raumtypen wird diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cubicula, Villa der Mysterien, Pompeji, römische Wohnkultur, Wandmalerei, zweiter pompejanischer Stil, Archäologie, Raumfunktion, soziale Bedeutung, antike Termini.
- Quote paper
- Britta Heidel (Author), 2003, Die Cubicula der Villa der Mysterien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/14607