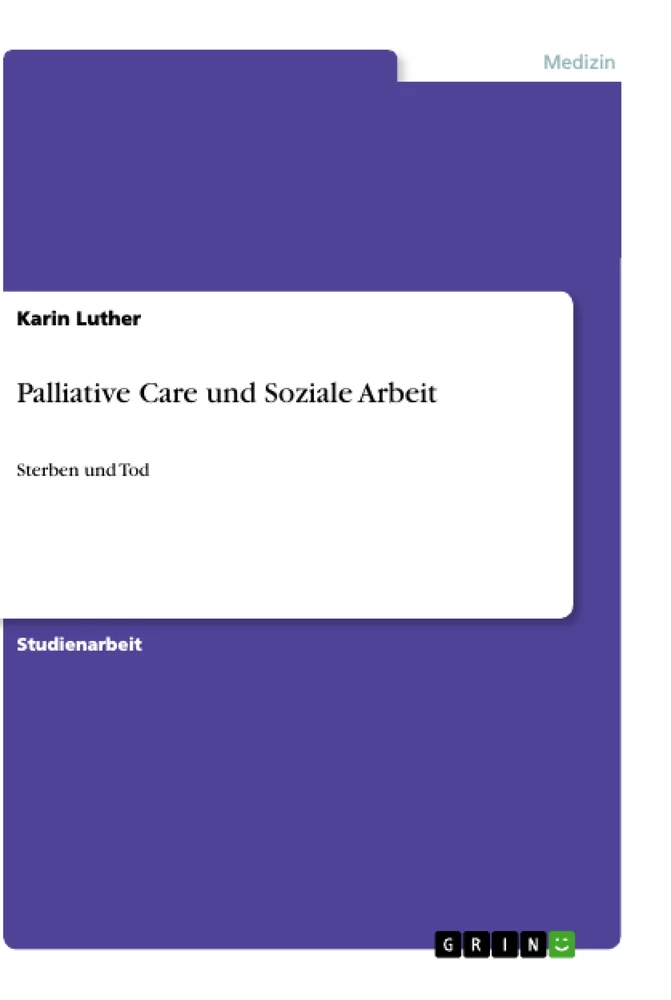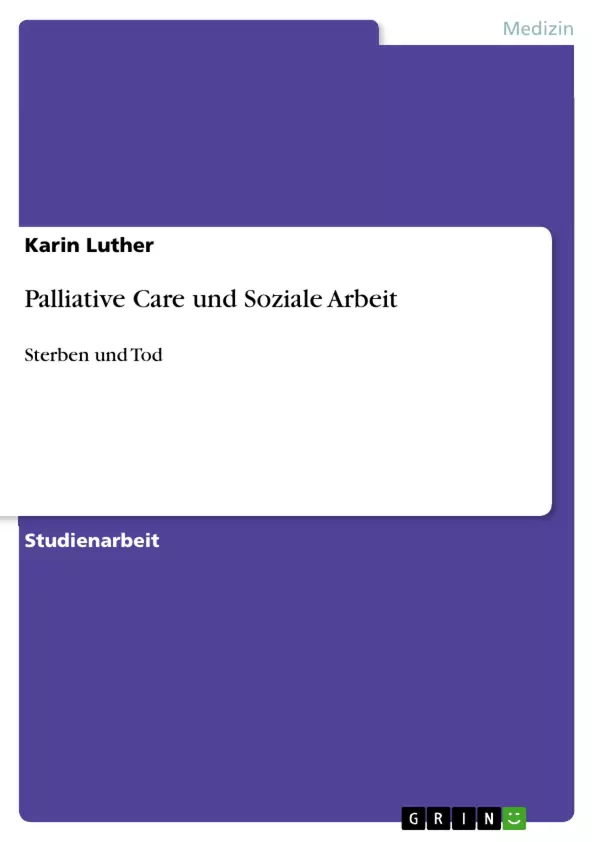In den folgenden Punkten wird von daher besonders auf den Umgang mit den Patienten und seinen Angehörigen eingegangen. Weiterhin wird auf die Situation des/ der SozialarbeiterIn im Kontext dieses Arbeitsfeldes Bezug genommen und mögliche psychische Belastungen bis hin zum Burnout-Syndrom beleuchtet.
Zum Schluss der Arbeit werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie der/die SozialarbeiterIn befriedigend und kompetent mit Hilfe von Entlastungsstrategien seiner Arbeit in diesem anspruchsvollen aber auch erschöpfenden Bereich nachgehen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Was bedeutet Sterben und was bedeutet Tod
- 2. Geschichte
- 3. Begriffserklärung Hospizarbeit
- 4. Die Klienten der Palliativstationen und Hospize in Deutschland
- 5. Probleme
- 6. Theoretische Ansätze
- 7. Kompetenzen und Methoden des Sozialarbeiters
- 8. Das Phasenmodell nach Kübler-Ross
- 8.1. Beispiel Herr „Mux“
- 9. Ängste der Angehörigen
- 10. Aufgabenfelder der Sozialen Arbeit
- 11. Hilfeleitfaden für die Betroffenen und ihre Angehörigen
- 12. Beispiele für gesetzlich geregelte Hilfsangebote
- 13. Burnout
- 14. Emotionale Belastungen für die SozialarbeiterIn
- 15. Mögliche Anzeichen für das Burn-Out-Syndrom
- 16. Der Umgang mit den Belastungsfaktoren
- 17. Selbsthilfekontakte für Betroffene und Angehörigen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat „Sterben und Tod“ beschäftigt sich mit der Thematik des Sterbens und Todes im Kontext der Arbeit mit schwer kranken Menschen und deren Angehörigen. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Palliativmedizin und Hospizarbeit, die verschiedenen Aspekte des Sterbens und Todes, die Bedeutung von sozialarbeiterischer Intervention und die Herausforderungen, die mit diesem Arbeitsfeld verbunden sind.
- Das Verständnis von Sterben und Tod in medizinischer und sozialer Hinsicht
- Die Entstehung und Entwicklung der Palliativmedizin und Hospizarbeit
- Die Rolle des Sozialarbeiters in der Begleitung von schwer kranken Menschen und ihren Angehörigen
- Die Herausforderungen und Belastungen für Sozialarbeiter in diesem Arbeitsfeld, einschließlich Burnout-Risiken
- Möglichkeiten der Unterstützung und Entlastung für Sozialarbeiter und Angehörige
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die verschiedenen Bedeutungen des Sterbens und Todes und die damit verbundenen medizinischen und psychologischen Aspekte.
- Das zweite Kapitel schildert die Entstehung und Entwicklung der Palliativmedizin und Hospizarbeit, unterstreicht die Bedeutung von individuellen Bedürfnissen und ganzheitlicher Betreuung.
- Kapitel drei behandelt die zentralen Aspekte der Hospizarbeit, wie zum Beispiel die Begleitung und Unterstützung von Sterbenden und Angehörigen, die Arbeit im multiprofessionellen Team und die Einbeziehung von ehrenamtlichen Mitarbeitern.
- Kapitel vier gibt Einblicke in die Zielgruppe der Palliativstationen und Hospize in Deutschland und beleuchtet die vielfältigen Bedürfnisse der Patienten und ihrer Familien.
- Kapitel fünf befasst sich mit den Herausforderungen und Problemen, die im Kontext der Sterbebegleitung auftreten können, und zeigt die Bedeutung von professionellem Umgang mit diesen Themen auf.
- Kapitel sechs befasst sich mit verschiedenen theoretischen Ansätzen, die die Arbeit in der Palliativmedizin und Hospizarbeit beeinflussen.
- Kapitel sieben beleuchtet die spezifischen Kompetenzen und Methoden des Sozialarbeiters in der Sterbebegleitung und die Bedeutung von Empathie, Kommunikation und interdisziplinärer Zusammenarbeit.
- Kapitel acht beschreibt das Phasenmodell von Kübler-Ross und zeigt seine Bedeutung für die Begleitung von Sterbenden.
- Kapitel neun beleuchtet die Ängste und Herausforderungen, denen Angehörige von schwer kranken Menschen gegenüberstehen, und die Wichtigkeit von Unterstützung und Begleitung.
- Kapitel zehn beschreibt die verschiedenen Aufgabenfelder der Sozialen Arbeit in der Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen.
- Kapitel elf erläutert Hilfestellungen und Leitfäden für die Betroffenen und ihre Angehörigen, die im Umgang mit dem Sterben und dem Tod eine wichtige Rolle spielen können.
- Kapitel zwölf bietet Beispiele für gesetzlich geregelte Hilfsangebote, die für Sterbende und Angehörige zur Verfügung stehen.
- Kapitel dreizehn beschäftigt sich mit dem Phänomen des Burnouts und seinen Auswirkungen auf Sozialarbeiter in diesem Arbeitsfeld.
- Kapitel vierzehn beleuchtet die emotionalen Belastungen, die die Arbeit mit schwer kranken Menschen und ihren Angehörigen für den Sozialarbeiter mit sich bringt.
- Kapitel fünfzehn beschreibt mögliche Anzeichen für das Burn-Out-Syndrom bei Sozialarbeitern und zeigt die Bedeutung von frühzeitiger Erkennung und Intervention auf.
- Kapitel sechzehn behandelt den Umgang mit Belastungsfaktoren und zeigt verschiedene Strategien, die Sozialarbeiter in ihrem Arbeitsalltag zur Stressbewältigung und Gesundheitsförderung nutzen können.
- Kapitel siebzehn stellt Selbsthilfekontakte für Betroffene und Angehörige vor, die ihnen Unterstützung und Austausch in schwierigen Situationen ermöglichen können.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Referats „Sterben und Tod“ sind: Palliativmedizin, Hospizarbeit, Sterbebegleitung, Sozialarbeit, Angehörigenarbeit, psychosoziale Begleitung, Burnout, Trauerarbeit, Lebensqualität, Bedürfnisse von Sterbenden, Kommunikation, multiprofessionelles Team, Empathie, Entlastung, Selbsthilfe.
- Arbeit zitieren
- Karin Luther (Autor:in), 2009, Palliative Care und Soziale Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/146013