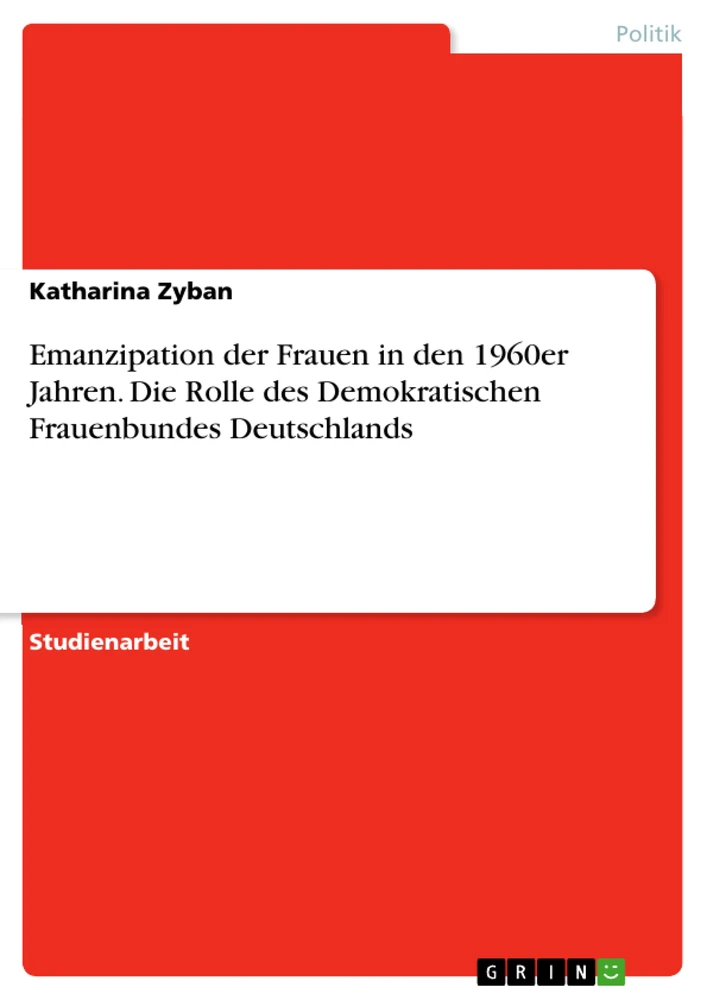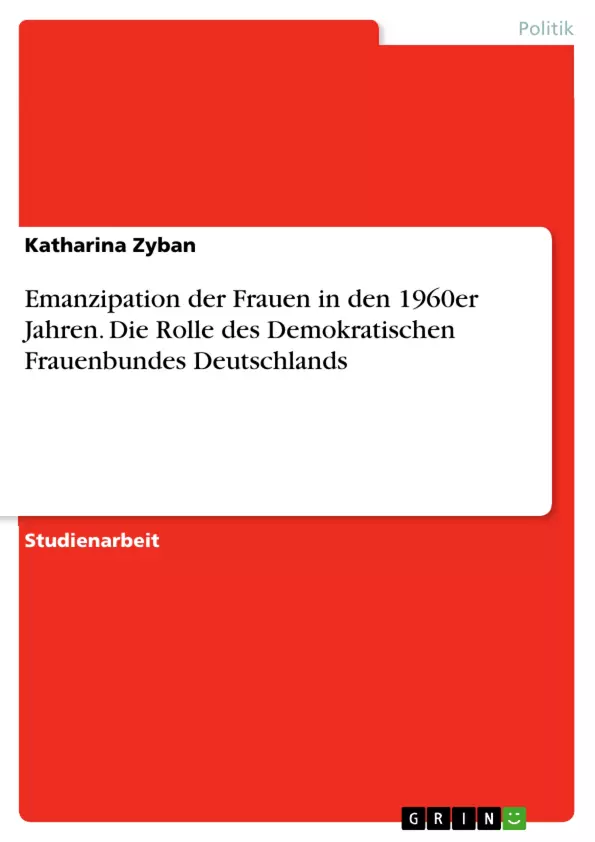War die Emanzipation in der DDR wirklich ein Geschenk des Staates, oder verbarg sich dahinter eine gezielte Strategie zur Ankurbelung der Wirtschaft? Diese brisante Frage steht im Zentrum dieser tiefgründigen Analyse der Frauenpolitik der SED in den 1960er Jahren. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der das propagierte Frauenbild zwischen sozialistischer Idealvorstellung und ökonomischer Notwendigkeit hin- und hergerissen war. Die vorliegende Studie seziert die Rolle des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands (DFD) als vermeintliche Speerspitze der Gleichberechtigung und entlarvt die subtilen Mechanismen der staatlichen Steuerung. Untersucht werden die einschneidenden Auswirkungen des Gesetzbuchs der Arbeit und des Familiengesetzbuchs auf das Leben der Frauen, von der geförderten Frauenerwerbstätigkeit bis hin zu den demografischen Konsequenzen für die Gesellschaft. Erfahren Sie, wie bildungspolitische Maßnahmen zur Gleichstellung instrumentalisiert wurden und welche wirtschaftlichen Vorteile sich der Staat von der berufstätigen Frau versprach. Diese aufschlussreiche Analyse wirft ein neues Licht auf die komplexen Zusammenhänge zwischen Ideologie, Politik und dem Alltag der Frauen in der DDR. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für die Geschichte der Frauenbewegung, die deutsch-deutsche Vergangenheit und die Mechanismen sozialistischer Systeme interessieren. Entdecken Sie die verborgenen Facetten der DDR-Geschichte und hinterfragen Sie kritisch die vermeintlichen Errungenschaften der sozialistischen Frauenpolitik. Diese Arbeit bietet eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Frauenemanzipation in der DDR, indem sie ideologische Prämissen, politische Maßnahmen und gesellschaftliche Auswirkungen kritisch beleuchtet. Es geht um mehr als nur Gleichberechtigung; es geht um die Instrumentalisierung der Frau im Dienste des Staates und die damit verbundenen Konsequenzen. Schlüsselwörter: Frauenemanzipation, DDR, 1960er Jahre, SED, Frauenpolitik, Gesetzbuch der Arbeit, Familiengesetzbuch, Bildungspolitik, Frauenerwerbstätigkeit, DFD, Gleichberechtigung, sozialistischer Staat, Frauenbild, ideologischer Hintergrund.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Vorbetrachtungen
- 1. Ideologischer und historischer Hintergrund
- 2. Frauenbild in der Gesellschaft
- 3. Rolle des DFD bei der Emanzipation
- III. Maßnahmen und Gesetze zur Gleichstellung
- 1. Das Gesetzbuch der Arbeit
- 2. Das Familiengesetzbuch
- 3. Bildungspolitische Maßnahmen
- IV. Folgen
- 1. Wirtschaftliche Folgen
- 2. Demographische Folgen
- V. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Frauenemanzipationspolitik der SED und der Förderung der Frauenerwerbstätigkeit in der DDR der 1960er Jahre. Sie analysiert das propagierte Frauenbild, die Rolle des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands (DFD), gesetzliche Regelungen zur Frauenerwerbstätigkeit und politische Maßnahmen bezüglich Ehe und Familie.
- Das Frauenbild in der DDR der 1960er Jahre und seine Widersprüche.
- Die Rolle des DFD in der Umsetzung der Frauenemanzipationspolitik.
- Analyse des Gesetzbuchs der Arbeit und des Familiengesetzbuchs.
- Bildungspolitische Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter.
- Wirtschaftliche und demographische Folgen der Frauenpolitik.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Frauenemanzipation in der DDR der 1960er Jahre ein und formuliert die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Frauenemanzipationspolitik und der Förderung der Frauenerwerbstätigkeit durch die SED. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt weitere Forschungsfragen, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Einleitung betont den staatlich gelenkten Charakter der Emanzipation in der DDR und den Unterschied zur westdeutschen Auffassung von Gleichberechtigung.
II. Vorbetrachtungen: Dieses Kapitel legt den ideologische und historischen Hintergrund der SED-Frauenpolitik dar. Es vergleicht den Begriff der Gleichberechtigung in der DDR und der BRD, wobei die DDR-Definition das Selbstbestimmungsrecht der Frau vernachlässigt. Der Abschnitt beleuchtet den Beginn sozialistischer Auseinandersetzungen mit der Stellung der Frau im 19. Jahrhundert und untersucht die Integration von Frauen in den Arbeitsprozess der Nachkriegsjahre. Schließlich analysiert es das staatlich propagierte Frauenbild und die Rolle des DFD als wichtiges Instrument der SED-Frauenpolitik.
Schlüsselwörter
Frauenemanzipation, DDR, 1960er Jahre, SED, Frauenpolitik, Gesetzbuch der Arbeit, Familiengesetzbuch, Bildungspolitik, Frauenerwerbstätigkeit, DFD, Gleichberechtigung, sozialistischer Staat, Frauenbild, ideologischer Hintergrund.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es dient zur Analyse von Frauenthemen in der DDR im akademischen Kontext.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst die Einleitung, Vorbetrachtungen (mit ideologischem und historischem Hintergrund, Frauenbild in der Gesellschaft, Rolle des DFD bei der Emanzipation), Maßnahmen und Gesetze zur Gleichstellung (Gesetzbuch der Arbeit, Familiengesetzbuch, bildungspolitische Maßnahmen), Folgen (wirtschaftliche und demographische) und Schlussbetrachtungen.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Frauenemanzipationspolitik der SED und der Förderung der Frauenerwerbstätigkeit in der DDR der 1960er Jahre. Analysiert werden das propagierte Frauenbild, die Rolle des DFD, gesetzliche Regelungen und politische Maßnahmen bezüglich Ehe und Familie. Die Themenschwerpunkte liegen auf dem Frauenbild, der Rolle des DFD, der Analyse relevanter Gesetze, bildungspolitischen Maßnahmen und den wirtschaftlichen sowie demographischen Folgen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik der Frauenemanzipation in der DDR der 1960er Jahre ein und formuliert die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Frauenemanzipationspolitik und der Förderung der Frauenerwerbstätigkeit durch die SED. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt weitere Forschungsfragen. Sie betont den staatlich gelenkten Charakter der Emanzipation in der DDR und den Unterschied zur westdeutschen Auffassung von Gleichberechtigung.
Was sind die Vorbetrachtungen?
Dieses Kapitel legt den ideologische und historischen Hintergrund der SED-Frauenpolitik dar. Es vergleicht den Begriff der Gleichberechtigung in der DDR und der BRD, beleuchtet den Beginn sozialistischer Auseinandersetzungen mit der Stellung der Frau und untersucht die Integration von Frauen in den Arbeitsprozess der Nachkriegsjahre. Schließlich analysiert es das staatlich propagierte Frauenbild und die Rolle des DFD.
Welche Schlüsselwörter werden verwendet?
Die Schlüsselwörter umfassen: Frauenemanzipation, DDR, 1960er Jahre, SED, Frauenpolitik, Gesetzbuch der Arbeit, Familiengesetzbuch, Bildungspolitik, Frauenerwerbstätigkeit, DFD, Gleichberechtigung, sozialistischer Staat, Frauenbild, ideologischer Hintergrund.
- Quote paper
- Katharina Zyban (Author), 2018, Emanzipation der Frauen in den 1960er Jahren. Die Rolle des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1459485