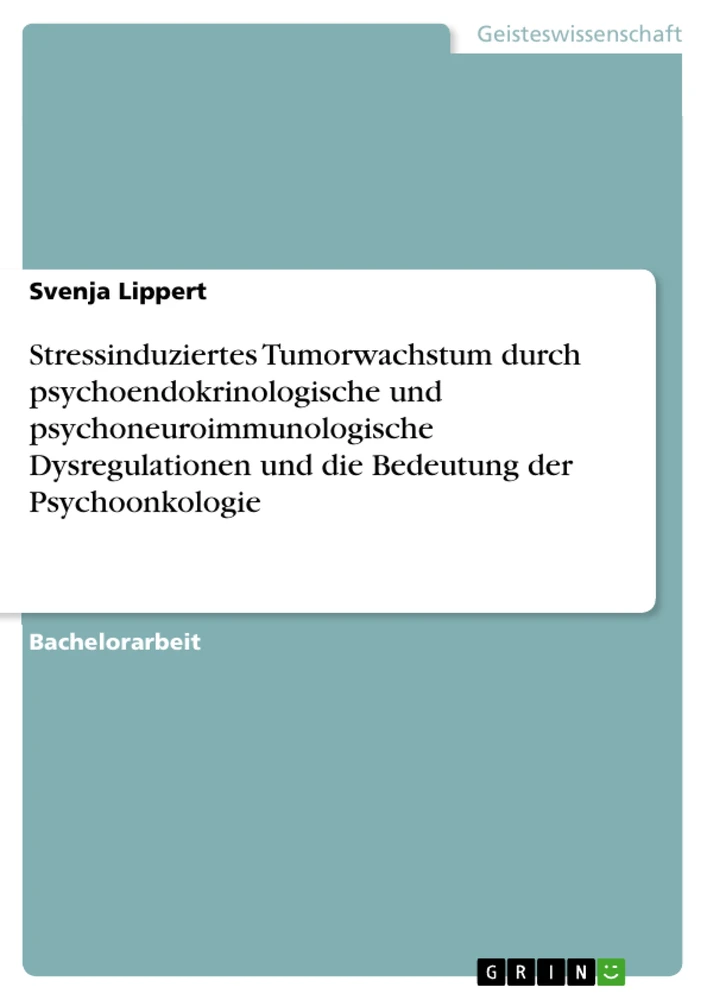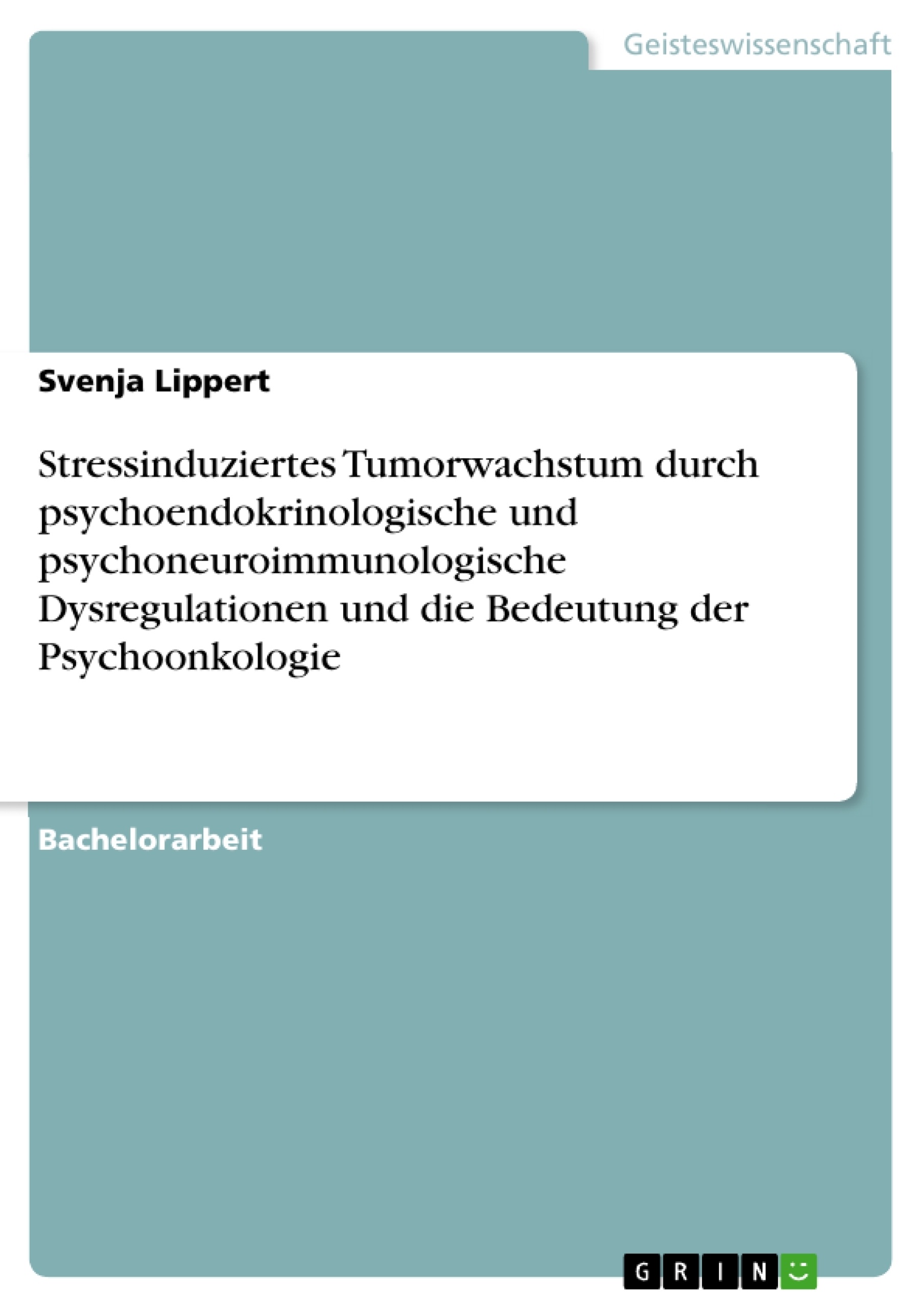Inwiefern kann langanhaltender Stress, welcher immunologische und endokrinologische Dysregulationen auslöst, das Tumorwachstum innerhalb von bestehenden Krebserkrankungen beeinflussen? Inwieweit weisen psychoonkologische Interventionen positive Effekte auf Stressreduktion innerhalb der Krebserkrankung auf, welche die Prognose verbessern können?
Diese Arbeit stellt die psychoendokrinologischen und psychoneuroimmunologischen Dysregulationen, verursacht durch Stress, als Auslöser für ein erhöhtes Tumorwachstum dar, welche die Bedeutsamkeit der psychosomatischen Medizin und der Psychoonkologie verdeutlichen sollen.
Innerhalb dessen wird erläutert, inwieweit physische und psychische Komponenten hinsichtlich der psychoendokrinologischen und psychoneuroimmunologischen Regulationen miteinander einhergehen und wie bzw. ob sich durch Stress verursachte Dysregulationen innerhalb dessen durch psychologische Interventionen während einer Krebserkrankung regulieren lassen können. Dabei wird anhand der Beispiele „Bewegung“ und „Mindfulness-Based-Stress-Reduction“ ein Entgegenwirken im psychoonkologischen Rahmen erläutert und mit verschiedenen Studien hinsichtlich Wirksamkeit, Validität und Objektivität abgeglichen. Handlungsempfehlungen werden anschließend abgeleitet.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Glossar
1. Ausgangslage
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Das Immunsystem
2.2 Das endokrine System
2.3 Stress
2.3.1 Stressoren und ihre Bedeutung für das Hormonsystem
2.3.2 Die Interaktion von Psyche, vegetativem Nervensystem, endokrinem
2.3.3 m und Immunsystem bei Stress
3. Psychoonkologie
3.1 Epidemiologische Daten der Krebserkrankung
3.2 Grundlagen der Psychoonkologie
3.3 Bedarf der Psychoonkologie
3.4 Die Rolle der psychosomatischen Medizin
4. Methodisches Vorgehen
5. Ergebnisse
5.1 Psychosozialer Disstress und Entzündungsprozesse bei Krebs
5.2 Onkologische Auswirkungen durch Immunologische Dysregulationen
5.3 Auswirkungen psychologischer Interventionen
5.3.1 Beispiel Bewegung
5.3.2 Beispiel Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR)
6. Schlussfolgerung
6.1 Fazit
6.2 Handlungsempfehlungen
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abb. 2.3 Auswirkungen von Stress
Abb. 3.1 Anzahl jährlicher Krebserkrankungen
Abb. 4 Prisma - Diagramm
Tabellenverzeichnis
Tab. 5.2 Extraktionstabelle 30
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Glossar
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
1. Ausgangslage
Krebserkrankungen stellen mit ca. 25 % die zweithäufigste Todesursache in Deutschland dar und die Gesamtüberlebensrate der Krebserkrankungen innerhalb der letzten Jahrzehnte hat sich erhöht (vgl. Schüle, 2012, S. 8 ff.). Jedoch begünstigten Verbesserungen in der Therapie und Diagnostik in den letzten Jahren die Zunahme der Überlebenszeiten bei Tumorerkrankungen, wodurch die Frage der Lebensqualität innerhalb dessen vermehrt gestellt wird (vgl. ebd.).
Dabei konnten somatisch-medizinische Behandlungen Fortschritte hinsichtlich der Heilungschancen bzw. Überlebenschancen betroffener Patienten erzielen (vgl. ebd.).
Dieser medizinische Fortschritt geht mit wachsenden Folgekosten bzgl. der Langzeitüberlebenden mit Krebsdiagnose einher. Darunter fallen auf der somatischen Ebene das Risiko für Rezidive, persistierende kardiopulmonale Schäden, Fatigue, chronische Schmerzen sowie körperliche Einschränkungen. Auf psychischer Ebene liegen dabei erhöhter emotionaler Distress, sexuelle Dysfunktionen, kognitive Beeinträchtigungen, berufliche Probleme sowie psychosoziale Behinderungsgrade (vgl. Kapfhammer, 2015, S. 255 ff.). Eine insgesamt verminderte Lebensqualität liegt vor. Innerhalb von Krebserkrankungen wird deutlich, dass psychische Komorbiditäten negative Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf haben (vgl. ebd.). Somit müssen im multifaktoriellen Modell medizinische Faktoren, soziodemographische Faktoren, Persönlichkeitsfaktoren sowie psychosoziale Faktoren als Stressoren und Einflussfaktoren aufeinander bezogen werden und neurobiologisch und pathophysiologisch reflektiert werden (vgl. ebd.). Insgesamt weisen Komorbidität, Progression der Krankheit und das Mortalitätsrisiko psychosomatische, somatopsychische und auch somatosomatische Wechselwirkungen auf (vgl. ebd.).
Der Forscher Hans Selye kam erstmalig zu der Entdeckung, dass durch das ausgesetzt sein des chronischen Stress vergrößerte Nebennieren, atrophische Thymusdrüsen und Tumore entstehen können. Dabei stellen eine mangelnde Kontrolle über Gegebenheiten sowie eine Ego-Bedrohung starke starke Reize als Stressfaktoren für die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA/HHNA) dar, wodurch die Widerstandsfähigkeit der neuroendokrinen Achsen chronischen Schaden nehmen kann. Das allostatische Belastungsmodell beschreibt dabei physiologische Auswirkungen durch chronischen Stress. „Allostatis“ meint dabei die dem Kontext angepassten Reaktionen des Körpers bei Stress. Die allostatische Belastung erklärt dabei die sich steigernden Abnutzungen der Reaktionen auf den Körper. Das allostatische Belastungsmodell beschreibt die Stressoren nicht als rein psychologische Faktoren, sondern als Faktoren, welche die Stressreaktionssysteme zu Fehlregulationen beeinflussen können, mit inbegriffen der Genetik, den Lebenserfahrungen und gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen wie z.B. rauchen. Wechselwirkungen zwischen endokrinem System und dem zentralen Nervensystem erklären den Fakt der beeinflussten Immunfunktionen durch wahrgenommene stressige Lebenserfahrungen (vgl. Novack et al., 2007, S. 388 ff.). Veränderungen des Verhaltens, welche das Immunsystem beeinflussen, stellen dabei einen weiteren Beleg für eine Verbindung zwischen Immunsystem und dem Gehirn dar. Diesem entgegenwirkend bieten sich psychoonkologische Interventionen innerhalb der Krebserkrankungen an, um die Immunabwehr über Verhaltensprozesse beeinflussen zu können (vgl. ebd.).
Diese Arbeit stellt die psychoendokrinologischen und psychoneuroimmunologischen Dysregulationen, verursacht durch Stress, als Auslöser für ein erhöhtes Tumorwachstum dar, welche die Bedeutsamkeit der psychosomatischen Medizin und der Psychoonkologie verdeutlichen sollen. Innerhalb der Thesis werden durch eine systematische Literaturanalyse folgende Fragen konkret beantwortet:
- Inwiefern kann langanhaltender Stress, welcher immunologische und endokrinologische Dysregulationen auslöst, das Tumorwachstum innerhalb von bestehenden Krebserkrankungen beeinflussen?
- Inwieweit weisen psychoonkologische Interventionen positive Effekte auf Stressreduktion innerhalb der Krebserkrankung auf, welche die Prognose verbessern können?
Innerhalb dessen wird erläutert, inwieweit physische und psychische Komponenten hinsichtlich der psychoendokrinologischen und psychoneuroimmunologischen Regulationen miteinander einhergehen und wie bzw. ob sich durch Stress verursachte Dysregulationen innerhalb dessen durch psychologische Interventionen während einer Krebserkrankung regulieren lassen können. Dabei wird anhand der Beispiele „Bewegung“ und „Mindfulness-Based-Stress-Reduction“ ein Entgegenwirken im psychoonkologischen Rahmen erläutert und mit verschiedenen Studien hinsichtlich Wirksamkeit, Validität und Objektivität abgeglichen. Handlungsempfehlungen werden anschließend abgeleitet.
2. TheoretischerHintergrund
2.1 Das Immunsystem
Die Kontrolle über die Erhaltung der Integrität eines Organismus, insbesondere die Wahrnehmung von chemischen oder physikalischen Schädigungen des Gewebes oder der Organe, der Befall pathogener Parasiten, Pilze, Viren, Bakterien und das Auftreten mutierter Genprodukte in Form einer Neoplasie, setzt das Fundament aller Lebensvorgänge (vgl. Ansorge; Jäger, 2022, S. 1180). Ein vielfältiges System von Immunzellen, welche über die Lymph- und Blutbahnen bewegt werden sowie humorale lösliche Faktoren (z.B. Hormone, Cytokine) aus Blut, Liquor oder Lymphe bewältigen diese Kontrollfunktionen. Die Thymusdrüse, Knochenmark und Lymphknoten, Milz, Tonsillen und die Schleimhäute, nehmen dabei eine zentrale Rolle ein (vgl. ebd.). Zellen, welche an einer Immunantwort beteiligt sind, stellen die antigenpräsentierenden Zellen, thymusgeprägte T-Lymphocyten (T-Zellen) und knochenmarkgeprägte B- Lymphocyten (B-Zellen) dar. Eine Immunantwort meint dabei alle Bereiche der Antwort eines Immunsystems auf zelluläre Veränderungen oder Fremdstoffe. Die Kommunikation verläuft hierbei über Zell-Zell-Kontakte und über Cytokine. Dabei erreichen alle Immunzellen über Lymph - und Blutgefäße den Ort von Entzündungen oder Verletzungen. Diese Wege der Immunzellen werden durch Prostaglandine und Prostacycline - die Eicosanoide, Adhäsionsmoleküle, Chemokine und Komplementfaktoren gesteuert. Die Immunantwort, als auch die Reaktion der jeweiligen Produkte auf diese Immunantwort als Immunreaktion, stellen biochemische Vorgänge dar. Insgesamt werden zwei funktionelle, miteinander vernetzte Systeme dabei verwendet (vgl. ebd.). Diese weisen aktivierende und auch supprimierende Mechanismen auf. Das Vorkommen der Zellen, welche angeboren unspezifisch wirken, bestimmt als primäre Immunantwort die erste Phase der Erregerabwehr. Eine erworbene, adaptive antigenspezifische Immunantwort wird durch ein selektiv wirkendes System gesteuert, welches verzögert auf eine Infektion reagiert. Körpereigene Strukturen werden innerhalb der genannten Prozesse im Normalfall toleriert, ausschließlich fremdartige Substanzen erhalten eine Immunantwort (vgl.ebd.). Diese Unterscheidung zwischen körpereigenen Strukturen und fremdartigen übernehmen die T- und die B-Lymphocyten, indem für jede Struktur ein durch den Organismus, während einer antigenspezifischen, adaptiven Immunantwort, entwickelter Lymphocyten-Klon und ein Antikörper entwickelt werden. Währenddessen sind jeweils immunaktivierende, als auch immunsupprimierende Vorgänge, auf das fremde Antigen beteiligt. Ein gesunder Organismus hat diese Prozesse miteinander abgeglichen. Sobald dieses Gleichgewicht gestört ist, entstehen pathogene Zustande in Form einer intensivierten Immunantwort bei Autoimmunerkrankungen, Allergien, Unterfunktionen wie AIDS und auch bei Tumorerkrankungen (vgl. Ansorge; Jäger, 2022, S. 1180).
Das endokrine System kann gleichermaßen vom Immunsystem gesteuert werden, ähnlich dem Immunsystem, welches durch das endokrine System beeinflusst wird. Dabei können Immunprozesse eine Auswirkung auf das zentrale Nervensystem hinsichtlich afferenter Prozesse haben. Forschungen zu Folge wird erklärt, dass eine immunmodulatorische Wirkung von Cortisol ein bedeutsamer physiologischer Effekt des Cortisol ist. Des Weiteren ist erwiesen, dass Hormone innerhalb der Lymphozyten im peripheren Immunsystem produziert werden (vgl. Rupprecht; Müller, 2011, S. 264). Darunter ACTH, ß-Endorphine, TSH, Prolaktin sowie GH. Somit nimmt das Immunsystem auch Funktionen des endokrinen Systems wahr. Gemeinsame Aufgaben liegen in den Peptidsignalen des Immunsystems und des endokrinen Systems vor (vgl. ebd.).
2.2 Das endokrine System
Die Wirkung und Pathophysiologie der Hormone wird durch die Wissenschaftsdisziplin Endokrinologie beschrieben. Das Nervensystem und das Endokrine System sind miteinander verbunden, um gemeinsam die Funktionen voneinander entfernter Organe zu koordinieren. Das Nervensystem schickt elektrische Botschaften über die Nervenfasern zu den Organen, das endokrine System nutzt chemische Botenstoffe, die Hormone, für diesen Vorgang (vgl. Birbaumer, Schmidt, 1996, S. 64). Hormone stellen biochemische Botenstoffe dar, welche durch spezialisierte Hormondrüsen (glandulae) gebildet und sezerniert werden. Sie wirken nach dem Transport durch die Blutbahn regulierend auf die Zielorgane ein. Dabei bezeichnet man die klassischen Hormone als glanduläre Hormone. Die von Gewebszellen produzierten Hormone, welche nicht im Drüsengewebe organisiert sind, stellen die aglandulären Hormone dar und wirken oftmals lokal (auto- oder parakrin) (vgl. Heinrich et al., 2022, S. 527). Die Anpassung vom Organismus an veränderte Umweltparameter, wie Kälte oder der Sauerstoffpartialdruck sowie die Regulation des Stoffwechsels oder die Steuerung der Reproduktionsprozesse, stellen die hauptsächlichen Aufgaben der glandulären Hormone dar. Hormone gehören verschiedenen biochemischen Stoffklassen an. Diese leiten sich von Cholesterin (Steroide), Peptide, Aminosäuren oder Fettsäuren ab, wirken allerdings häufig über ähnliche Signalketten. Dabei liegen fließende Übergänge in den Abgrenzungen von Cytokinen und Neurotransmittern vor. Spezifische Rezeptoren, welche abhängig von chemischer Eigenschaft ihres Mediators intrazellulär oder an der Plasmamembran vorkommen, binden sich an Zielzellen, auf welche die Hormone einwirken. Dabei verläuft die, von den membranständigen Rezeptoren abhängige Signaltransduktion der Hormone, gleich den Prinzipien der Cytokine (vgl. Heinrich et al., 2022, S. 527).
Über frühere Fallbeschreibungen des 19. Jahrhunderts wurde bereits ein Zusammenhang zwischen Wachstumsstörungen und Hypophysendefekten (z.B. im Falle eines Tumors) vermutet (vgl. Ehlert, 2011, S. 4.). Dabei gab es allerdings keine Erklärungen über genaue Wirkmechanismen. Im 20. Jahrhundert vermehrten sich Annahmen hinsichtlich dessen, dass bioaktive Substanzen im Organismus vorliegen, basierend auf dem Prinzip von aus den Körperregionen entzogenen Extrakten, welche reinjiziert werden (vgl. Ehlert, 2011, S. 4.). 1936 verkündete Otto Loewi, ein Nobelpreisträger für Medizin, seine Annahme, dass Substanzen von Nervenendigungen bei Erregung freigesetzt werden, um einen Nervenimpuls auf Effektorgane zu übertragen. Durch einen späteren Versuch am Vagusnerv eines Froschherzens konnte er diese Annahme beweisen (vgl. ebd.). Dabei reizte er den Vagusnerv für kurze Zeit und entnahm Blut aus der Herzkammer des Frosches, woraufhin er das Blut anschließend mit dem Blut eines anderen Frosches tauschte. Das Herz des zweiten Frosches schlug daraufhin langsamer. Somit bewies Loewi die Übermittlung des Effektes der Vagusreizung, welche die Methode der chemisch synaptischen Übertragung durch Acetylcholin beschreibt (vgl. ebd.). Im Allgemeinen stellen Hormone chemische Signalstoffe dar, welche in Zellen hergestellt und über den Blutstrom in verschiedene Körperregionen gelangen, um dort ihren Effekt zu erzielen. Dabei sezernieren die endokrinen Drüsen die Hormone ohne Umwege in das Blut, ins Gewebe oder die Lymphe und entfalten ihre Wirkung durch Bindung an Rezeptoren. Dabei wird vorausgesetzt dass die Zielzelle einen entsprechenden Rezeptor als Anknüpfstelle für das entsprechende Hormon vorweisen kann. Im Falle dessen, dass ein Hormon als Neurotransmitter wirkt, wird die Substanz einer Neuronen-Synapse freigesetzt und kann andere Zellen beeinflussen (vgl. ebd.). Neuropeptide stellen funktionelle Zwischenformen von Hormonen und Neurotransmittern dar. Die Überleitung langsamer, aber dauerhaft anhaltender endokriner und parakriner Effekte, kennzeichnet die Wirkung der Neuropeptide, wobei ein hemmender und auch unterstützender Einfluss auf Neurotransmitter, ohne eigenständige Reaktion, ausgeübt wird (vgl. Ehlert, 2011, S. 5 ff.). Dabei bezeichnet man diese auch als Neuromodulatoren. Es lassen sich verschiedene Klassen der Botenstoffe je nach chemischer Struktur voneinander differenzieren: Peptidhormone oder Proteinhormone, Aminosäurenderivate, auch Steroidhormone und andere. Bestimmte Hormone werden im zentralen Nervensystem und auch, wie z.B. das Noradrenalin, in den endokrinen Drüsen des Körpers gebildet. So werden also verschiedene Arten von Hormonen innerhalb des zentralen Nervensystems oder des Körperinneren hergestellt. Dabei können manche ebenso als Neurotransmitter wirken und nicht ausschließlich als Hormon (vgl. ebd.).
Releasing-Hormone (Liberine)
Neuropeptide werden als Releasing-Hormone auch als „Liberine“ bezeichnet und bilden sich in Kerngebieten innerhalb des Hypothalamus. Die daraus hervorgehenden Neurone enden in der Eminentia mediana und werden durch Kontrolle weiterer Neurotransmitter und Hormone in die Blutbahnen des Portalsystems, welche sich bis zur Adenohypophyse erstrecken, freigegeben (vgl. Ehlert, 2011, S. 10). Dort wird die Sekretion verschiedener Tropine durch die Neuropeptide ausgelöst. Zu den jeweiligen Releasing-Hormonen gehören unterschiedlich große Peptide, welche sich aus Aminosäuren zusammensetzen. Dazu gehören die Peptide CRH, TRH, GnRH sowie GHRH. Eine Freisetzung von CRH erfolgt in Form eines zirkadianen Rhythmus, mit niedrigerer Freisetzung am Abend hingegen dem Morgen (vgl. ebd.). Katecholaminerge Stimulation und negative Rückkopplung durch gebildete Glukokortikoide beeinflussen die Sezernierung dessen. CRH wirkt u.a. für zentrale und periphere Prozesse wie die kardiovaskulären und inflammatorischen Vorgänge, die Hunger-Sättigung-Regulation und auch die Thermoregulation. Die Urokortine stehen im Zusammenhang mit CRH und bestehen ebenfalls aus Aminosäuren. Dabei weisen diese eine chemische Übereinstimmung mit CRH auf und können im Hypothalamus gebildet werden, jedoch an verschiedenen Stellen indessen sezerniert. Sie binden sich ebenso an CRH-Rezeptoren. Das CRH wird als sofortige Antwort auf Stress freigesetzt, das Urokortin bei Erholung des Stress (vgl. Ehlert, 2011, S. 11). TRH - Thyreoliberin regelt den Schilddrüsenkreislauf durch Genexpression des TSH. Dabei stimuliert es die Transkription und Sekretion von Prolaktin und zudem an weiteren Orten in Gehirn und Rückenmark. Dabei beeinflusst es in Form eines Neurotransmitters die Schmerz-, die Thermo- sowie die Schlaf-wach-Regulation und Nahrungs- u. Flüssigkeitsaufnahme (vgl. ebd.). Indirekte Effekte des TRH beeinflussen die Magen-Darm-Peristaltik durch Vagusstimulation, die Insulinsekretion, die Herzfrequenz und durch sympathische Beeinflussung den Blutdruck (vgl. ebd.). GnRH stellt ein Dekapeptid dar, welches in 30- 120-minütigen Abständen im Gehirn freigesetzt wird und dort als Releasinghormon wirkt. Es beeinflusst die Sezernierung des Schwangerschaftshormons hCG. Innerhalb der letzten Jahre konnte ein nahezu ursprünglich ähnliches GnRH-II-Peptid nachgewiesen werden, womit beide Peptide wiederherstellende Funktionen vorweisen können (vgl. ebd.). Die Freisetzung der bereits genannten Gonadotropine stellt die Hauptaufgabe des GnRH dar. Das GnRH-II beeinflusst das Sexualverhalten. Beide GnRH beeinflussen außerdem die Entwicklung sowie den Verlauf von Tumoren reproduktionsbezogener Organe. GHRH (Somatoliberin) stimuliert Freisetzung und Bildung von Somatotropin im Hypophysenvorderlappen und beeinflusst das Schlafverhalten (vgl. ebd.). Als Neurotransmitter ist GHRH auch nebst verschiedener Hirnregionen im Gastrointestinaltrakt lokalisiert. Bestimmte Tumore, u.a. das Pankreaskarzinom weisen das GHRH vor und setzen dieses frei (vgl. ebd.).
Release-inhibiting-Hormone
Des Weiteren, zu den o.g. Liberinen werden hypothalamisch-hypophysäre Hormonvorgänge durch verschiedene Release-inhibiting-Hormone beeinflusst (vgl. Ehlert, 2011, S. 11). Dabei werden die Inhibiting-Hormone Somatostatin (SST), Prolaktin-inhibiting-Faktor (OIF) sowie das Melanotropin-release-inhibitin-Hormon (MRIH) hinsichtlich ihrer Funktion diskutiert. Das im Hypothalamus gebildete SST stellt den Gegenpart des Somatoliberins dar, welcher die Freisetzung des GHRH aus der Eminentia mediana abblockt und aus diesem Grund als „Somatotrophin release inhibitory factor“ bezeichnet wird (ebd.). SST bildet sich im Pankreas - mit parakriner Funktion, im Magen sowie im Dünndarm. Prolaktin (PRL) setzt sich innerhalb der Hypophyse frei und steht ebenso unter Kontrolle des Prolaktin-releasing-Hormons (PRH) sowie unter dieser des Prolatkin-inhibiting-Faktors (PIF) (vgl. ebd.). PRH nimmt a I s Neurotransmitter Einfluss auf die Schmerzverarbeitung, autonome Funktionen sowie den Energiestoffwechsel. Vermutet wird eine Aktivität als Kotransmitter oder Modulator in noradrenalinenthaltenen Neuronen mit Einflussnahme auf den Nucleus paraventricularis (vgl. Ehlert, 2011, S. 12). Zudem konnte tierexperimentell die PRL- Freisetzung durch die Oxytozin - Blockade vermindert werden, weshalb diskutiert wird, inwiefern es sich bei PRH um Oxytozin handelt (vgl. ebd.).
Der Prolatktin-inhibiting-Faktor (PIF) stellt ein biogenes Amin, das Dopamin dar, welches durch Neuronenverbände sezerniertwird .
Das Melanostatin (MRIH) stellt ein Neuropeptid, bestehend aus Aminosäuren, dar, welches im Hypothalamus lokalisiert ist und eine Freisetzung von MSH (Melanotropin) aus der Hypophyse blockiert. Verschiedene Peptide werden im Hypothalamus freigesetzt, welche für den Prozess der Nahrungsaufnahmeregulation und des entstehenden Hungergefühls verantwortlich sind oder auch im Gastrointestinaltrakt ihren Wirkungsort vorweisen (vgl. Ehlert, 2011, S. 12). Diese Peptide sind insgesamt alle in den verschiedensten Hirnregionen vorzuweisen, in welchen durch Modulation noradrenerger, azetylcholinerger und serotonerger Vorgänge, hemmende Einflüsse auf die kognitiven Funktionen genommen werden, welche u.a. eine Rolle bei verschiedenen zerebralen Pathologien spielen können (vgl. ebd.). Die Neurone des Dopamins - das dopaminerge System, befinden sich hauptsächlich im Mittelhirn, wovon dopaminerge Bahnen in das nigrostriatale System, von der Substantia nigra ausgehend, zu den Basalganglien und vom mesolimbischen in das limbischen System in den Frontallappen des Kortex über das mesokortikale System und weiter in den Nucleus arcuatus anschließend zur Adenohypophyse laufen. Das Dopamin steuert Bewegungsabläufe - ein Mangel begünstigt Morbus Parkinson sowie durch Projektionen vom mesolimbischen Dopaminsystem, eine Entwicklung von möglichem Suchtverhalten oder auch von Psychosen (vgl. ebd.).
Hydroxytryptamin, auch als Serototin bekannt, wird innerhalb des zentralen Nervensystems sowie in der Körperperipherie gebildet. Serotonin beeinflusst verschiedene körperliche Vorgänge. Eine besondere Bedeutung bekommt das Serotonin innerhalb einer psychischen Fehlanpassung, z.B. der Depression. Des Weiteren umfasst das Wirkungsspektrum des Serotonins, durch verschiedene Subtypen mit prä- und auch postsynapsischen Rezeptoren im ZNS, die Thermoregulation, die zentrale Blutdruckregulation, depressive Stimmungsbilder sowie Lernvorgänge (vgl. Ehlert, 2011, S. 12 f.).
Die Vorkommen der Hormone lassen sich innerhalb verschiedenster Körperregionen unterscheiden. So auch innerhalb ihrer Kommunikationsformen. Darunter lassen sich vier Kommunikationsformen der Hormone voneinander differenzieren (vgl. Ehlert, 2011, S. 22).
Die synaptische Kommunikation besteht, indem am Synapsenkopf eines Axons Neurotransmitter freigesetzt werden, wodurch diese sich im synaptischen Spalt verstreuen und die Änderung der Polarisation postsynaptischer Membran bewirken. Dabei wird der Übertragungsprozess an chemischen Synapsen in vier Schritte, darunter zwei präsynaptische und zwei postsynaptische, unterteilt (vgl. Ehlert, 2011, S. 2 3). Diese stellen eine Verbindung der Aktionssubstanz der Transmitter, die Freisetzung sowie die Speicherung des Neurotransmitters und die Wechselwirkung dieses Transmitters mit Rezeptor, innerhalb der postsynaptischen Membran, dar sowie die Entfernung aus dem synaptischen Spalt (vgl. ebd.). Ein Neurotransmitter stellt eine Substanz dar, welche durch die Synapse von einem Neuron abgesondert wird, um andere Zellen zu beeinflussen. Um einen Effekt an einem einem Effektorgan oder einem postsynaptischen Neuron zu erzielen, muss die Substanz in Neuronen verändert werden sowie in der präsynaptischen Endigung vorliegen und kann in ausreichender Menge freigegeben werden. Im Falle einer von außen injizierten Verabreichung imitiert die Substanz die vom endogen freigesetzten Transmitter hergehende Wirkung und ein Mechanismus erfolgt, welcher die Substanz vom Wirkungsort entfernt (vgl. ebd.). Sobald eine Zelle ein Hormon freisetzt und dieses in den extrazellulären Raum eindringt, dort Zielzellen beeinflusst und anschließende Rückmeldung an die eigene Zelle gibt, spricht man von der autokrinen Kommunikation (vgl. ebd.). Die Erzeugerstelle des Hormons empfängt dieses wieder und nimmt daraufhin Einfluss auf die Zelle in Form einer Rückkopplung. Von einer parakrinen Kommunikation wird gesprochen, sofern ein Hormon im extrazellulären Raum freigegeben wird und seine Nachbarzellen beeinflusst (vgl. ebd.). An Stellen innerhalb der Zellen im Körper, wo entsprechende Rezeptoren vorhanden sind, werden Reaktionen durch von endokrinen Drüsen in die Blutbahn freigesetzte Hormone, ausgelöst. Dies stellt die endokrine Kommunikation dar (vgl. ebd.).
Innerhalb der Kommunikation der Hormone wird vorausgesetzt, dass durch synaptische Transmission endokrine Zellen stimuliert werden, um Hormone freizusetzen, welche innerhalb des Blutkreislaufes zur Aktivierung der Zielzellen freigegeben werden sollen. Das Grundprinzip endokriner Geschehnisse stellt u.a. die Homöostase dar. Diese bezeichnet den Zustand, dass der Organismus dafür sorgt, seinen Ausgangszustand nach Hormonfreisetzung zurückzugewinnen, um ein physiologisches Gleichgewicht wiederherzustellen (vgl. Ehlert, 2011, S. 24). Von enormer Wichtigkeit für diese Arbeit ist u.a. das Prinzip der hormonellen Regulation. Eines dessen stellt dabei die pulsatile Freisetzung der Hormone dar, welche einer zirkadianen Rhythmik unterliegt. Diese wird von zentralen Einflüssen gelenkt, welche durch den Tag-Nacht-Rhythmus oder der Lichtexposition beeinflusst werden. Innerhalb der Psychoendokrinologie spielen vor allem die wechselseitig (von Gehirn und Körperperipherie) kommunizierten auto- und parakrinen Rückmeldungsprozesse eine große Rolle (vgl. Ehlert, 2011, S. 24).
Eine biologische Antwort auf eine Hormonfreisetzung erfolgt durch hypothalamisch gesteuerte Hormonachsen, welche durch Freisetzung eines ersten Hormons, die Freisetzung weiterer Hormone auf verschiedenen Hirn-(Hypophysen) oder Körperebenen i.F.v. Hormondrüsen anregen (vgl. Ehlert, 2011, S. 24).
Durch diesen Mechanismus wird der Körper weiter aktiviert, woraus eine Überbeanspruchung und ein physiologischer Schaden entstehen könnte. Um dieses zu verhindern wird innerhalb des beschriebenen Vorganges ein Teil der Hormone, welche freigesetzt wurden oder ggf. die biologische Antwort, für ein negatives Feedback genutzt. Dies bewirkt eine Hemmung weiterer Freisetzung der Hormone durch Besetzung der entsprechenden Rezeptoren. Dieses Prinzip wird als FeedforwardFeedback-Prinzip bezeichnet (vgl. ebd.). Die Psychoendokrinologie untersuchte bisher zwei Hormonachsen, welche diesem Prinzip besonders unterliegen (vgl. ebd.). Diese stellen die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse sowie die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse dar, welche zunächst erläutert werden.
Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenrinden-Achse
Hormone der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHNA) stellen empfindliche Substanzen psychischer und physischer Belastungen dar, welche individuell jeweils innerhalb auftretender Stressoren durch physische und psychische Strategien versuchen, diesen Stress nach der Homöostase selbstregulierend zu verarbeiten (vgl. Ehlert, 2011, S. 25). Die Fähigkeit, nach erfolgreicher Stressbewältigung den gesunden Ausgangszustand zurückzugewinnen, stellt diese Selbstregulation dar. Dies erfolgt über die Hormonfreisetzung der HHNA. Dabei wird CRH durch Impulse des limbischen Systems und durch Zytokine stimuliert und übernimmt als neuroendokriner Botenstoff im zentralen Nervensystem Aufgaben hinsichtlich der Organismusanpassung an die psychischen und physischen Belastungen (vgl. ebd.). Weitere Aufgaben des CRH wurden bereits zuvor beschrieben. Eine wichtige Aufgabe hinsichtlich der HHNA - Aktivität stellt auf hypophysärer und auch auf hypothalamischer Ebene, die Besetzung der Kortikosteroidrezeptoren und die Hemmung der Zytokinfreisetzung, zur Regulation negativer Feedbackmechanismen dar (vgl. ebd.).
Dabei besteht die Besetzung aus zwei Rezeptoren - den Glukokortikoidrezeptoren (GR) und den Mineralokortikoidrezeptoren (MR). Deren Besetzung bewirkt verschiedene Effekte hinsichtlich der Homöostase (vgl. Ehlert, 2011, S. 26). Eine GR- Aktivierung der Energiestoffwechsel - Kontrolle, der Gedächtnisprozess-Modulation und unterstützt die Verhaltensanpassung an den Stress. Die MR-Aktivierung erfolgt, um Zellprozesse homöostatisch bzgl. einer Stressreaktion hervorzurufen und einen darauf bezogenen Verhaltensauswahlvorgang zu unterstützen (vgl. ebd.). Insgesamt weisen die HHNA Hormone unterschiedliche psychologische und physiologische Konsequenzen auf, welche als vorbereitende, suppressive sowie stimulierende Effekte beschrieben werden können (vgl. ebd.). Dabei wirkt CRH koordinierend auf emotionale, behaviorale und autonome Adaptionsprozesse an Stress, indem währenddessen vor allem Aktivierungsvorgänge eingeleitet werden (vgl. ebd.). Wie bereits zuvor erläutert erfolgt eine Stimulation des ACTH nicht ausschließlich über CRH, sondern ebenso durch Serotonin, Acetylcholin und NA, wogegen das Dopamin, GABA und endogene Opiate einen hemmenden Einfluss haben. Aktiviert an den Melanokortinrezeptoren der NNR wird das ACTH, wodurch die Freisetzung von Gluko- und Mineralokortikoiden und Androgenen erfolgt (vgl. ebd.).
Hypothalamus-Hypophysen- Gonaden-Achse
Wie auch die HHNA ist die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse (HHGA) ein Feedforward-Mechanismus, welcher vom Gehirn zu den Gonaden verläuft und in welchem die Gonadenhormone dem Hypothalamus und der Hypophyse ein negatives Feedback geben (vgl. Ehlert, 2011, S. 26). Hierbei liegen geschlechtsspezifische Unterschiede vor. Indem die HHGA bei Männern vorwiegend beständige hormonelle Sekretionsmuster vorweist, unterscheiden sich solche im Rückmeldesystem der Frauen im gebärfähigen Alterje nach Zyklus erheblich (vgl. ebd.).
Neurotransmitter, welche die HHGA beeinflussen, stellen die endogenen Opiate (ß- Endorphin, Dynorphin, Engephaline), die Substanz P, ERH und das Dopamin dar. Diese haben allesamt einen hemmenden Einfluss. Einen stimulierenden Einfluss üben GABA, Serotonin, Neurotensin, NPY, NA und Galanin auf die HHGA aus (vgl. Ehlert, 2011, S. 29 f). PRL wird pulsatil abgesondert und nimmt dabei Einfluss, innerhalb der zweiten Hälfte des Zyklus, auf das Corpus luteum, wodurch Progesteron und Östrogen beeinflusst werden. Experimenten zu Folge nimmt Kisspeptin-54 einen weiteren stimulierenden Einfluss auf eine GnRH-Freisetzung (vgl. Ehlert, 2011, S. 30) GnRh regt die Produktion des FSH, einem Follikelstimulierenden Hormons, an sowie die des Luteinisierenden Hormons LH. Diese beiden werden als Gonadotropine zusammengefasst, durch ihr Einwirken auf die Keimdrüsen und die Gonaden. Sie sind für die Freisetzung weiterer Hormone zuständig (vgl. Erdmann et al., 2005, S. 90). Dabei wird eine durch Melatonin stimulierte hypothalamische Weiterleitung des Kisspeptin-54 innerhalb des Nucleus arcuatus durch negatives Feedback des Testosterons und des Östrogens verlangsamt (vgl. Ehlert, 2011, S. 30). Stimuliert wird diese dagegen im Nucleus periventricularis anteroventralis. Einen stimulierenden Einfluss hat auch weiterhin das Leptin im Nucleus arcuatus auf die Sekretion des Kisspeptin-54 (vgl. ebd.). Hierdurch könnten sich beispielsweise Zyklusstörungen bei starkem Untergewicht erklären. Pheromone stellen ebenfalls einen Mediator der HHGA dar. Diese werden in den apokrinen Drüsen hergestellt und durch das olfaktorische Epithelium oder das vomeronasale Organ aufgenommen. Forschungen zu Folge konnte bewiesen werden, dass Pheromone in Achselschweiß eine pulsatile Sekretion des LH beeinflussen (vgl. ebd.). Insgesamt handelt es sich bei endokrinen Feedforward- und Feedback-Regelkreisläufen um sehr komplexe Systeme, deren Vernetzung und Wirkung von vielen endokrinen Faktoren abhängig ist. Weitere Erkenntnisse über immunologische und zentralnervöse Einflüsse werden dabei stetig erforscht (vgl. ebd.).
2.3 Stress
Stress zeigt sich unmittelbar nach Reizsituationen mittels verschiedenster Reaktionen des Körpers. Die Reize werden dabei Stressoren genannt. Stress hat nicht ausschließlich eine negative Bedeutung, sondern dient als Anpassungsmechanismus, welcher sich an emotionale und auch körperliche Belastungen oder Krankheiten anpassen soll. Die körperlichen Reaktionen dienen dem Ausweichen dessen (vgl. Erdmann et al., 2005, S. 124). Insgesamt impliziert das Wort „Stress“ eine Kausalität von wechselseitig beeinflussenden persönlichen Vorraussetzungen und Umweltbedingungen (vgl. Ehlert, 2011, S. 33). Demnach werden Situationen von Personen analysiert und individuelle Bewältigungsstrategien oder inwiefern es sich um eine Bedrohung handelt, werden abgeschätzt (vgl. ebd.). Gedanken, Einstellungen oder Erwartungen resultieren als Kognitionen daraufhin, wodurch Emotionen und physiologische Vorgänge aktiviert werden und ein subjektiv darauf angepasstes Verhalten ausgeführt wird (vgl. ebd.). Nach entsprechenden Konsequenzen des verwendeten Verhaltens erfolgt eine Neubewertung der Situation. Fehlanpassungen erfolgen dabei, sofern der Mensch gehäuft Situationen durchlebt, welche eine für ihn hohe persönliche Bedrohung mit einhergehenden Mängeln seiner Bewältigungsstrategien darstellen (vgl. ebd.). Dabei können sich manifeste Erkrankungen oder Störungen entwickeln (vgl. ebd.). Psychobiologische Fehlanpassungen können durch hilfreiche Möglichkeiten wie z.B. der sozialen Unterstützung oder einem hohen Kohärenzsinn innerhalb psychischer Belastungssituationen, zu einer Stressreduktion beitragen (vgl. ebd.). Eine Aktivierung endokriner Systeme erfolgt durch intensivierte Stressoren, welche insbesondere durch subjektiv als unvorhersagbar oder unkontrollierbar erlebte Situationen, ausgelöst werden (vgl. ebd.).
Die typischen Affekte, welche durch Stress ausgelöst werden, sind Angst und Aggression (vgl. Schröder et al., 2022, S. 173 f.). Durch akuten Stress können Aktivitäten innerhalb des Präfrontalkortex vermindert werden, womit dessen Funktionen beeinträchtigt werden (vgl. ebd.). Dazu gehören u.a. exekutive Funktionen, der Abruf von Informationen aus dem episodischen Gedächtnis sowie das Arbeitsgedächtnis (vgl. ebd.). Negative emotionale Befindlichkeiten wie Hoffnungslosigkeit oder Ängste können sich als langfristige psychische Folge durch enormen oder lang anhaltenden Stress einstellen (vgl. ebd.). Psychologen entwickelten die „Theorie dererlernten Hilflosigkeit“ (vgl. ebd.).
Diese erläutert den Zusammenhang dessen, eine dauerhafte Konfrontation mit unausweichlichem Stress zu erfahren, wodurch sich die Unfähigkeit, sich diesem Stress zu entziehen, auf ähnliche Situationen übertragen wird, welche zuvor bewältigbar waren (vgl. Schröder et al., 2022, S. 173 f.) Diese erlernte Hilflosigkeit kann eine Bewältigung von Stress verhindern.
Experimenten zu Folge gehen die Forscher davon aus, dass passives Verhalten nicht von einem aktiven Lernen abhängig ist, sondern das die Passivität und eine Ängstlichkeit in Bezug auf Stressoren standardmäßige Reaktionen sind, nachdem man über längere Zeiträume vermehrt negativen Erlebnissen ausgesetzt war (vgl. ebd).
Die Kontrollierbarkeit durch eigenes Handeln ist darauf bezogen eine Erfahrung, welche aktiv erlernt werden kann, um dieses zu überwinden. Die erlernte Kontrollierbarkeit steht in keinem Zusammenhang zur HHN-Achsenaktivierung, sondern wird durch die Funktion eines evolutionär später entwickelten Netzwerks hergeleitet (vgl. ebd.).
Abb.2.3 Auswirkungen von Stress
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
(eigene Darstellung in Anlehnung an Braus, 2004, S. 58)
2.3.1 Stressoren und ihre Bedeutung für das Hormonsystem
Insgesamt werden verschiedene Stressoren voneinanderunterschieden. Dabei können diese innerhalb ihrer Bedeutsamkeit je nach Belastungsgrad oder Dauer der Belastung definiert werden. Dabei wird unterschieden zwischen lang anhaltenden Stressbedingungen, wie z.B. die Pflege eines Angehörigen und kurzfristig natürlichen Stressoren, welche unterteilt werden nach ihrer Belastungsintensität, z.B. Traumata, einem Verkehrsunfall oder das Nichtbestehen einer Prüfung (vgl. Ehlert, 2011, S. 34). Psychosoziale Stresstests lassen sich in Abhängigkeit zu den stimulierenden Hormonen einsetzen, wodurch physiologische Stresseffekte erforscht werden können (vgl. ebd.). Diese entstehen oftmals aufgrund körperlicher Belastungen, z.B. Untergewicht, sportlicher Aktivität (vgl. ebd.). Die Einnahme pharmakologischer Stressoren löst ebenso endokrine Stressreaktionen aus, welche allerdings weniger mit einer psychischen Stressreaktion einhergehen (vgl. ebd.). Fakt ist, dass die Stressoren zu einer homöostatischen Veränderung der Regulation unterschiedlicher Hormonachsen, vor Allem die der HHNA, führen (vgl. ebd.). Je nach Dauer des Stressors oder seiner Bedeutsamkeit kann es somit zu hormonellen Dysregulationen kommen (ebd.). Sobald ein Mensch vermehrt chronischem Stress ausgesetzt ist führt dies zu einer Aktivierung der HHNA, welche dauerhaft bestehen bleibt. Dabei werden vermehrt CRH sowie Cortisol ausgeschüttet und eine geringere Feedbacksensitivität der Signale des Cortisol besteht. Diesen Prozess nennt man hyperaktive HHNA (vgl. Fries; Kirschbaum, 2009, S. 115). Wohingegen manche Menschen mit einer Hypoaktivität der HHNA reagieren bei chronischem Stress (vgl. ebd.).
Dabei werden die Hormone verminderter freigesetzt und Feedbacksignale durch Cortisol sind erhöht (vgl. Fries; Kirschbaum, 2009, S.116). Dies erfolgt z.B. durch zu hohe oder zu niedrige basale Hormonsekretion, veränderte Feedbacksysteme der peripheren Hormone an Hypothalamus und Hypophyse oder eine veränderte Regulation der Hormonrezeptoren (vgl. Ehlert, 2011, S. 34). Solche werden als endokrine Abweichungen bezeichnet, welche sich als Burnout, funktionelle somatische Beschweren oder psychiatrische Erkrankungen bemerkbar machen können (vgl. Ehlert, 2011, S. 34).
2.3.2 Die Interaktion von Psyche, vegetativem Nervensystem, endokrinem System und Immunsystem bei Stress
Hans Selye, ein bekannter Stressforscher beschrieb Stress als eine Abweichung von vegetativen Normalzuständen. Dem zu Folge lösen Stressoren ein Ungleichgewicht im Organismus zugunsten des sympathischen Systems aus, welche innerhalb von Erholungsphasen ohne Stressorenvorkommen wieder in ihren ursprünglichen vegetativen Normalzustand gelangen. Sobald Stressoren überhäuft, lange andauernd und in besonderer Intensität vorkommen, kann dieses Gleichgewicht zwischen parasympathischem und sympathischen Nervensystem nicht wiederhergestellt werden. Durch die bereits genannten Unterschiede hinsichtlich der Stressoren ist bekannt, dass der Mensch unterschiedlich auf diese Stressoren reagieren kann (vgl. Schröder et al., 2022, S. 169 f.). Ein extremer Gefühlszustand, eine Notfallreaktion, wurde als „emergency state“ erstmals durch den Physiologen Cannon (1932) in Verbindung mit körperlichen Veränderungen gebracht. Während dieser Extrembelastung des Organismus wird das sympathische Nervensystem erregt, während das parasympathische Nervensystem zeitgleich gehemmt wird. Dadurch wird Adrenalin ausgeschüttet, die Herzfrequenz erhöht sich und eine Verbesserung der Zuckerfreisetzung im Körper sowie der Sauerstoffversorgung erfolgen. Dies geschieht, sodass der Körper mit einer Kampf- oder Fluchtreaktion auf die Bedrohung reagieren kann (vgl. Schüßler; Brunnauer, 2011, S. 296). Die Ausschüttung von Cortisol und weiteren Glucocorticoiden wird beeinflusst durch die Aktivierung der HHNA, über welche das langsame Stresssystem läuft. Circa 15-20 min. nach Stressorauftreten wird die maximale Cortisolausschüttung erreicht, wobei über den Hypothalamus, die Hypophyse und die Nebennierenrinde Stoffe freigesetzt werden (vgl. Schröder et al., 2022, S. 170).
Bereits beschrieben wurde die Sezernierung des Corticotropin-Releasing-Hormons (CRH) des Hypothalamus, welches die Ausschüttung der Glucocorticoide der Nebennierenrinde begünstigt. Diese haben Effekte auf das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem, den Stoffwechsel und das Immunsystem (vgl. Schröder et al., 2022, S. 170). Durch das CRH wird der Hypophysenvorderlappen angeregt, Adrenocorticotropin auszuschütten (ACTH), welches zur Freisetzung der Glucocorticoide führt (vgl. Erdmann et al., 2005, S. 124). Durch die Umwandlung der Aminosäuren in Glukose steigt die Blutzuckerkonzentration und die körperliche und geistige Leistungsbereitschaft nimmt zu. Diese begünstigen cerebral Affekte wie z.B. Angst und beeinflussen damit Lern- und Gedächtnisprozesse. Hierdurch können u.a. chronische Angsterkrankungen und Depressionen bei längerer und übermäßiger Ausschüttung entstehen (vgl. Schröder et al., 2022, S. 170). Im Hippocampus können Neuronen durch einen dauerhaft erhöhten Glucocorticoidspiegel zerstört werden. Die Herzrate und der Blutdruck erhöhen sich durch Glucocorticoide, im Magen verändert sich die Resistenz der Schleimhaut gegen die Magensäure (vgl. ebd.). Komplexe Mechanismen steuern die Glucocorticoide, sodass diese entzündungshemmend auf das Immunsystem wirken können. Dabei werden Immunreaktionen unterdrückt, eine immunsupprimierende Wirkung tritt ein. Aktuellen Forschungen zu Folge können Glucocorticoide allerdings auch eine aktivierende Wirkung auf das Immunsystem vorweisen (vgl. Schröder et al., 2022, S. 172). Durch diese vielen verschiedenen Wirkungsmöglichkeiten der Glucocorticoide wird deutlich, inwiefern chronischer Stress zur Entstehung von Bluthochdruck, Magenproblemen, Herzerkrankungen und Immunsuppression führen kann. Da u.a. die Ausschüttung von Cortisol im Rahmen eines negativen Feedback-Mechanismus durch eine gehemmte Freisetzung von CRH und ACTH in Hypothalamus bzw. Hypophyse selbstständig reguliert wird, kann einem Entgleisen einer HHN-Achsenaktivierung bei anhaltendem Stress vorgebeugt werden (vgl. ebd.). Einem Stressor ausgesetzt zu sein, aber auch schon die Antizipation dessen, aktiviert beide Stresssysteme (vgl. ebd.). Bereits beschrieben wurde die Abhängigkeit der Homöostase, welche durch Tag-Nacht-Rhythmen beeinflusst wird. Demnach wird Cortisol nach zirkadianen Mustern in höheren Konzentrationen beim aufwachen ausgeschüttet und verringert sich während des Schlafes. Die biopsychologische Forschung nutzt Cortisol als Marker für eine stressbedingte HHN- Achsenaktivierung (vgl. Schröder et al., 2022, S. 173). Diese kann u.a. über Speichelproben ermittelt werden (vgl. ebd.). Das Enzym alpha-amylase wird in den Speicheldrüsen produziert und reagiert empfindlich auf sozialen Stress. Vor diesem Hintergrund ist die Messung einer Konzentration von alpha-amylase zur Aktivitätsbestimmung des sympathischen Stresssystems eine Variante (vgl. ebd.).
3. Psychoonkologie
Die Onkologie befasst sich als Fachgebiet der Medizin mit dem medizinischen Aspekten der Krebserkrankungen. Fast jede zweite Frau und jeder zweite Mann müssen im Laufe ihres Lebens mit einer Krebserkrankung rechnen (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.142). Die Psychoonkologie befasst sich als Subdisziplin der
Onkologie mit den emotionalen Reaktionen der Patienten und ihrer Angehörigen auf die Krebserkrankung. Dabei werden psychologische, verhaltensbezogene und soziale Faktoren in den Erkrankungs- und Behandlungskontext eingebunden. Die Psychoonkologie ist ein Feld, in welchem Forschung, Fortbildung und die Praxis eng miteinander einhergehen (vgl. Kusch et al., 2013, V). Die globale Zunahme an neuen Fällen und vor Allem Todesfällen durch Krebserkrankungen fordert interdisziplinäre Ansätze, welche psychoonkologische und psychiatrische Versorgungen innerhalb der Onkologie ermöglichen (vgl. Grassi, 2020). Nachgewiesen werden konnte bereits, dass etwa 50 % aller Krebspatienten im Verlauf ihrer Krebserkrankung klinisch bedeutsame emotionale Belastungen bis hin zu psychiatrischen Störungen als Folge der Krebserkrankung aufweisen (vgl. ebd.). In folge dessen sollte eine hochwertige onkologische Behandlung die psychosoziale Komponente in die Behandlung integrieren und dabei den Stress als zusätzliches Vitalzeichen nebst Blutdruck, Puls, Schmerz oderTemperatur messen (vgl. Grassi, 2020).
3.1 Epidemiologische Daten
Vor Jahren beruhten die epidemiologischen Angaben zu Verlauf und Inzidenz der Krebserkrankungen noch auf Schätzwerten und Hochrechnungen, welche sich aus Krebsregistern ergaben. 2009 wurde ein Krebsregisterdatengesetz verabschiedet und die Daten wurden in einem neu gegründeten Landesregister am Robert Koch Institut gesammelt (vgl. Schüle, 2012, S. 8). Die Inzidenzen beruhen weiterhin auf den damaligen Schätzungen und Hochrechnungen. Durch standesamtliche Sterberegister sind dagegen Angaben zur Mortalität am belastbarsten. Auch die Mortalitätsursachen können keine hohe Sicherheit vorweisen, durch wenig durchgeführte Obduktionsvorkommen (vgl. Schüle, 2012, S. 8 f).
Die Neuerkrankungsrate von Krebserkrankungen für 2010 schätzte das RKI auf 460.000 Fälle, wovon 246.000 Männer und 204.000 Frauen betroffen sind (vgl. Schüle, 2012, S. 8 f). Die Mortalitätsraten stehen mit 216.128, davon 116.700 Männer und 99.417 Frauen, diesem gegenüber (vgl. ebd.). Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Krebserkrankungen mit ca. 25 % die zweithäufigste Todesursache in Deutschland (vgl. ebd.). Männer sind bei der Inzidenz und auch bei der Mortalität häufiger davon betroffen (vgl. ebd.). Insgesamt liegt das durchschnittliche Sterbealter an Krebs für beide Geschlechter fünf Jahre unter der durchschnittlichen Lebenserwartung (vgl. ebd.). Die 5-Jahre-Prävalenz in Deutschland, welche die Anzahl der Neuerkrankten innerhalb der letzten fünf Jahre angibt, beträgt für 2006 1,4 Millionen Einwohner, die 10-Jahre-Prävalenz 2,1 Millionen Einwohner (vgl. Schüle, 2012, S. 9). Eine Steigerung um 90 % der Männer mit Krebserkrankung und 40 % der Frauen mit Krebserkrankung seit 1990, bedeuten diese Werte (vgl Schüle, 2012, S. 10).
Insgesamt hat sich die Gesamtüberlebensrate der Krebserkrankungen innerhalb der letzten Jahrzehnte erhöht (vgl Schüle, 2012, S. 10). Dennoch bleiben Verbesserungen hinsichtlich der Behandlungen eine Herausforderung (vgl. ebd.). Überlebensaussichten der Krebserkrankungen hängen von Lokalisation, Genetik, Therapie, Alter, Geschlecht und Tumorstadium usw. ab. Eine verbesserte Therapie und Diagnostik begünstigte innerhalb der letzten Jahre eine Zunahme der Überlebenszeiten bei Tumorerkrankungen, wodurch die Frage der Lebensqualität innerhalb dessen vermehrt gestellt wird (vgl. ebd.). Nach einer gestellten Krebsdiagnose leben nach fünf Jahren noch ca. 50% aller Patienten, je nach Krebsart (vgl. ebd.). Derzeit überleben ca. 70 % der Brustkrebspatientinnen nach diesen fünf Jahren, wogegen nur 15 % der Lungenkrebspatienten diesen Zeitraum überleben (vgl. ebd.).
Abb. 3.1 Anzahl jährlicher Krebserkrankungen in Deutschland, Stand 2019
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
(eigene Darstellung in Anlehnung an statista.com)
3.2 Grundlagen der Psychoonkologie
Krebs entsteht, sobald das Zellwachstum außer Kontrolle gerät. Hingegen normalen Zellen entwickeln sich Krebszellen entgegen ihrer zu empfangenen Signale der Nachbarzellen und des Körpers. Dabei vermehren sich die Krebszellen unkontrolliert, wodurch sich eine Geschwulst bildet - ein bösartiger Tumor (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.143). Krebs umfasst maligne (bösartige) Neubildungen/Neoplasien, welche unterschiedlichste Zellen, Strukturen und Organe des Körpers befallen können. Abhängig von der Körperstruktur bzw. Zelle, welche betroffen ist, wird gesundes Nachbargewebe durch die Krebszellen mit Progression zerstört, diese breiten sich über die Lymph- und Blutbahn aus und verbreiten sich innerhalb des umliegenden Gewebes (vgl. Schmidt, Banzer, 2017, S. 226).
Die Umwandlung normaler Zellen in Krebszellen kann Jahrzehnte andauern (vgl. WolfKühn; Morfeld, 2016, S.143). Karzinogene, welche exogen einwirken, stellen z.B. Tabakrauch, Viren, ernährungsabhängige Faktoren, Chemikalien oder radioaktive Strahlen dar. Die meisten Entwicklungen von Krebs gelten umwelt- und verhaltensbedingten Ursachen neben einem genetischen Entwicklungsmechanismus (vgl. ebd.). Die Psychoneuroimmunologie fand in den 1970er-Jahren die Verbindungen zwischen Gehirn und Immunsystem heraus (vgl. ebd.). Durch die Möglichkeit der Erkennung und Zerstörung der Krebszellen durch das Immunsystem ist physiologisch erklärbar, dass die psychischen Prozesse mit neuroimmunologischen Verbindungen eine Krebsentstehung beeinflussen können (vgl. ebd.). Bisher liegt wenig Evidenz für die Wirkung von chronisch sozioemotionalem Distress in Bezug auf Krebserkrankungen vor (vgl. ebd.). Da psychische Belastungen allerdings häufig durch gesundheitsschädigendes Verhalten kompensiert werden, z.B. durch Rauchen, verursachen diese indirekt Krebs (vgl. ebd.).
Die Therapiemaßnahmen innerhalb einer Krebsentstehung hängen von biologischen Eigenschaften und der bisherigen Verbreitung des Tumors ab (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.143) Bei Tochtergeschwülsten in anderen Organen ist zumeist keine Heilung mehr möglich und eine palliative Phase zur Steigerung der restlichen Lebensqualität wird eingeleitet (vgl. ebd.). Des Weiteren stehen insgesamt unspezifische Therapiemethoden zur Behandlung von Krebs zur Verfügung. Die Operation und Strahlentherapie, die Chemotherapie, die Immuntherapie sowie die Hormontherapie.
Diese weisen jeweils starke Nebenwirkungen im Verlauf auf. Trotz erweiterter Medizin innerhalb der letzten Jahrzehnte stehen Krebserkrankungen geringen Heilungschancen gegenüber (vgl. ebd.). Statistisch erfasst leben fünf Jahre nach einer Krebsdiagnose noch 52 % der Männer sowie 59 % der Frauen (vgl. ebd.). Jahre nach einer ersten Krebsdiagnose können geheilte Patienten ein Rezidiv und Fernmetastasen entwickeln, weshalb Krebs als chronische Erkrankung angesehen werden kann (vgl. ebd.).
Innerhalb der medizinischen Krebstherapie erfolgt die psychoonkologische Betreuung durch einen Liaison- oder Konsiliardienst bzw. einer psychoonkologischen, integrierten Fachabteilung. Die psychoonkologische Betreuung zielt insbesondere auf die Folgen und Nebenwirkungen der medizinischen Therapie ab, welche emotionale Belastungen und psychische Störungen auslösen kann (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2017, S.144). Ein anschließender Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik mit integriertem psychoonkologischen Therapiekonzept erfolgt häufig. Die Bewältigung der Krankheit sowie die Vorbereitung auf den Beruf und auf den Alltag der Patienten soll unterstützt werden. Die ambulante Nachsorge erfolgt, sobald die Patienten wieder zu Hause sind (vgl. ebd.).
Medizinischerseits wird auf entstehende Rezidive und weitere Therapien geachtet. Psychosoziale Beratungen werden angeboten. Eine u.a. aktuelle Forschungsfrage ist, inwiefern die Patienten durch psychoonkologische Institutionen und Dienstleistungen eine ihren Problemlagen angemessene, frühzeitige Behandlung erhalten können (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.145). Die Arbeitsgemeinschaft Psychoonkologie (PSO), die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) und die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie (dapo) nehmen in Deutschland Aufgaben der Qualitätssicherung wahr (vgl. ebd.). Denkbare Spektren der Verläufe von Krebserkrankungen lassen sich abbilden in: Erstdiagnose - Therapie - Remission - Rezidiv - Therapie - Progredienz -Tod (vgl. ebd). Innerhalb einer Erstdiagnose und deren Behandlung steht eine Diagnoseverarbeitung im Vordergrund. Patienten müssen die therapeutische und medizinische Diagnostik hinnehmen und sich im Rahmen einer Rehabilitation mit den möglichen Verlusten und Einschränkungen bei bleibenden Schäden auseinandersetzen (vgl. ebd.). Bestenfalls wird die Therapie dabei erfolgreich durchgeführt mit anschließender Aussicht auf Heilung - der Remission (vgl. ebd.). Die Progredienz bedeutet das Fortschreiten der Krebserkrankung, wobei Metastasen und Rezidive auftreten und Patienten erneute Therapien durchlaufen müssen. Dabei sind diese weiterhin funktionsfähig in ihrem Alltag, allerdings in Kombination mit einer Abhängigkeit von dem medizinischen System. Dabei entstehen Gefühle wie Angst, depressive Verstimmungen, Verzweiflung aber auch immer wiederkehrende Hoffnung (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.145).
Sobald die Krebserkrankung keine Heilungschancen mehr aufweist, besteht eine palliative Situation, in welcher der körperliche Verfall stetig fortschreitet, chronische Schmerzen bestehen, ein Versorgungsbedarf und ein zunehmender Funktionsverlust bestehen (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.145). Hierbei steht im Fokus, die Lebensqualität zu erhöhen und Symptome zu vermindern (vgl. ebd.). Die Patienten müssen sich währenddessen mit dem Tod auseinandersetzen (vgl. ebd.). Schwerpunkte innerhalb der Rehabilitationsphase bei Krebserkrankungen liegen bei psychosomatischen und somatopsychischen Problemen, wie z.B. dem Fatigue - der chronischen Müdigkeit, bei emotionalen Problemen, z.B. Ängsten und sich entwickelnde Depressionen in Bezug auf den Krankheitsverlauf sowie bei Selbstwert- und Identitätsproblemen, durch ein insgesamt verändertes Körperbild und dabei bestehende geringere Leistungsfähigkeit (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2017, S.146). Des Weiteren können innerhalb von zwischenmenschlichen Beziehungen Kommunikationsstörungen, (psycho)sexuelle Störungen, Rollenveränderungen bis hin zum Rückzug und zur sozialen Isolation entstehen (vgl. ebd.). Im Falle einer beruflichen Tätigkeit stehen Probleme am Arbeitsplatz ebenso im Fokus durch die bereits genannten Problematiken im Krankheitsverlauf (vgl. ebd.). Enorme psychische Belastungen stellen die Bedrohung des Todes und eine anhaltende Unsicherheit hinsichtlich des Krankheitsverlaufes dar (vgl. ebd.). Patienten entwickeln oftmals eine Progredienzangst - eine Angst vor dem Fortschreiten oder des Wiederauftreten der Krebserkrankung, da auch trotz erfolgreicher Therapie ein Rezidiv jederzeit auftreten kann (vgl. ebd.)
Das Selbstkonzept leidet unter Krebserkrankungen. Dazu gehören das soziale Selbst, das Körperselbst sowie das Leistungsselbst und die Identität (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2017, S.146 f). Körperlich können u. U. Organverluste oder Verstümmelungen oder andere körperliche Veränderungen durch Operationen auftreten sowie Schmerzen, welche bestehen bleiben (vgl. ebd.). Körperstörungen können sich dabei entwickeln, welche das Selbstwertgefühl schädigen (vgl. ebd.). Auch das soziale Umfeld, Familie, Freunde oder Arbeitskollegen sind von der Krebsdiagnose betroffen, indem diese eine große Belastung miterleben (vgl. ebd.). Oftmals versuchen Krebspatienten ihren Partner oder ihre Familie nicht zu belasten, weshalb eigene Emotionen verschwiegen werden und es zu sozialem Rückzug kommen kann, wodurch kein sozialer Rückhalt entstehen kann (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2017, S.146 f).
Insgesamt ist das Ausmaß einer psychischen Belastung - dem Distress, bei den Krebspatienten unterschiedlich (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2017, S.147). Normale Gefühle der Angst, Verletzlichkeit und der Trauer, bis hin zu klinisch relevanten Störungen, können vorliegen. Circa ein Viertel aller Krebspatienten leidetwährend ihrer Krebserkrankung unter Depressionen, Ängsten oder Anpassungsstörungen (vgl. ebd.). Starker Distress tritt besonders stark auf, sofern bereits zuvor psychosoziale Belastungen vorlagen und im Verlauf der Erkrankung weniger Bewältigungsmechanismen ausgeschöpft werden können (vgl. ebd.). Ein Bedarf nach Interventionsmaßnahmen entsteht häufig in besonders kritischen Krankheits- und Behandlungsphasen, bei Komplikationen oder Rezidiven und auch sobald sich die medizinische Therapie dem Ende zuneigt und das Alltagsleben wieder beginnt (vgl. ebd.). Innerhalb psychosozialer Wiedereingliederung sowie beruflicher Wiedereingliederung können psychoonkologische Interventionen hilfreich sein (vgl. ebd.).
Diagnostik in der Psychoonkologie
Individuelle Ressourcen und Belastungen der Patienten sollen innerhalb der psychoonkologischen Diagnostik erfasst werden. Dabei bestehen eine Reihe von Screeningverfahren, welche einen psychoonkologischen Betreuungsbedarf ermitteln können. Darunter z.B. das „Distress-Thermometer“ (siehe Anhang) (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2017, S.147).
Psychoonkologische Interventionen
Psychoonkologische Interventionen sollen vor allem die Erkrankten unterstützen, sich psychisch stabilisieren zu können, um ihren Krankheitsverlauf bewältigen zu können (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.149). Dabei werden Kriseninterventionen, Beratungen, Patientenschulungen, Entspannungsverfahren, Kunsttherapie sowie Psychotherapien verwendet (vgl. ebd.). Ein Fundament innerhalb der psychoonkologischen Arbeit stellen die Wertschätzung innerhalb der TherapeutenPatient-Beziehung dar (vgl. ebd.). Themen zu existenziellen Fragen hinsichtlich Tod, Sterben und Krankheit müssen seitens der Therapeuten ausgehalten und reflektiert werden (vgl. ebd.).
Ziele psychoonkologischer Interventionen stellen die Verbesserung psychischer Befindlichkeit, die Reduktion psychischer Störungen wie z.B. einer Depression, die verbesserte Krankheitsbewältigung und eine Förderung und Stärkung der personalen
und sozialen Ressourcen dar (vgl. Weis, Wechsung, 2002, S.71). Des Weiteren leisten psychoonkologische Interventionen Hilfestellung bei der Entwicklung von individuellen Perspektiven sowie innerhalb der Bewältigung des Alltags und dem Auseinandersetzen mit dem Tod und spirituellen Themen (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.149). Häufig werden diese Interventionen im ambulanten oder im Gruppensetting innerhalb von Rehabilitationskliniken absolviert (vgl. ebd.). Insbesondere innerhalb der Gruppensettings ermöglicht dieses den Patienten einen Austausch und ein Feedback bzgl. ihrer Krankheitsgeschichte und deren Bewältigung. Konzeptionell setzen psychoedukative sowie supportiv-expressive psychoonkologische Interventionen dabei den Rahmen (vgl. ebd.)
Die psychoedukativen Konzepte basieren dabei auf den kognitiv-behavioralen psychotherapeutischen Ansätzen und nutzen die Vermittlung von Wissen mit anwendungsorientieren Übungen bzgl. des eigenen Verhaltens durch vorgegebene Themen (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.150).
Innerhalb der verhaltenstherapeutischen Arbeit ist das Ziel, Kognitionen der Patienten zu verändern, z.B. im Hinblick auf die Bewertung ihrer krankheitsbezogenen Stressoren (vgl. ebd.). Selbstregulative Strategien hinsichtlich der eigenen Erkrankung oder dem Umgang mit Schmerzen, Depressionen und Ängsten stehen ebenso im Fokus (vgl. ebd.).
Eine supportiv-expressive Therapie folgt dem Ansatz der existenziellen Psychotherapie, welche insbesondere für Krebserkrankte in einem hohen Stadium entwickelt wurde (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.151 f.). Die Patienten sollen dabei vor dem Hintergrund ihres realen Traumas, bei welchem jeder Mensch krisenhaft reagieren würde, ihre Gefühle wie Trauer, Wut und Angst ausdrücken, wahrnehmen und integrieren lernen (vgl. ebd.). Insgesamt richten sich psychoonkologische Interventionen auch an die Angehörigen der Patienten, da diese eine wichtige soziale unterstützende Quelle für die Erkrankten darstellen und ebenso hohen Belastungen während des Krankheitsverlaufes ausgesetzt sind (vgl. ebd.). Diese Interventionen sollen die soziale Unterstützung verstärken, jedoch auch den Lebenspartner entlasten (vgl. ebd.).
Bisher gibt die Forschung keine Antworten auf die Frage, ob durch psychoonkologische Interventionen das Überleben der Krebserkrankung zu beeinflussen ist, z.B. durch die Entwicklung eines Kampfgeistes (vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S.152). Die wissenschaftliche Evidenz spricht bisher gegen solches (vgl. ebd.). Allerdings können psychoonkologische Interventionen das psychische Wohlbefinden sowie die Lebensqualität positiv beeinflussen (vgl. ebd.).
3.3 Bedarf in der Psychoonkologie
Innerhalb der letzten Jahre haben veränderte Lebensgewohnheiten, soziodemographische Veränderungen und auch eine verbesserte Diagnostik hinsichtlich der Krebserkrankung zu einer Steigung der Inzidenz von Krebserkrankungen geführt (vgl. Kapfhammer, 2015, S. 255 ff.). Diese stellen weiterhin die führende Todesursache innerhalb der Gesellschaft dar (vgl. ebd.). Die somatischmedizinischen Behandlungen konnten jedoch Fortschritte hinsichtlich der Heilungschancen bzw. Überlebenschancen betroffener Patienten erzielen (vgl. ebd.). Der dahinterstehende medizinische Fortschritt geht mit wachsenden Folgekosten bzgl. der Langzeitüberlebenden mit Krebsdiagnose einher (vgl. ebd.). Darunter fallen auf der somatischen Ebene das Risiko für Rezidive, persistierende kardiopulmonale Schäden, Fatigue, chronische Schmerzen sowie körperliche Einschränkungen (vgl. ebd.). Auf psychischer Ebene liegen dabei erhöhter emotionaler Distress, sexuelle Dysfunktionen, kognitive Beeinträchtigungen, berufliche Probleme sowie psychosoziale Behinderungsgrade (vgl. ebd.). Eine insgesamt verminderte Lebensqualität liegt vor, unter welcher auch das Umfeld leidet. Die Onkologie setzt sich daher mit einem komplexen biopsychosozialen Krankheitsverständnis auseinander, welches die Vorgeschichte der Patienten mit akuten und chronischen Behandlungsstadien und dem eventuellen Auseinandersetzen mit dem Thema Tod verbindet. Die Qualitätskriterien der Psychoonkologie umfassen daher einen objektiv ermittelten Versorgungsbedarf sowie einen subjektiv kommunizierten Versorgungsbedarf hinsichtlich der Patienten (vgl. Kapfhammer, 2015, S. 255 ff.). Die Organisation psychoonkologischer Versorgungsstrukturen stellt eine umfangreiche gesundheitspolitische Aufgabe dar, welche durch medizinische und psychosoziale Versorgung niederschwellig, zeit- und wohnortnah sektorenübergreifend, unter der Berücksichtigung von realisierbaren Richtlinien abgestimmt werden muss (vgl. ebd.). Vor allem ambulante Sektoren verweisen dabei auf Lücken und Engpässe hinsichtlich einer Bedarfsgerechtigkeit (vgl. ebd.). Stationäre Krankenhausinstitutionen weisen ebenfalls nur begrenzte psychosoziale, psychoedukative und psychotherapeutische Interventionen auf (vgl. ebd.). „Die psychoonkologische Versorgung beruht auf einem gegliederten System verschiedener Strukturen und Einrichtungen, ist jedoch in ihrer Ausgestaltung nicht flächendeckend und bedarfsgerecht ausgebaut.“ (Heckl et al. 2011, S. 124) Daneben stehen innerhalb psychoonkologischer Rehabilitationseinrichtungen gute Möglichkeiten zur Verfügung, welche allerdings ambulante Versorgungslücken aufweisen (vgl. ebd.) Innerhalb der Krebserkrankungen wurde bereits deutlich, dass psychische Komorbiditäten negative Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf haben (vgl. ebd.). Somit müssen im multifaktoriellen Modell medizinische Faktoren, soziodemographische Faktoren, Persönlichkeitsfaktoren sowie psychosoziale Faktoren als Stressoren und Einflussfaktoren aufeinander bezogen werden und neurobiologisch und pathophysiologisch reflektiert werden (vgl. Kapfhammer, 2015, S. 255 ff.).
3.4 Die Rolle der psychosomatischen Medizin
„Psychosomatische Medizin ist die Lehre von den körperlich-seelisch-sozialen Wechselwirkungen in der Entstehung, im Verlauf und in der Behandlung von menschlichen Krankheiten. Sie muss ihrem Wesen nach als eine personenzentrierte Medizin verstanden werden.“ (Kapfhammer, 2015, S. 2565)
Wechselseitige Beziehungen psychosozialer sowie körperlicher Vorgänge mit ihrer Bedeutsamkeit für Gesundheit und Krankheit werden innerhalb der Psychosomatischen Medizin behandelt. Die Erkenntnisse von Neurowissenschaft, Neurobiologie und Genetik zeigen neue Perspektiven bzgl. der Entstehung psychosomatischer und psychischer Erkrankungen im Zusammenspiel genetischer Anlagen, Beziehungen sowie den sozialen und gesellschaftlichen Gegebenheiten innerhalb einer Krankheitsentstehung (vgl. Beutel et al., 2013, S. 1). Evolutionär hatten die Menschen stets Feinde, gegen welche sie sich verteidigen mussten. Durch die Entwicklung psychophysiologischer Mechanismen gelingt es dem Menschen seither, seine Gesundheit in jeglichen Kontexten aufrechtzuerhalten. Das zentrale sowie das autonome Nervensystem, das Immunsystem und das neuroendokrine System sind für die Vermittlung dieser Mechanismen zuständig. Dennoch unterliegen diese physiologischen Mechanismen Einschränkungen, welche durch soziale oder umweltbedingte Ereignisse gestört werden können (vgl Novack et al., 2007, S. 388 ff.). Durch Hans Selye wurde erstmalig erforscht, dass chronischer Stress zu vergrößerten Nebennieren, atrophischer Thymusdrüse und Tumoren führen kann. Vollständig verstanden sind die Psychophysiologie und die Psychologie von Stress weiterhin nicht (vgl Novack et al., 2007, S. 388 ff). Durch psychischen Stress ausgelöste gesundheitsschädliche Auswirkungen sind jedoch bewiesen (vgl. ebd.). Das allostatische Belastungsmodell beschreibt die physiologischen Auswirkungen durch chronischen Stress. „Allostatis“ meint die sich dem Kontext anpassenden Reaktionen des Körpers bei Stress. Die „allostatische“ Belastung beschreibt dabei die sich steigernden Abnutzungen der Reaktionen auf den Körper. Das allostatische Belastungsmodell beschreibt die Stressoren nicht als rein psychologische Faktoren, sondern als Faktoren, welche die Stressreaktionssysteme zu Fehlregulationen beeinflussen kann, mit in begriffen der Genetik, den Lebenserfahrungen und gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen wie z.B. Rauchen. Die bereits erläuterten Wechselwirkungen zwischen endokrinem System und dem zentralen Nervensystem erklären den Fakt, der beeinflussten Immunfunktionen durch wahrgenommene stressige Lebenserfahrungen (vgl Novack et al., 2007, S. 388 ff). Neuronale und auch die endokrinen Veränderungen gehen mit Veränderungen von Verhaltenszuständen und der Einheit von Gehirn und Immunsystem einher. Dabei eröffnen sich verschiedene Wege, welche die Immunabwehr über Verhaltensprozesse beeinflussen könnten (vgl. ebd.). Das Vorkommen dieser Wege bekräftigt die Hypothese, dass Veränderungen des Immunsystems Mechanismen vorweisen, welche durch psychosoziale Faktoren über Gesundheit und Krankheit entscheiden (vgl Novack et al., 2007, S. 388 ff.). Die einst rein naturwissenschaftliche Ausrichtung der Medizin entwickelte daraufhin innerhalb des 20. Jahrhunderts die psychosomatische
Anthropologie, welche nebst physischer Prozesse den einzelnen Menschen, dessen Erleben und Schicksal und Lebensgeschichte betrachtet (vgl. Ermann, 2007, S. 17).
4. Methodisches Vorgehen
Die Arbeit wurde durch eine systematische Literaturanalyse umgesetzt. Die Literaturrecherche erfolgte über die Datenbanken „SpringerLink“ sowie „PubMed“. Abrufzeitraum ist der Juli 2023. Der betrachtete Zeitraum erstreckt sich von 2011 bis 2023. Ein Rückgriff auf Daten bis zum Jahr 2011 erfolgte, da in diesem Zeitraum aussagekräftige Studien zum verwendeten Setting in Bezug auf das Thema durchgeführt wurden. Als Suchbegriffe werden verwendet: „Cancer and Neuroscience“, „Psychoendokrinologie und Krebs“, „Hormone und Krebs“, „Krebserkrankungen und Stress“, „MBSR und Krebs“, „MBSR and cancer“, „Bewegung und Krebs“, „exercise and cancer“. Synonyme der Hauptsuchbegriffe wurden unterschiedlich kombiniert und mit den Konjunktionen „und“ und „oder“ verbunden. Die Inhalte wurden dabei nach den Kriterien psychoneuroimmunologische und psychoendokrinologische Inhalte hinsichtlich der Dysregulationen, ausgelöst durch chronischen Stress und psychologische Interventionen im psychoonkologischen Rahmen, mit Bezug zur Stressreduktion hinsichtlich dieser Thematik nach interner Validität, Anwendbarkeit, Reliabilität und Größe der jeweilig durchgeführten Studien bewertet. Die Literaturrecherche fand im Zeitraum Anfang Juli bis Ende Juli 2023 statt. 40 gefundene, potenzielle Quellen wurden begutachtet und auf Verwendbarkeit überprüft. Dabei verringerte sich die Anzahl der Quellen auf 33. Diese Quellen wurden anschließend zur näheren Analyse herangezogen. Nach einer genaueren Durchsicht der Inhalte wurden 18 Quellen ausgeschlossen. Eingeschlossen wurden die 15 Quellen, welche in einem Zeitraum von 2011 - 2021 veröffentlicht wurden, den Themenbezug auf psychoimmunologische Dysregulationen bei onkologischen Erkrankungen aufweisen und Quellen, welche erfolgreiche Interventionsmethoden in Bezug auf eine Bewältigung dessen haben. Ausgeschlossen wurden Quellen, welche eine rein medizinische Thematik, eine Studienlage vor 2011, den Fokus ausschließlich auf therapeutische Interventionen, oxidativen Stress oder eine rein biologische Thematik ohne Bezug auf die Onkologie vorwiesen.
Abb. 4 Prisma - Diagramm
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
(eigene Darstellung)
Tab. 4 Extraktionstabelle
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
(eigene Darstellung)
5. Ergebnisse
5.1 Psychosozialer Distress und Entzündungsprozesse bei Krebs
Folgende Erläuterungen stammen aus Hefner; Csef, 2017, S. 845 ff. und sind durch die Auflistung weiterer themenspezifischer Studien, welche ein stressinduziertes Tumorwachstum belegen interessant fürdiese Arbeit:
Da das Immunsystem nicht als autonom, sondern als ein vom zentralen Nervensystem beeinflusstes System betrachtet wird konnte bereits um 1970 das Konzept der „immune surveillance“ entwickelt werden, nach welchem der Körper von Immunzellen überwacht wird, um maligne Zellen rechtzeitig erkennen und zerstören zu können (vgl. Hefner; Csef, 2017, S. 845 ff.). Innerhalb dessen konnte herausgefunden werden, dass Immun- und auch Krebszellen Rezeptoren für Stresshormone auf ihrer Oberfläche vorweisen (ebd.). Somit ergab sich ein erster Anknüpfungspunkt zur Überprüfung psychischer Einflussfaktoren auf Krebs und dem zu Folge wurden Experimente zu Entzündungsprozessen und Distress gestartet (ebd.).
1863 konnte durch Rudolf Virchow ein erster Zusammenhang zwischen Entzündungsreaktionen und Krebs gefunden werden. Nach Entdeckung der „immune surveillance“ wurde deutlich, dass die natürlichen Killerzellen daran beteiligt sind. Die Aktivität dieser Killerzellen (NK-Zellen) konnte im Zusammenhang mit depressiven Symptomen und sozialer Isolation bei Brust- und Ovarialkarzinompatientinnen erhoben werden (ebd.)
Einschränkungen zellulärer Immunfunktionen des adaptiven als auch des angeborenen Immunsystems konnten bei depressiven Brustkrebspatientinnen durch einen Hauttest 2009 erstmalig in-vivo vorgestellt werden (ebd.). Insgesamt spalten sich die Meinungen bzgl. der klinischen Relevanz dieser Ergebnisse jedoch, aufgrund der Notwendigkeit der Aktivität und der Konzentration der Immunitätslage der Immunzellen (ebd.). Experimente können oftmals solches nur annähernd demonstrieren. Die NK-Zellen innerhalb humaner psychoneuroimmunologischer Studien wurden aus dem Blut entnommen. Dabei bildet deren Zahl und Aktivität nicht automatisch die Situation im Inneren des Tumors ab. Dies verdeutlicht die geringe Aussagekraft solcher Studien (ebd.). Das Milieu von Botenstoffen, in welchem verschiedenste Immunzellen aktiv werden oder die Zellen unterschiedliche Aufgaben ausführen, ist bedeutsam (ebd.). Von Bedeutung ist eine Forschung von Blomberg et al., welche Zytokinmuster von T- Helfer Zellen bei Brustkrebspatientinnen untersuchte. Dabei wurden unter geringer Angstbelastung und verbesserter Stimmung die Produktionen der Th1-Zytokine, welche proinflammatorische und antitumoröse Eigenschaften vorweisen, erhöht (ebd.). Unter psychischer Belastung wurde ein Th1-Th2-Switch ausgelöst, welcher die Produktion der Th1-Zytokine hemmt und die Produktion inflammatorischer Th1- Zytokine antreibt (ebd.). Des Weiteren konnte herausgefunden werden, das ß-Blocker katecholamininduzierte Konzentrationssteigerungen von IL-6, MCP1 und IL-8 unterbinden können (ebd.). Dies stellt eine wichtige Erkenntnis dar, da während eines Anstiegs von IL-6 und IL-8 mit der Zugabe von Katecholaminen ein Anstieg des MCP1 (monocyte chemotactic protein-1) , welcher zu gesteigerter Rekrutierung von Monozyten in das Tumorgewebe führt und somit ein höheres Krankheitsstadium und eine verkürzte Überlebenszeit herbeiführt, erfolgt (ebd.).
Im Rahmen der Forschung wurde sich vermehrt mit der Wirkung von Botenstoffen der Stressachsen (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse und das autonome Nervensystem) im Hinblick auf das Milieu bösartiger Tumore, auseinandergesetzt (vgl. Hefner; Csef, 2017, S. 845 ff.) Beide Achsen wurden fokussiert, vor dem Hintergrund, dass Steroide als Hauptbotenstoffe der HPA-Achse das Vernichten der Krebszellen (Apoptose) vermindern, deren Vermehrung anregen und die Chemoresistenz steigern können (ebd.). Weiterhin sind jedoch Steroide ein Bestandteil zur symptomatischen Behandlung von Nebenwirkungen oder Entzündungsprozessen innerhalb der onkologischen Therapie (ebd.). Eine mit ß-Blockern vergleichbare Substanz, welche einen hemmenden Effekt vorweisen kann, liegt nicht vor. Insgesamt sind Forschungen mit Katecholaminen als hauptsächliche Botenstoffe der ANS daher vermehrt durchgeführt worden (ebd.). Innerhalb von Studien zum Mammakarzinom hat beispielsweise die Vermehrung der Tumorzellen nach Aktivierung ß-adrenerger Rezeptoren auf der Oberfläche zugenommen (ebd.). Durch die zusätzliche Gabe von Adrenalin vermehrten sich in einem anderen Experiment die Zellen eines Pankreaskarzinoms (ebd.). Vor diesem Hintergrund wurden ß-Blocker verabreicht, wodurch Apoptose hergeleitet und Zellvermehrung reduziert werden konnte (ebd.). Forschungen zu Folge ist erwiesen, dass Katecholamine die Chemoresistenz erhöhen und ß-Blockerdie Effektivität von Chemotherapeutika erhöhen (ebd.).
Ein Forscherteam bewies durch Tierversuche, dass sich der Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), der VEGF-mRNA und die Angiogenese durch den Einfluss von Stress, welche über einen ß-adrenergen Signalweg läuft, innerhalb eines Ovarialkarzinoms, erhöhen (vgl. Hefner; Csef, 2017, S. 845 ff.). Vergrößerung der Tumormasse um bis zu 275 % konnten dabei erhoben werden (ebd.). Der Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) stellt einen zentralen Signalstoff der Angiogenese dar, welcher durch Tumorzellen, Endothelzellen sowie den Blutplättchen produziert wird (ebd.). Insgesamt konnten die Effekte der Erhöhung durch die Gabe von ß- Blockern, insbesondere des ß-Blockers Propranolol, des VEGF-spezifischen Antikörpers Bevacizumab und auch des VEGF- Rezeptor-Inhibitors PTK 787 wieder abgeschwächt werden (ebd.). Innerhalb von Humanstudien wurde die soziale Unterstützung als ein Stresspuffer angesehen, welcher zu einer Abschwächung der typischen Stressreaktionen führt (ebd.). Tatsächlich konnten Patientinnen mit Ovarialkarzinom, welche ausreichend soziale Unterstützung erhielten reduzierte VEGF-Konzentrationen im Serum vorweisen, wie auch im Tumorgewebe (ebd.).
Tumorerkrankungen werden tödlich, sobald sie ihren Zellverband, ohne Schaden zu nehmen, verlassen können und neue Kontakte mit umliegenden Strukturen eingehen, um sich letztendlich an einem neuen Ort anzusiedeln (vgl. Hefner; Csef, 2017, S. 845 ff.). Damit dies funktioniert sind die jeweiligen Akteure des Tumormileus auf unterschiedliche biologische Mechanismen angewiesen (ebd.). Beim Ovarialkarzinom beispielsweise ist dieser Prozess durch die zusätzliche Gabe von Katecholaminen kontrollierbar (ebd.). Gleichzeitig erfolgt eine vermehrte Konzentration von MMP-2 und MMP-9, welche durch ß-Blocker bzw. MMP-Blocker hemmbar ist (ebd.). Beobachtbar wurde in Experimenten, dassTumorzellen mit den Bestandteilen von Basalmembranen oder der extrazellulären Matrix, durch die Unterstützung von Rezeptoren auf der Oberfläche, interagieren können (ebd.). Die Gabe des ß-Agonisten Isoproterenol konnte in der Kultur von OVCAR-3-Zellen die Adhäsion sowie die Verbreitung bösartiger Tumorzellen durch die Wechselwirkungen der Integrine steigern (ebd.). Die ß- Blocker konnten zu einer Verringerung der Zellvermehrung und einer Steigerung des Zellsterbens führen, wobei sich die Konzentrationen des VEGF, des MMP-2 sowie des MMP-3 ebenfalls reduzierten (ebd.). Die Katecholamine stellen die biologische Matrix des psychosozialen Distress dar. Aus diesem Grund haben sie als Botenstoffe den Bezug zu psychischen Komorbiditäten innerhalb der Krebserkrankungen, z.B. depressive Störungen. Die erläuterten Forschungsergebnisse der Beeinflussung von Stresshormonen auf Krebserkrankungen, verdeutlichen durch die Experimente zu ß- Blockern und den Katecholaminen, die Möglichkeit eines beeinflussenden Stresshormoneinflusses, welcher innerhalb eines bestimmten Zeitfensters eine Rolle für den Verlauf einer Krebserkrankung sein könnte (vgl. Hefner; Csef, 2017, S. 845 ff.)
5.3 Onkologische Auswirkungen durch Immunologische Dysregulationen
Innerhalb der ausgewerteten Ergebnisse ist der verwendeten Literatur gemeinsam, dass chronischer Stress nicht bewiesen zur Entstehung von Tumoren führt, jedoch aber bereits bestehende Krebserkrankungen negativ beeinflussen kann. So ergaben die Ergebnisse der jeweiligen Studien/Reviews, dass chronischer Stress innerhalb von Krebserkrankungen zu einer verschlechterten Prognose führen kann und ein schnelleres Tumorwachstum induziert, durch ein Vorliegen von physiologischen Prozessen, welche durch das endokrine System und durch das Immunsystem reguliert werden (vgl. Chen et al., 2021). Die Übersichtsarbeit von Scheff und Salomon aus 2021 stellt dar, dass sensorische Nerven über Neuroimmunkommunikation das Tumorwachstum und die Metastasierung über hemmen bzw. fördern der Immunsuppression regulieren. Hierbei wird der Zusammenhang zwischen dem Immunsystem und den stressinduzierten neurologischen Prozessen ersichtlich. In Zhang et al. von 2020 wird deutlich, dass durch physiologische Mechanismen stressvermittelter Immunantworten ein verstärktes Tumorwachstum vorliegt, durch eine Umverteilung des Immunsystems durch chronischen Stress. Experimente als auch Studien können somit onkologische Auswirkungen, welche sich auf das erhöhte, schnellere Tumorwachstum und eine Verschlechterung der Patientenprognosen beziehen, durch das Vorliegen von chronischem Stress belegen.
5.4 Auswirkungen psychologischer Interventionen
Lengacher et al. belegten in 2012 die verringerte Cortisolausschüttung nach einem 6wöchigem MBSR Training von Krebspatienten. Insgesamt konnten dabei Verbesserungen hinsichtlich Stress und Ängstlichkeit bewiesen werden. Andere Studien konnten ähnliche Ergebnisse darstellen, welche zu dem Fazit führten, dass MBSR Programme als stressreduzierende Interventionsmaßnahme Cortisolsenkungen begünstigen können sowie zu einer Normalisierung der HPA-Achse führen (vgl. Matousek et al. S. 65 ff.).
Die Interventionsmaßnahme der körperlichen Aktivität führt u.a. dazu, dass Zytokine von der Skelettmuskulatur gebildet werden und somit regulativ auf das Immunsystem einwirken können. Innerhalb dessen konnten bereits definierte Veränderungen der pro- und antiinflammatorischen Faktoren beobachtet werden (vgl. Jäger; Bloch, 2012, S. 80 ff.). Körperliche Aktivität nimmt dabei nicht nur einen Einfluss auf die psychischen und physischen Zustande von Krebspatienten (z.B. durch die Reduktion von Depressionen oder Fatigue), sondern kann Einflüsse auf die Erkrankungsverläufe nehmen. Dabei sind das Immunsystem und seine Abwehrmechanismen bedeutsam. Dabei regulieren die bereits o.g. Zytokine und ihre Antagonisten die Aktivität des Immunsystems, indem sie bei der körperlichen Aktivität hauptsächlich von der Skelettmuskulatur ausgeschüttet werden und sich somit das Zytokinprofil der Krebspatienten verändern kann (vgl. Jäger; Bloch, 2012, S. 80 ff.).
Die Effektivität von Massagen, geführten Imaginationen oder anderen Entspannungsmethoden können oftmals Aspekte der Immunfunktionen verbessern (vgl. Novack et al., 2007, S. 388 ff.). Dabei gehen endokrine und neuronale Dysregulationen mit Verhaltensveränderungen und der Schnittstelle zwischen dem Immunsystem und dem Gehirn einher (vgl. ebd.). Verschiedene Interventionen können somit die Immunabwehr über Verhaltensprozesse beeinflussen (vgl.ebd.). Die randomisierte Studie von Kang et al. in 2022 lässt durch die Ergebnisse der 52 Krebspatienten daraus schließen, dass ein regelmäßiges körperliches Intervalltraining Angstsymptomatiken sowie Stress vermindert und die Lebensqualität erhöht.
Insgesamt ist anhand der vorliegenden Studien und Reviews nicht reliabel belegt, dass sich die körperliche Aktivität auf das Tumorwachstum hinsichtlich einer Normalisierung der endokrinologischen und immunologischen Regulationen auswirkt, jedoch ergaben die Ergebnisse größtenteils das effektive Reduzieren von Stress, welches für diese physischen Vorgänge bedeutsam sein kann. Eine Erhöhung der Lebensqualität innerhalb der Krebserkrankungen konnte allerdings durch die Interventionen der körperlichen Aktivität durchgehend bestätigt werden, womit die Wichtigkeit der psychoonkologischen Interventionen hinsichtlich derStressreduktion verdeutlicht wird.
5.4.1 Beispiel Bewegung
Da chronische Entzündungen einen Beitrag innerhalb von Krebserkrankungen leisten, ist die Regulation des Immunsystems zur Freisetzung von pro- und antiinflammatorischen Zytokinen als Hormonfreisetzung, welche die Immunaktivität beeinflusst, von wesentlicher Bedeutung. Die Zytokine spielen dabei eine verantwortliche Rolle innerhalb aller inflammatorischen Prozesse während einer Krebserkrankung und zur Regulation des Immunsystems (vgl. Jäger; Bloch, 2012, S. 80).
Somit ist es nicht verwunderlich, dass antiinflammatorische Therapieansätze als zusätzliche Behandlungen bei Krebserkrankungen angewendet werden (vgl. ebd.). Diese sollen die Freisetzung der pro- und antiinflammatorischen Zytokine beeinflussen (vgl. ebd.). Körperliche Aktivität führt u.a. dazu, dass solche Zytokine von der Skelettmuskulatur gebildet werden und somit regulativ auf das Immunsystem einwirken können. Innerhalb dessen konnten bereits definierte Veränderungen der pro- und antiinflammatorischen Faktoren beobachtet werden (vgl. ebd.). Körperliche Aktivität nimmt dabei nicht nur einen Einfluss auf die psychischen und physischen Zustände von Krebspatienten (z.B. durch die Reduktion von Depressionen oder Fatigue), sondern kann auch Einfluss aufden Verlauf einer Krebserkrankung nehmen (vgl. ebd.).
Dabei sind das Immunsystem und seine Abwehrmechanismen von großer Relevanz. Dabei regulieren die bereits o.g. Zytokine und ihre Antagonisten die Aktivität des Immunsystems, indem sie bei der körperlichen Aktivität hauptsächlich von der Skelettmuskulatur ausgeschüttet werden und sich somit das Zytokinprofil der Krebspatienten verändern kann. Ebenso können durch diesen Prozess der Zytokine Einflüsse auf unspezifische Symptome, wie z.B. diese der Tumorkachexie beobachtet werden (vgl. Jäger; Bloch, 2012, S. 80). Insgesamt verdeutlicht dies die Wirkung der körperlichen Aktivität bei Krebspatienten in Verbindung mit der Freisetzung von Zytokinen und ihren Antagonisten durch eine zum Teil veränderte Immunantwort (vgl. ebd.).
Auch oxidativer Stress, welcher oftmals Ausgang von Begleitsymptomen während einer Krebserkrankung ist - z.B. Kachexie, Fatigue, entsteht u.a. auch durch Zytokine. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der körperlichen Trainingsinterventionen bei Krebspatienten innerhalb einer immunregulierenden Intervention (vgl. ebd.).
Innerhalb der letzten 20 Jahre wurden verschiedene antigenspezifische Vakzinierungsstudien durchgeführt, welche das Immunsystem spezifisch beeinflussen sollten (vgl. Jäger; Bloch, 2012, S. 81). Unterschiedliche, starke humorale oder zelluläre Immunantworten je nach Vakzinekomposition und der jeweiligen immunologischen Basiskonstitution, wiesen besonders ältere Patientenpopulationen auf (vgl. ebd.). Dabei hatten Patienten mit messbarer signifikanter Immunantwort einen besseren Krankheitsverlauf bzgl. progressionsfreie Intervalle oder ihrer Gesamtüberlebenszeit (vgl.ebd.). Wohingegen Patienten ohne diese messbare Immunantwort keinen solchen Vorteil von der Vakzinierungsintervention vorwiesen (vgl. ebd.). Regelmäßige körperliche Bewegung im Zusammenhang mit der Aktivierung und Induktion der antigenspezifischen T-Zellen kann eine wichtige Rolle bzgl. einer Effektivität derTumorvakzinierungsstrategien übernehmen (vgl. ebd.).
Innerhalb von Experimenten mit Mäusen konnte bereits verdeutlicht werden, dass Mäuse nach regelmäßiger körperlicher Betätigung eine stärkere Immunantwort der antigenspezifischen T-Zellen vorwiesen, als die Kontrollgruppe ohne diese körperliche Betätigung (vgl. Jäger; Bloch, 2012, S. 83 f.). Studien zu Folge führen bewegungstherapeutische Interventionen zu immunologischen Effektorfunktionen sowie zu reduzierten Pneumonierisiken (vgl. ebd.). Die Regelmäßigkeit und die Dauer spielen zur Effizienz positiver immunologischer Effekte eine besonders große Rolle (vgl. ebd.). Studien zu Folge führt eine antigenspezifische Vakzinierung gegen Infektions- und Tumorerkrankungen eher zu therapeutisch relevanten Immunreaktionen bei körperlich aktiveren Patienten (vgl. ebd.).
T-Zellreaktionen, welche antigenspezifisch sind, haben eine höhere Chance bei der Kontrolle der Tumorerkrankungen. Klinische Studien verdeutlichen die Abhängigkeit der Steigerung der Zytokinproduktion von körperlicher Aktivität (vgl. Jäger; Bloch, 2012, S. 82). Durch aktivierte Zytokin produzierende dendritische Zellen und antigenspezifische T-Zellen wird die Induktion spezifischer Antikörper vorangetrieben. Insgesamt konnte der Kontext zwischen der körperlichen Betätigung und einer effektiven Stimulation von NK-Zellen und antigenspezifischen B-Zellen bewiesen werden (vgl. ebd.). Die regulierenden pro- und antiinflammatorischen Zytokine von Tumorpatienten können durch sportliche Betätigung beeinflusst werden (vgl. ebd.). Bisher liegen wenige Studien vor, welche auf verschiedene Krebsentitäten abzielen und sich mit einer Veränderung der Zytokinprofile, in Verbindung mit sportlicher Betätigung, innerhalb von Krebsbehandlungen beschäftigen. Somit liegt noch keine einheitliche Studienlage zu dieser Thematik vor (vgl. ebd.). Untersucht wurden bisher Schlüsselzytokine, welche durch weitere Zytokinantagonisten und Zytokine innerhalb der Studien ergänzt wurden (vgl. Jäger; Bloch, 2012, S. 82). Des weiteren wären IL-2 und IL-10 als Zytokine interessant innerhalb einer solchen Studie, da diese durch das IL-2 Zytokin die Aktivität der NK-Zellen erhöhen können, zytotoxische T-Zellen sowie T- Helferzellen werden dabei ebenso beeinflusst womit eine potentielle Steigerung der Immunabwehr gegen Tumorzellen erreicht werden kann (vgl. ebd.). Das IL-10 beeinflusst eine anti-inflammatorische Wirkung, welche die inflammatorischen Immunlage der Tumorpatienten verbessern könnte (vgl. ebd.). Insgesamt liegen hierbei allerdings noch keine Untersuchungen zur Induktion des IL-2 durch sportliche Betätigungen bei Krebspatienten vor (vgl. ebd.). Vorliegend ist jedoch eine Studie von
Leukämiepatienten, welche eine dreimal wöchentlich stattfindende Trainingseinheit, für eine halbe Stunde zweimal am Tag beinhaltet (vgl. Baumann et al., 2012, S. 83). Dabei erhöhte sich die IL-6- Konzentration im Blut (ebd.). Andere Zytokine wurden dabei allerdings nicht verändert. Trotz verminderter Studienlage konnten signifikante Effekte von Training auf Zytokine erhoben werden bei Krebspatienten, wodurch davon auszugehen ist, dass körperliche Betätigung die Zytokinspiegel beeinflussen kann und dies somit eine Auswirkung auf die immunologische Beeinflussung innerhalb einer Krebserkrankung hat (vgl. ebd.). Insgesamt spielen dabei die Intensität des Trainings und die Art des Trainings eine erhebliche Rolle (vgl. ebd.).
5.4.2 Beispiel Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR)
Der Begriff der „mind-body medicine (MBM) fand seine Prägung in Nordamerika und etablierte sich auch vermehrt in Europa (vgl. Cramer et al, 2017, S. 406). Insgesamt stellt die MBM einen biopsychosozialen Therapieansatz dar, welcher körperliche als auch psychische, spirituelle sowie die sozialen Aspekte des Menschseins berücksichtigen soll (vgl. ebd.). Die MBM entstammt dabei aus der Schmerz - und Verhaltensmedizin, der Psychoneuroimmunologie und der Stressforschung. Ziel ist es dabei, die Interaktionen zwischen dem Körper, dem Verhalten und der Psyche zu nutzen, um somit die somatischen Erkrankungen mit ihren psychischen Begleitsymptomatiken supportiv behandeln zu können (vgl. ebd.). Therapeutische Anwendungen können Akupunktur, als passive Anwendung, jedoch auch Yoga, Imagination und Meditation als einzelne Technik darstellen (vgl. ebd.) Hingegen der Psychoonkologie dient die MBM als ein supportiver Behandlungsansatz für die somatischen Begleitsymptomatiken onkologischer Erkrankungen, wohingegen die Psychoonkologie das Ziel insbesondere in der psychischen Aufarbeitung der Erkrankung und der Erkrankungsfolgen sieht (vgl. ebd.). Die MBM steht insgesamt nicht als Ersatz für die Psychoonkologie, sondern als ihre Ergänzung. Verschiedene Studien konnten bereits belegen, dass die Interventionen der MBM die Stimmung, die Begleitsymptomatiken sowie die Lebensqualität von Patienten verbessern können (vgl. ebd.).
So auch die Mindfulness-based Stress Reduction, welche eine Stressreduktion durch Achtsamkeit darstellt.
Diese stellt ein Gruppenprogramm mit Aspekten der Stressbewältigung und Entspannung dar, welches Ernährung, Bewegung und Kommunikation miteinander verbindet, im Rahmen der Achtsamkeit (vgl. Cramer et al, 2017, S. 406 f.). Die Achtsamkeit gehört zu den südostasiatischen Meditationstraditionen und stellt einen Bewusstseinszustand dar, welcher ein nicht wertendes Bewusstsein für gegenwärtiges darstellt (vgl. ebd.). Ein „Im hier und jetzt“ - sein und erleben wird verinnerlicht und eine Offenheit für gegenwärtige Erfahrungen soll vorliegen (vgl. ebd.). In einer Studie mit 1709 Patientinnen mit Mammakarzinom konnten durch die MBSR signifikante Wirkungen auf Fatigue, Schlafstörungen, Stress, Depressionen, Lebensqualität sowie Angst gefunden werden (vgl. ebd.).
Ein Erlangen von Stabilität und Kontrolle ist ein Ziel von Achtsamkeitstechniken . Dabei können Anteile der Gefühle und des Verstands ins Gleichgewicht gebracht werden, sodass Wissen und Verstehen intuitiven Prozessen folgt (vgl. Sender, 2017, S. 91). Das Erleben resultiert aus Gefühlen und aus dem Verstand. Dabei entstehen unsere Handlungen vor allem durch Emotionen und nicht ausschließlich aus rationalen Entscheidungen. Diese Emotionen können die Bedeutung und Wertigkeit unseres Handelns beeinflussen. Techniken der Achtsamkeit unterstützen dabei, eine Kontrolle über eigene Impulse, Gedanken und Gefühle zu erlangen, indem solche bewusst zugeordnet und erlebt werden können (vgl. ebd.). Dies setzt eine wertfreie Wahrnehmung und einen Fokus auf das „hier und jetzt“ - eine Fokussierung auf den jetzigen Augenblick voraus (vgl. ebd.). Ziele stellen dabei das Trainieren der eigenen Wahrnehmung, die Vergrößerung der Objektivität und das Zusammenspiel zwischen Emotionen und Kognitionen dar (vgl. ebd.). Des Weiteren kann erlernt werden, das eigene Denken in gut oder schlecht umlenken zu können (vgl. ebd.). Die bewusstere Wahrnehmung kann dabei helfen, Sinnesreize sowie emotionale Reaktionen im Augenblick festzuhalten (vgl. ebd.).
Forschungen zu Folge liegen übereinstimmende Belege für signifikante Reduktionen von Cortisol nach Durchführung von MBSR Programmen vor (vgl. Matousek et al., 2011, S. 65 ff.). So auch Ergebnisse einer Studie mit Brustkrebspatientinnen, welche nach MBSR Programmen deutlich weniger Cortisol ausschütteten, als vor Teilnahme am Programm (vgl. ebd.). Somit hat eine Teilnahme an einem MBSR Programm Auswirkungen auf die Stressreaktion und die HPA-Achse (vgl. ebd.). Verschiedene Testverfahren wiesen allerdings keine genaue Klarheit hinsichtlich der, nach den durchgeführten MBSR Programmen, begründeten Cortisolsenkungen auf (vgl. ebd.).
Viel eher interpretierten die Forscher den Zusammenhang so, dass eine MBSR Programmteilnahme zu einer Normalisierung der HPA-Achse führen kann (vgl. Matouseketal., 2011, S. 65ff.).
6. Schlussfolgerung
6.1 Fazit
Innerhalb dieser Arbeit wird die Rolle und zudem die Wichtigkeit der psychosomatischen Medizin, als auch die der Psychoonkologie, durch das biopsychosoziale Zusammenspiel verdeutlicht. Aufgrund der vorliegenden Literaturanalyse und der verwendeten Quellen konnte der Zusammenhang zwischen chronischem Stress und einem Einfluss auf das Tumorwachstum durch psychoendokrinologische und immunologische Dysregulationen aufgezeigt werden. Eine stressinduzierte Tumorentstehung ist dabei nicht belegt. Ausschließlich die Beeinflussung von bereits vorhandenen Tumoren durch psychoendokrinologische und immunologische Dysregulationen, welche durch den chronischen Stress verursacht werden, wird abgebildet. Dabei werden die Bedarfe psychoonkologischer Interventionen hinsichtlich stressreduzierender Programme zur Senkung der u.a. für mögliche Dysregulationen verantwortlichen Cortisolausschüttungen offengelegt. Anhand der Beispiele der körperlichen Aktivität sowie der Mindfulness - Based - Stress Reduction konnten anhand von Studien bereits positive Effekte auf geringere Stresserleben erzielt werden, welche interpretatorisch zu einer Normalisierung der HPA-Aktivität führen und somit das Immunsystem stabilisieren und das Tumorwachstum nicht negativ beeinflussen. Inwiefern die tatsächliche Prognose einer Krebserkrankung dabei positiver gestellt ist, bleibt in dieser Arbeit ungeklärt, obgleich Studien zufolge bereits ein Mortalitätsrisiko durch Stressreduktion verringert werden konnte, so liegt evident kein kausaler Zusammenhang vor um zu verallgemeinern. Jedoch können im psychoonkologischen und psychosomatischen Sinne die Begleitsymptome, (z.B. Fatigue, Depression) während einer Krebserkrankung sowie die Lebensqualität - unabhängig von Stadium der Erkrankung, durch stressreduzierende psychoonkologische Interventionen, verbessert werden.
Innerhalb der Recherche zeigte sich bereits ein hohes Aufkommen von Reviews bzw. Studien, welche die körperliche Aktivität mit dem Risiko, an Krebs zu erkranken untersuchen. Daraus resultierend ergibt sich ein weiterer Forschungsbedarf, u.a. zu erheben, inwieweit eine stressreduzierende Lebensweise in Kombination mit körperlicher Aktivität und auch achtsamkeitsbasierten Verhaltensweisen zu einer Verringerung eines Krebsrisiko führen kann. Des Weiteren ist nicht bestätigt, inwiefern eine Krebserkrankung gänzlich durch stressreduzierende Lebensweisen geheilt werden kann. Die weitere Forschung auf dem Gebiet der Onkologie - insbesondere mit Verknüpfung der Psychoonkologie ist weiterhin von enormer Bedeutung. Ersichtlich wurde durch die verwendete Literatur, dass körperliche Aktivität innerhalb einer Krebserkrankung die Begleitsymptomatiken wie Angst, Depression oder Fatigue lindern kann und körperliche Aktivität erheblich einer stressreduzierenden, die Lebensqualität erhöhenden Maßnahme, innerhalb onkologischer Behandlungen, dient. Inwiefern die körperliche Aktivität dabei dazu beiträgt, dass sich endokrinologische und immunologische Vorgänge normalisieren, ist innerhalb dieser Arbeit mit der verwendeten Literatur nicht genaustens klinisch und biologisch bestätigt. Da belegt ist, dass die Dysregulationen stressinduziert vorkommen, ist jedoch naheliegend anzunehmen, dass sich solche durch Stressreduktion normalisieren können.
6.2 Handlungsempfehlungen
Um innerhalb von Krebserkrankungen effektiv Stress bewältigen zu können, da dieses nachgewiesen mit einer erhöhten Lebensqualität einhergeht und die Prognose verbessern könnte, sollten entsprechende Maßnahmen hinsichtlich der Interventionen innerhalb einer onkologischen Behandlung durchgeführt werden.
Da die Maßnahmen zur Stressbewältigung daran anknüpfen, die stressinduzierten psychoendokrinologischen und psychoneuroimmunologischen Dysregulationen innerhalb von Krebserkrankungen zu verbessern bzw. zu vermeiden, sollten solche im Rahmen einer psychologischen Betreuung erfolgen. Diese findet sich im psychoonkologischen Kontext wieder, welcher somit unabdingbar eine Komponente zu der medizinischen, onkologischen Behandlung darstellen muss.
Im Rahmen dieser Arbeitwurden dabei insbesondere die Interventionen der Bewegung (körperliche Aktivität) innerhalb von Krebsbehandlungen und die Interventionen des Achtsamkeits- und Entspannungstrainings, der Mindfulness - Based - Stress Reduction (MBSR) vorgestellt. Dabei konnten u.a. Kvillemo und Bränström in 2011 im Rahmen semistrukturierter Interviews mit 18 Krebspatienten innerhalb 8-wöchiger Achtsamkeitstrainings wahrgenommene Auswirkungen zur Stressreduktion innerhalb der Krebserkrankungen erheben, welche die Wirksamkeit der Interventionen größtenteils bestätigen hinsichtlich der körperlichen Aktivität während der Krebsbehandlung erhoben Browall et al in 2018 mithilfe eines Reviews, dass die Verbesserung und Wiederherstellung durch unterstützende, ergänzende Interventionen mit körperlicher Betätigung innerhalb von Krebsbehandlungen, gewährleistet ist.
Innerhalb der vorgestellten Studien wurde ein Intervalltraining vorgestellt. Allerdings werden sonstige Abläufe und Trainingseinheiten seitens der körperlichen Aktivität, als auch die Vorgehensweisen hinsichtlich der MBSR - Programme wenig erläutert. Im Rahmen der Studien handelt es sich bzgl. der MBSR- Programme um 8-wöchige Durchführungen und seitens der Bewegungsprogramme wird eine 12-wöchige Intervention genannt. Handlungsempfehlung stellt hinsichtlich der verwendeten Literatur und der erhobenen Kenntnisse eine frühzeitige, im frühen Krankheitsstadium beginnende und durchweg weitergeführte psychoonkologische Intervention seitens des MBSR sowie eine regelmäßige, je nach Krankheitsstadium bewältigbare, angepasste Interventionsmaßnahme der körperlichen Aktivität dar. Eine Möglichkeit, welche körperliche Aktivität und MBSR miteinander verbinden kann, stellt das Yoga dar. Dieses wird innerhalb einzelner Studien ebenfalls erwähnt. Dies begünstigt die Möglichkeit einer frühzeitig verbesserten Prognose wie auch einer Verbesserung der subjektiv empfundenen Krankheitsbewältigung und Lebensqualität, hinsichtlich auftretender Nebenwirkungen der onkologischen Behandlungen sowie möglicher Begleitsymptomatiken. Dabei ist zu erwähnen, dass hinsichtlich der Begleitsymptomatiken ein frühzeitiger Beginn der Interventionen von enormer Bedeutung ist, sodass solche bzgl. Fatigue, Ängste oder Depressionen nicht entstehen können bzw. vermindert auftreten. Die psychosoziale Betreuung in Rahmen einer unterstützenden, fürsorglichen Umgebung sollte in Bezug auf eine insgesamt gering gehaltene Stressentstehung, in Kombination mit den psychoonkologischen Interventionen und einer medizinisch-onkologischen Behandlung im Einklang stehen, um eine Behandlung und den Verlauf positiv gestalten zu können. Innerhalb der frühzeitigen Rehabilitation ist Ausdauertraining nachweislich effektiv und umsetzbar für onkologische Patienten (vgl. Knols, 2012, S. 121). Die jeweilige Belastung kann dabei differenziert ausfallen. Das Ausdauertraining die aerobe Kapazität der Krebspatienten verbessert, ist durch bereits viele Übersichtsarbeiten belegt (vgl. ebd.). Das Erreichen einer höheren aeroben Kapazität ist dahingehend von Bedeutung, da diese insbesondere durch Begleitsymptome wie z.B. Fatigue abnehmen kann (vgl. ebd.). Eine Verbesserung dessen führt dementsprechend zu einer erhöhten Lebensqualität vor und nach der Krebstherapie. Insgesamt spielen dabei der Zeitpunkt, die medizinische Behandlungsart, das Stadium der Krebserkrankung und auch die bisherigen Lebensgewohnheiten der Patienten eine Rolle (vgl. ebd.).Krafttraining innerhalb onkologischer Therapieangebote kann eine indizierte Intervention darstellen, da ein Rückgang körperlicher Aktivität während der Krebserkrankungen häufig vorliegt durch längere Krankenhausaufenthalte, welche zu einem Muskelabbau und verminderter Beweglichkeit führen können (vgl. Wiskemann et al. 2012, S. 132). Daraus resultieren nach den Krebsbehandlungen eingeschränkte Teilhaben am täglichen Leben sowie eine allgemein verminderte Lebensqualität vgl. (ebd.). Risikofaktoren für eine erhöhte Mortalität und Osteoporose nach der onkologischen Behandlung stellt solches besonders für ältere Patienten dar (vgl. ebd.). Belastungen der Psyche führen häufig ebenfalls zu einem verstärkten Leistungsabbau (vgl. Streckmann, 2012, S. 145) Der beschleunigte Muskelabbau, geringere Energieaufnahmen und pro-inflammatorische Zytokine und auch neurotoxische Bestandteile einer Chemotherapie können nebst Immobilität zur Muskelatrophie führen, welche zu einer verschlechterten Gleichgewichtskontrolle und zu Gangunsicherheiten führen kann (vgl. ebd.). Dadurch nimmt eine körperliche Leistungsfähigkeit zunehmend weiter ab, welche es erschwert, Alltagsbelastungen durchzuführen (ebd.). Sensorische und motorische Symptome, z.B. schwächere Muskeleigenreflexe oder Taubheitsgefühle können daraus resultieren (vgl. ebd.). Diese Neurotoxizität führt dazu, dass die Entwicklung eines Therapieplanes hinsichtlich der Bewegungsangebote nur eingeschränkt möglich ist (vgl. Streckmann, 2012, S. 145). Das Sensomotorik- Training soll dabei unterstützen, sensorische Informationen im ZNS verbessert aufnehmen, weiterleiten, verarbeiten sowie umsetzen zu können (vgl. ebd.). Positive Effekte auf neuronale Plastizität konnten dabei bereits durch Studien belegt werden (vgl. ebd.). Walking, Fahrradfahren oder schwimmen stellen dabei mindestens zwei mal pro Woche eine effektive Möglichkeit dar (vgl. Bartsch, Reuss-Borst, 2012, S. 231). Tanztherapie, Yoga oder Tai-Chi können diese ergänzen für ein gesteigertes Körpergefühl und eine verbesserte Koordination (vgl. ebd.). Das Krafttraining kann innerhalb eines Zirkeltrainings, in welchem mehrere Muskelgruppen betätigt werden, zwei bis drei mal pro Woche erfolgen (vgl. ebd.). Die Therapiepläne sollten dabei je nach Leistungsvermögen und anhand eines erstellten Leistungsprofils ausfallen, abhängig auch von kurativer oder palliativer Behandlungsform (vgl. ebd.).
Literaturverzeichnis
Ansorge, S.; Jäger, M. (2022). Rolle des Immunsystems. In: Heinrich, P.C.; Müller, M.; Graeve, L.; Koch, H.G. (Hrsg.) Löffler/Petrides Biochemie und Pathobiochemie. 10, vollst. Überarb. Auflage, Berlin: Springer.
Bartsch, H.H.; Reus - Borst, M. (2012). Körperliche Aktivitäten in der onkologischen Rehabilitation. Trainingsempfehlungen. In: Baumann, F.T.; Jäger, E.; Bloch, W. (Hrsg.) Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie. Berlin: Springer.
Birbaumer, N.; Schmidt, R. F. (1996). Biologische Psychologie. 3. komplett überarbeitete Auflage. Berlin: Springer.
Bouillet T, Bigard X, Brami C, Chouahnia K, Copel L, Dauchy S, Delcambre C, Descotes JM, Joly F, Lepeu G, Marre A, Scotte F, Spano JP, Vanlemmens L, Zelek L. Role of physical activity and sport in oncology: scientific commission of the National Federation Sportand CancerCAMI. Crit Rev Oncol Hematol. 2015Apr;94(1):74-86.
Braus, D.F. (2004). EinBlick ins Gehirn. Eine andere Einführung in die Psychiatrie, Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
Browall M, Mijwel S, Rundqvist H, Wengström Y. Physical Activity During and After Adjuvant Treatment for Breast Cancer: An Integrative Review of Women's Experiences. IntegrCancerTher. 2018 Mar;17(1):16-30.
Chen, X.; Wang, M.; Yu, K.; Yu, S.; Qiu, P.; Lyu, Z.; (...). (2021). Chronic stress- induced immune dysregulation in breast cancer: Implications of psychosocial factors. Journal ofTranslational Internal Medicine , De Gruyter Open Access 5. März 2022.
Cramer, H.; Haller, H.; Paul, A.; Dobos, G. (2017). Mind-Body-Medizin bei Krebs. Wissenschaftliche Evidenz, Chancen und Grenzen der Wirksamkeit. FORUM 2017 ■ 32:406-410
Ehlert, U. Das endokrine System. (2011). In: Ehlert, U.; von Känel, R. (Hrsg.) Psychoendokrinologie und Psychoimmunologie, Berlin: Springer.
Erdmann, A.; Erdmann, U.; Martens, A.; Müller, O.; Paul, A. (2005) Neurobiologie. Neurophysiologie und Verhalten. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage.
Ermann, M. (2007). Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ein Lehrbuch auf psychoanalytischerGrundlage. 5., überarbeiteteAuflage. Stuttgart: Kohlhammer.
Fries, E.; Kirschbaum, C. (2009). Chronischer Stress und stressbezogene Erkrankungen. In: Wippert, P-M.; Beckmann, J. (Hrsg.) Stress- und Schmerzursachen verstehen. Gesundheitspsychologie und -soziologie in Prävention und Rehabilitation. Stuttgart:Georg Thieme Verlag KG.
Grassi, L. (2020). Psychiatric and psychosocial impflications in cancer care: the agenda of psycho-oncology. Epidemiology and Psychiatric Sciences , Volume 29 , 2020 , e89
Gosain, R.; Gage-Bouchard, E.; Ambrosone, C.; Repasky, E.; Gandhi, S. (2020). Stress reduction strategies in breast cancer: review of pharmacologic and non- pharmacologicbasedstrategies. Semin Immunopathol. 2020 Dec;42(6):719-734.
Heckl, U.; Singer, S.; Sickert, M.; Weis, J. (2011). Aktuelle Versorgungsstrukturen in der Psychoonkologie. Nervenheilkunde 2011; 30: 124-130.
Hefner, J.; Csef, H. (2017). Psychoneuroimmunologie und Krebs. Neue Ergebnisse zu psychosozialen Einflüssen auf Tumorerkrankungen. Onkologe 2011, 17:839-850.
Heinrich, P.C.; Haan, S.; Hermanns, H.M.; Müller-Newen, G.; Schaper, F. (2022). Klassische Hormone. In: Heinrich, P.C.; Müller, M.; Graeve, L.; Koch, H-G. (Hrsg.) Löffler/Petrides Biochemie und Pathobiochemie, 10. vollst. Überarb. Auflage, Berlin: Springer.
Henderson VP, Clemow L, Massion AO, Hurley TG, Druker S, Hébert JR. (2012). The effects of mindfulness-based stress reduction on psychosocial outcomes and quality of life in early-stage breast cancer patients: a randomized trial. Breast Cancer Res Treat. 2012Jan;131(1):99-109.
Hoffman CJ, Ersser SJ, Hopkinson JB, Nicholls PG. (2012). Harrington JE, Thomas P W. Effectiveness of mindfulness-based stress reduction in mood, breast- and endocrine-related quality of life, and well-being in stage 0 to III breast cancer: a randomized, controlled trial. J Clin Oncol. 2012 Apr 20;30(12):1335-42.
Hsiao, F.; Job, G.; Kua, W.; Chang, K.; Liu, Y.; Ho, R.; Ng, S.; Chan, C.; Lai, Y.; Chen, Y. (2021). The Effects of Psychotherapy on Psychological Well-Being and Diurnal Cortisol Patterns in Breast Cancer Survivors. Psychother Psychosom 2012; 81: 173182 .
Jäger, E.; Bloch, W. (2012). Immunsystem. Körperliche Bewegung und Immunsystem. In: Baumann, F.T.; Jäger, E.; Bloch, W. (Hrsg.) Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie. Berlin: Springer.
Kapfhammer, H.-P. (2015). Psychoonkologie. Differenzieller Versorgungsbedarf zwischenAnspruchundRealität. Nervenarzt2015 ■ 86:255-257, Berlin: Springer.
Kang DW, Fairey AS, Boulé NG, Field CJ, Wharton SA, Courneya KS. A Randomized Trial of the Effects of Exercise on Anxiety, Fear of Cancer Progression and Quality of Life in Prostate Cancer Patients on Active Surveillance. J Urol. 2022 Apr;207(4):814- 822.
Knols, R. (2012). Ausdauertraining. In: Baumann, F.T.; Jäger, E.; Bloch, W. (Hrsg.) Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie. Berlin: Springer.
Kruk, J.; Abou-Enein, B. H.; Bernstein, J.; Gronostaj, M. (2019). Psychological Stress and Cellular Eding in Caner: A Meta-Analysis. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2019, Article ID 1270397, 23 pages, 2019.
Kusch, M.; Labouvie, H.; Hein-Nau, B. (2013). Klinische Psychoonkologie. Berlin: Springer.
Kvillemo P, Bränström R. (2011). Experiences ofa mindfulness-based stress-reduction intervention among patients with cancer. Cancer Nurs. 2011 Jan-Feb;34(1):24-31.
Lengacher, C.A.; Kip, K.E.; Barta, M.; Post-White, J.; Jacobsen, P.B.; Groer, M.; Lehman, B.; Mascoso, M.S.; Kadel, R.; Le, N.; Loftus, L.; Stevens, C.A.; Malafa, M.P.; Shelton, M. (2012). A Pilot Study Evaluating the Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction on Psychological Status, Physical Status, Salivary Cortisol, and Interleukin- 6 Among Advanced-Stage Cancer Patients and Their Caregivers. Journal of Holistic Nursing American Holistic Nurses Association Volume 30 Number 3 September 2012, Pages 170-185 .
Matousek, R. H.; Pressier, J. C.; Dobkin, P. L. (2011). Changes in the cortisol awakening response (CAR) following participation in Mindfulness-Based Stress Reduction in women who completed treatment for breast cancer. Complementary Therapies in Clinical Practice 17 , Pages 65-70 .
Möller, H.-J.; Laux, G.; Kapfhammer, H.-P. (2017). Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, 5. Auflage. Berlin: Springer.
Novack, D.H.; Cameron, O.; Epel, E.; Ader, R.; Waldstein, S.; Levenstein, S.; (...) (2007) Psychosomatic Medicine: The Scientific Foundation of the Biopsychosocial Model. Academic Psychiatry 2007; 31:388-401
Rupprecht, R.; Müller, N. (2011). Psychoneuroimmunologische Grundlagen. In: Möller, H.-J.; Laux, G.; Kapfhammer, H.-P. (Hrsg.). Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie , 4., erw. u. vollst. neu bearb. Auflage, Berlin: Springer.
Schmidt, K., Banzer, W. (2017). Bewegung und onkologische Erkrankungen. In: Banzer, W. (eds) Körperliche Aktivität und Gesundheit. Springer, Berlin, Heidelberg.
Schrepf, A.; Thaker, P.H.; Goodheart, M.J.; Bender, D.; Slavica, G.M.; Dahmoush, L.; Penedo, F.; DeGeest, K.; Mendez, L.; Lubaroff, D.M.; Cole, S.W.; Sood, A.K.; Lutgendort, S.K. (2015). Diurnal cortisol and survival in epithelial ovarian cancer. Psychoneuroendocrinology Volume 53, March 2015, Pages 256-267.
Schüle, K. (2012). Krebs im Überblick. In: Baumann, F.T.; Jäger, E.; Bloch, W. (Hrsg.) Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie. Berlin: Springer.
Schröder, E.; Grimm, S.; Müller, D. (2022). Biologische Psychologie, R., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin: Springer.
Seubert, F. (2020). Tumorwachstum und Expression der Matrixmetalloproteinase-9 in einem orthotopen Pankreaskarzinom-Mausmodell unter der Einwirkung von chronischem Stress. Universität Greifswald: Abteilung für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie der Klinik und Poliklinik für Chirurgie der Universitätsmedizin der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Inaugural - Dissertation.
Schüßler, G.; Brunnauer, A. (2011). Psychologische Grundlagen psychischer Erkrankungen. In: Möller, H.-J.; Laux, G.; Kapfhammer, H.-P. (Hrsg.), Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie . 4., erweiterte und vollständig neu bearbeitete Auflage
Scheff, N.N.; Salomon, J.L. (2021). Neuroimmunology of cancer and associated symtomology. Immunology & Cell Biology 2021; 99: 949-961.
Sender, A. (2017). Skills-Training - ein Baustein im Rehabilitationsprozess. Innere Achtsamkeit. In: Ziffer, F.; Kaiser, E.; Sprung, M, Streibl, L. (Hrsg.) Die Vielgestaltigkeit der Psychosomatik, Berlin: Springer.
Sephton, S.E.; Lush, E.; Desert, E.A.; Floyd, A,R,; Rebholz, W.N.; Dhabhar, F.S.; (...). (2013). Diurnal cortisol rhythm as a predictor of lung cancer survival. Brain, Behavior, and ImmunityVolume 30, Supplement, 15 March 2013, Pages 163-170.
Streckmann, R. (2012). Sensomotorik-Training. In: Baumann, F.T.; Jäger, E.; Bloch, W. (Hrsg.) Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie. Berlin: Springer.
Weis, I.; Wechsung, P. (2002). Psychoonkologische Interventionen. Onkologe 2002 ■ 8[Suppl 1]:S71-S72
Wiskemann, J.; Hedrich, C.; Bannasch, M. (2012). Krafttraining. In: Baumann, F.T.; Jäger, E.; Bloch, W. (Hrsg.) Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie. Berlin: Springer.
Wolf-Kühn, N.; Morfeld, M. (2016). Rehabilitationspsychologie, Wiesbaden: Springer.
Zhang, L.; Pan, J.; Chen, W.; Jiang, J.; Huang, J. Chronic stress-induced immune dysregulation in cancer: implications for initiation, progression, metastasis, and treatment. Am J Cancer Res 2020; 10(5): 1294-1307.
Anhang
Vorstellung verwendeter Literatur
Schöpf et al. stellen 2015 in einer Prospektiven Studie mit 113 Frauen mit Eierstockkrebs den Zusammenhang einer Dysregulation der HPA-Aktivität und einer damit tumorassoziierten Entzündung dar, durch Ergebnisse, welche eine erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit bei Vorliegen eines Cortisolanstiegs bei Eierstockkrebspatientinnen aufwiesen.
Sephton et al. stellen innerhalb einer Prospektiven Studie 2013 62 Männer und Frauen mit Lungenkrebs vor, bei welchen ein gestörter Cortisolrhythmus zu früheren Todesfällen führte. Dabei konnte bewiesen werden, dass ein Tumorwachstum durch zirkadiane Störungen angeregt wurde.
In einer Pilotstudie mit 26 Krebspatienten und ihren Betreuungspersonen wurde durch Lengacher et al. in 2012 der Zusammenhang von psychologischen Interventionen zur Stressreduktion mit der Verminderung der Cortisolausschüttung bei Krebspatienten untersucht. Dabei konnten nach einem 6-wöchigen Selbststudium mit MBSR Verbesserungen hinsichtlich von Ängsten und Stress bewiesen werden. Nach bereits einer Woche lag ein Rückgang der Cortisolproduktion vor.
Zhang et al. stellen 2020 anhand einer Meta-Analyse anhand 165 Studien mit Krebspatienten Physiologische Mechanismen stressvermittelter Immunantworten bei verstärkter Tumorentstehung und verstärktem Tumorwachstum vor. Sie bewiesen dabei, dass die Umverteilung des Immunsystems durch chronischen Stress die Tumorbekämpfungaufhältund Entzündungsprozesse verschlimmert.
In einer Übersichtsarbeit aus Studien mit Krebspatienten stellen Scheff und Salomon in 2021 die Neuroimmunologie von Krebs, die Regulation von Tumorwachstum und die Metastasierung dar, indem die Neuroimmunkommunikation bei der Tumorentstehung u. Die Entwicklung krebsbedingter Veränderungen in neurologischen Prozessen untersucht werden. Dabei konnte erhoben werden, dass Sensorische Nerven das Tumorwachstum und die Metastasierung über hemmen bzw. fördern der Immunsuppression regulieren.
Chen et al. stellen 2021 in einer Übersichtsarbeit aus Studien über Brustkrebspatientinnen Stressinduzierte Immundysregulation bei Brustkrebs und dessen Auswirkungen psychosozialer Faktoren vor. Dabei ergaben ihre Ergebnisse, das Chronischer Stress zu individuellen Unterschieden innerhalb der Prognose von Brustkrebsüberlebenden beiträgt, da physiologische Prozesse des endokrinen - und des Immunsystems das Tumorwachstum regulieren.
In einem Experiment stellte Seubert in 2020 Mäuse mit orthotop implantierten Pankreaskarzinom vor, wobei er eine Verschlechterung der Prognose der Pankreaskarzinome durch chronischen Stress in einer in vivo Untersuchung, durch MRT, der Tumorprogression untersuchte. Die Ergebnisse ergaben dabei ein durch den chronischen Stress induziertes schnelleres Tumorwachstum, welches mit schlechterer Überlebensprognose einherging.
Eine Metaanalyse aus 9 Übersichtsarbeiten und 26 Kohorten/- Fallkontrollstudien mit Krebspatienten von Kruk et al. 2019 stellte aktuelle Erkenntnisse des Zusammenhangs von psychischem Stress, Zellalterungsprozessen und einem Krebsrisiko dar. Insgesamt sollten psychosoziale und verhaltensbezogene Faktoren des Krebsrisikos, des Fortschreitens und der Mortalität erhoben werden. Dabei konnten keine konsistenten Belege für psychischen Stress und das Krebsrisiko, allerdings Belege für psychischen Stress und Auswirkungen auf Krebswachstum, Metastasierung und Alterungsprozesse gefunden werden.
Gosain et al. bearbeiten 2020 mithilfe eines Review aus Forschungsarbeiten Stress als Prädiktor für Fortschreiten der Krankheit, Wirksamkeit von Interventionen zur Stressreduktion, u.a. mit einem Bericht über achtsamkeitsbasierte Ansätze in der Onkologie. Sie erheben, dass die Effekte als verbessernde, stressreduzierende Ansatze vorliegen. Sie bemängeln, dass jedoch keine Belege über relative Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Ansätze im Vergleich mit anderen Interventionen vorliegen.
In semistrukturierten Interviews mit 18 Krebspatienten erheben Kvillemo und Bränström in 2011 innerhalb eines 8-wöchigem Achtsamkeitsprogramms für Krebspatienten die wahrgenommenen Auswirkungen durch Achtsamkeitstraining zur Stressreduktion. Insgesamt konnte dabei die Wirksamkeit der Intervention nur teilweise seitens der Patienten bestätigt werden.
Henderson et al. untersuchten 2012 innerhalb einer randomisierten Kontrollstudie mit 172 Brustkrebspatientinnen ein Achtsamkeitsprogramm für Frauen mit Brustkrebs im Frühstadium innerhalb eines 8-wöchigem MBSR-Programms. Dieses ergab Verbesserungen von psychischen Problemen sowie starke Verbesserung der psychosozialen Anpassung. Die Universalität der Wirksamkeit konnte bestätigt werden.
Hoffmann et al. konnten 2012 innerhalb einer randomisierten Kontrollstudie mit 229 Brustkrebspatientinnen statistisch signifikante Verbesserungen in Bezug auf emotionales und soziales und Verbesserung physisch seitens der Nebenwirkungen durch ein MBSR Programm für Brustkrebspatientinnen im Stadium 0 - III, welches im Rahmen eines 8-wöchigen MBSR-Programm nach OP, Chemo - u. Strahlentherapie durchgeführt wurde, erheben.
In einem Review über die Erhebung adjuvanter Therapieprogramme mit körperlicher Aktivierung während und nach der Krebsbehandlung von Brustkrebspatientinnen erheben Browall et al. in 2018 die Verbesserung und Wiederherstellung der Gesundheit durch adjuvantes Therapieprogramm mit körperlicherAktivität.
Bouillet et al. stellt 2015 innerhalb eines Reviews die Wechselwirkungen von körperlicher Aktivität und Sport während und nach der Krebsbehandlung mit dem Ziel der Verbesserung physiologischer und psychischer Parameter vor und erhebt dabei, dass ein Zusammenhang zwischen Sport und dem Mortalitätsrisiko bei Krebs ersichtlich ist, biologisch und klinischjedoch weiterhin offene Fragen bestehen.
Eine randomisierte Studie von Kang et al. mit 52 Männern mit Prostatakrebs widmet sich 2022 den Auswirkungen von Bewegung auf die Lebensqualität und psychosozialen Folgen bei Prostatakrebs innerhalb eines 12-wöchiges Intervalltrainings für Krebspatienten mit Kontrollgruppe. Dabei konnte erhoben werden, dass das Intervalltraining Angstsymptomatiken sowie Stress vermindert und die Lebensqualität erhöht.
Diagnostik in der Psychoonkologie
Das Distress-Thermometer
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
(Vgl. Wolf-Kühn; Morfeld, 2016, S. 148)
Häufig gestellte Fragen zu: Language Preview
Was ist der Inhalt dieser Language Preview?
Diese Language Preview enthält das Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, ein Glossar, sowie Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Die Kapitel umfassen eine Ausgangslage, theoretische Grundlagen (Immunsystem, endokrines System, Stress), Psychoonkologie, methodisches Vorgehen, Ergebnisse (psychosozialer Disstress und Entzündungsprozesse, Auswirkungen immunologischer Dysregulationen, Auswirkungen psychologischer Interventionen), eine Schlussfolgerung und Handlungsempfehlungen.
Was sind die theoretischen Grundlagen, die in dieser Arbeit behandelt werden?
Die Arbeit behandelt das Immunsystem, das endokrine System und Stress. Sie beleuchtet die Interaktion von Psyche, vegetativem Nervensystem, endokrinem System und Immunsystem bei Stress, sowie die Bedeutung von Stressoren für das Hormonsystem.
Was ist Psychoonkologie und welche Rolle spielt sie?
Psychoonkologie ist eine Subdisziplin der Onkologie, die sich mit den emotionalen Reaktionen von Patienten und ihren Angehörigen auf Krebserkrankungen befasst. Sie integriert psychologische, verhaltensbezogene und soziale Faktoren in den Krankheits- und Behandlungskontext. Die psychosomatische Medizin spielt eine wichtige Rolle, indem sie die Wechselwirkungen zwischen psychosozialen und körperlichen Vorgängen in der Entstehung, im Verlauf und in der Behandlung von Krankheiten betrachtet.
Welche methodischen Vorgehensweisen werden in der Arbeit beschrieben?
Die Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturanalyse, durchgeführt mithilfe der Datenbanken „SpringerLink“ und „PubMed“. Die Suche umfasste den Zeitraum von 2011 bis 2023, wobei relevante Studien und Übersichtsarbeiten anhand von Schlüsselwörtern wie "Krebs und Neurowissenschaften", "Psychoendokrinologie und Krebs", "Hormone und Krebs" identifiziert und hinsichtlich ihrer Validität, Anwendbarkeit, Reliabilität und Studiengröße bewertet wurden.
Welche Ergebnisse werden in Bezug auf psychosozialen Disstress und Entzündungsprozesse bei Krebs dargestellt?
Die Ergebnisse zeigen, dass psychosozialer Disstress und chronischer Stress immunologische Dysregulationen auslösen können, die das Tumorwachstum beeinflussen. Es wird auf die Bedeutung von Stresshormonen (Katecholamine) und Zytokinen im Tumormilieu hingewiesen und der Einfluss von sozialer Unterstützung auf die VEGF-Konzentrationen im Serum betont.
Welche Auswirkungen haben psychologische Interventionen?
Psychologische Interventionen, wie z.B. körperliche Aktivität und Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR), können positive Auswirkungen auf Stressreduktion und die Lebensqualität von Krebspatienten haben. Körperliche Aktivität kann die Freisetzung von Zytokinen durch die Skelettmuskulatur beeinflussen und somit das Immunsystem regulieren. MBSR-Programme können die Cortisolausschüttung verringern und zur Normalisierung der HPA-Achse führen.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Es wird empfohlen, frühzeitig psychoonkologische Interventionen, wie MBSR und regelmäßige körperliche Aktivität, in die onkologische Behandlung zu integrieren, um Stress zu bewältigen, die Lebensqualität zu verbessern und möglicherweise die Prognose positiv zu beeinflussen. Dabei sollte eine psychosoziale Betreuung in einem unterstützenden Umfeld gewährleistet sein.
- Arbeit zitieren
- Svenja Lippert (Autor:in), 2023, Stressinduziertes Tumorwachstum durch psychoendokrinologische und psychoneuroimmunologische Dysregulationen und die Bedeutung der Psychoonkologie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1459318