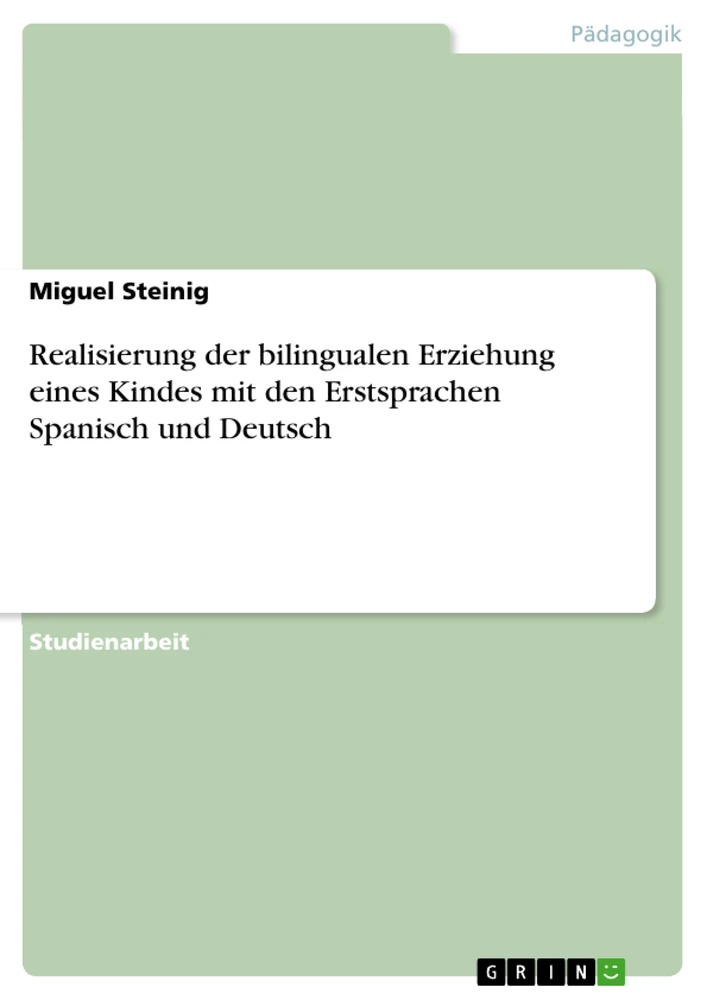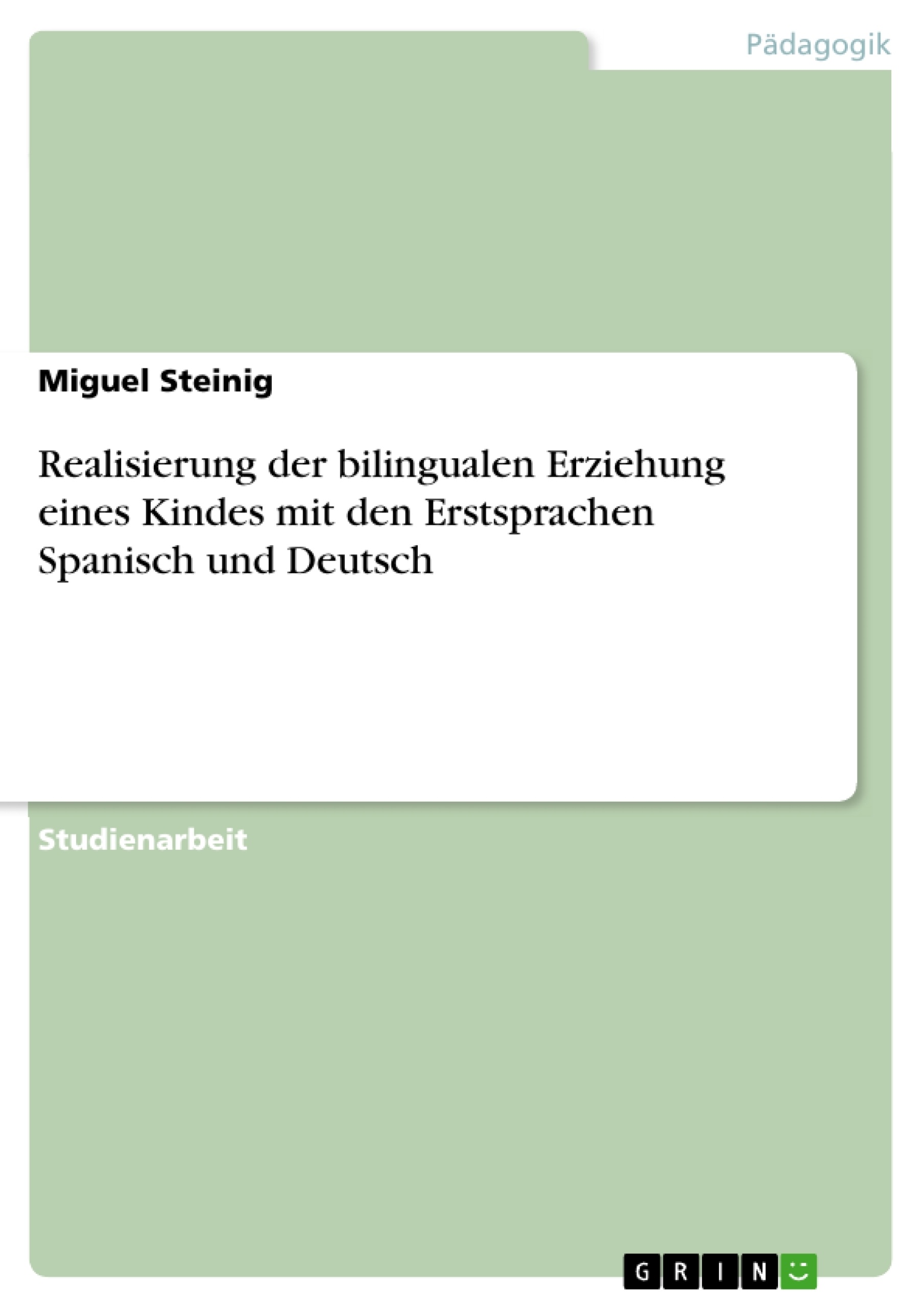Bereits seit einigen Jahren wird auf nationaler sowie auf europäischer Ebene der Mehrsprachigkeit eine besondere Relevanz zugesprochen. So zum Beispiel verpflichtet die Verfassung von Indien aus dem Jahre 1961 die Bürger dazu mindestens drei Sprachen zu beherrschen, einmal die autochthone, die Indische Landessprache und eine für die Internationale Kommunikation. Aus diesem Grund könnte Indien als internationales Beispiel für die europäische Ebene gelten.
Gerade durch die Regelungen der Europäischen Union und des Europarats durch das „Weißbuches zur allgemeinen und beruflichen Bildung“ (1995), dem „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen“ (2001) und den neuen Rahmenstrategien für Mehrsprachigkeit (2005) gibt es immer mehr Bestrebungen, die Mehrsprachigkeit zu fördern. In einer globalisierten Welt ist das Ziel des multilingualen Kontinents, diese Sprachenvielfalt zu bewahren und auch weiter auszubauen, sodass ein gegenseitiges Verständnis und ein friedliches Zusammenleben und die Internationalisierung der Berufswelt ermöglicht wird.
Aus diesem Grund möchte die EU seit 1995 erreichen, dass jeder EU-Bürger neben seiner Muttersprache zwei weitere Fremdsprachen beherrscht. Doch trotz des polyglotten Sprachangebotes des multilingualen Staatenverbundes verfügen die Bürger nur über eine geringe mehrsprachige Kompetenz, denn fast die Hälfte (44%) der EU-Bürger sprechen neben ihrer Muttersprache keine weitere Fremdsprache. Um diese Sprachenvielfalt zu bewahren, geht es darum, die Mehrsprachigkeit schon bereits im Kindesalter vor allem in der Schule zu fördern, sodass ich diese Thematik im Kapitel 3.4 mithilfe der Methoden der Mehrsprachigkeitsdidaktik genauer thematisieren werde. Also wird das inhaltliche Ziel dieses Teils der Arbeit auf die Umsetzung und Förderung von Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht gelegt. Doch bevor dies geschieht, ist es erst einmal wichtig, die theoretischen Grundlagen für das Verständnis in Kapitel 2 darzulegen und näher auf die Definition von Erstsprache, Zweitsprache, Mehrsprachigkeit und Bilingualismus einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführen zur Thematik
- Theoretische Grundlagen
- Definition Erstsprache und Muttersprache
- Definition Zweitsprache
- Definition Mehrsprachigkeit, Bilingualismus und früher Zweitspracherwerb
- Bilinguale Spracherziehung
- Altersfrage
- Familiäre Aspekte und Status der Eltern
- Modelle und Methoden im Alltag
- Wie realisiert man die bilinguale Erziehung eines Kindes?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik des bilingualen Erstspracherwerbs eines Kindes mit den Erstsprachen Deutsch und Spanisch. Sie analysiert die soziokulturellen und linguistischen Faktoren, die diesen Erwerb beeinflussen, und beleuchtet verschiedene Modelle und Methoden, die in der Praxis Anwendung finden.
- Definition und Abgrenzung der Fachtermini "Erstsprache", "Zweitsprache", "Mehrsprachigkeit" und "Bilingualismus"
- Analyse der soziokulturellen Bedingungen für den bilingualen Erstspracherwerb, insbesondere der Rolle der Eltern und der Familiensprache
- Einleitung verschiedener Modelle und Methoden zur Förderung des bilingualen Erstspracherwerbs im Alltag
- Die Herausforderungen und Chancen des bilingualen Erstspracherwerbs
- Die Relevanz der Mehrsprachigkeit in einer globalisierten Welt und die Bedeutung der Förderung der Mehrsprachigkeit im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des bilingualen Erstspracherwerbs ein und erläutert die wachsende Bedeutung der Mehrsprachigkeit in der heutigen Zeit. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Konzepts der Mehrsprachigkeit und die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen, die die Förderung von Mehrsprachigkeit auf nationaler und internationaler Ebene vorantreiben.
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis des bilingualen Erstspracherwerbs. Es definiert die wichtigsten Fachtermini wie "Erstsprache", "Zweitsprache", "Mehrsprachigkeit" und "Bilingualismus". Diese Definitionen sind für das Verständnis der weiteren Ausführungen der Arbeit von großer Bedeutung.
In den Kapiteln 3.1 bis 3.3 werden die soziokulturellen Aspekte des bilingualen Erstspracherwerbs in der Familie untersucht. Es werden die Auswirkungen des Alters des Kindes, der familiären Bedingungen und des sozialen Status der Eltern auf den Erwerb der beiden Erstsprachen analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen des bilingualen Erstspracherwerbs, der Mehrsprachigkeit, der Familiensprache, der soziokulturellen Faktoren, der Sprachentwicklung, der Erziehungspraxis und der Förderung von Mehrsprachigkeit im Bildungssystem.
- Arbeit zitieren
- Miguel Steinig (Autor:in), 2018, Realisierung der bilingualen Erziehung eines Kindes mit den Erstsprachen Spanisch und Deutsch, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1457231