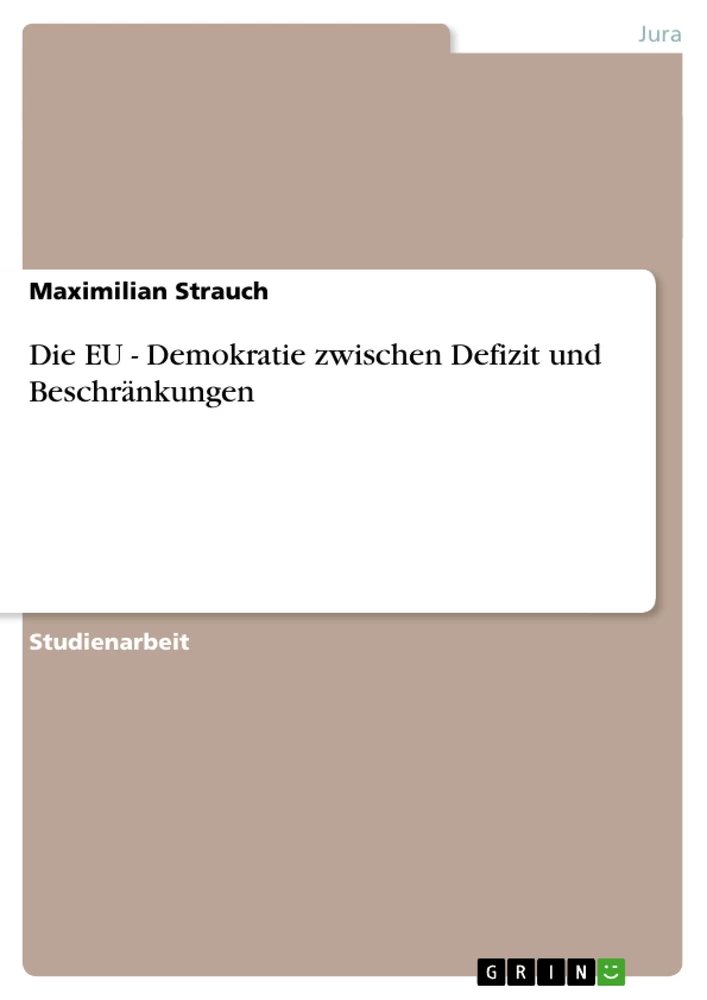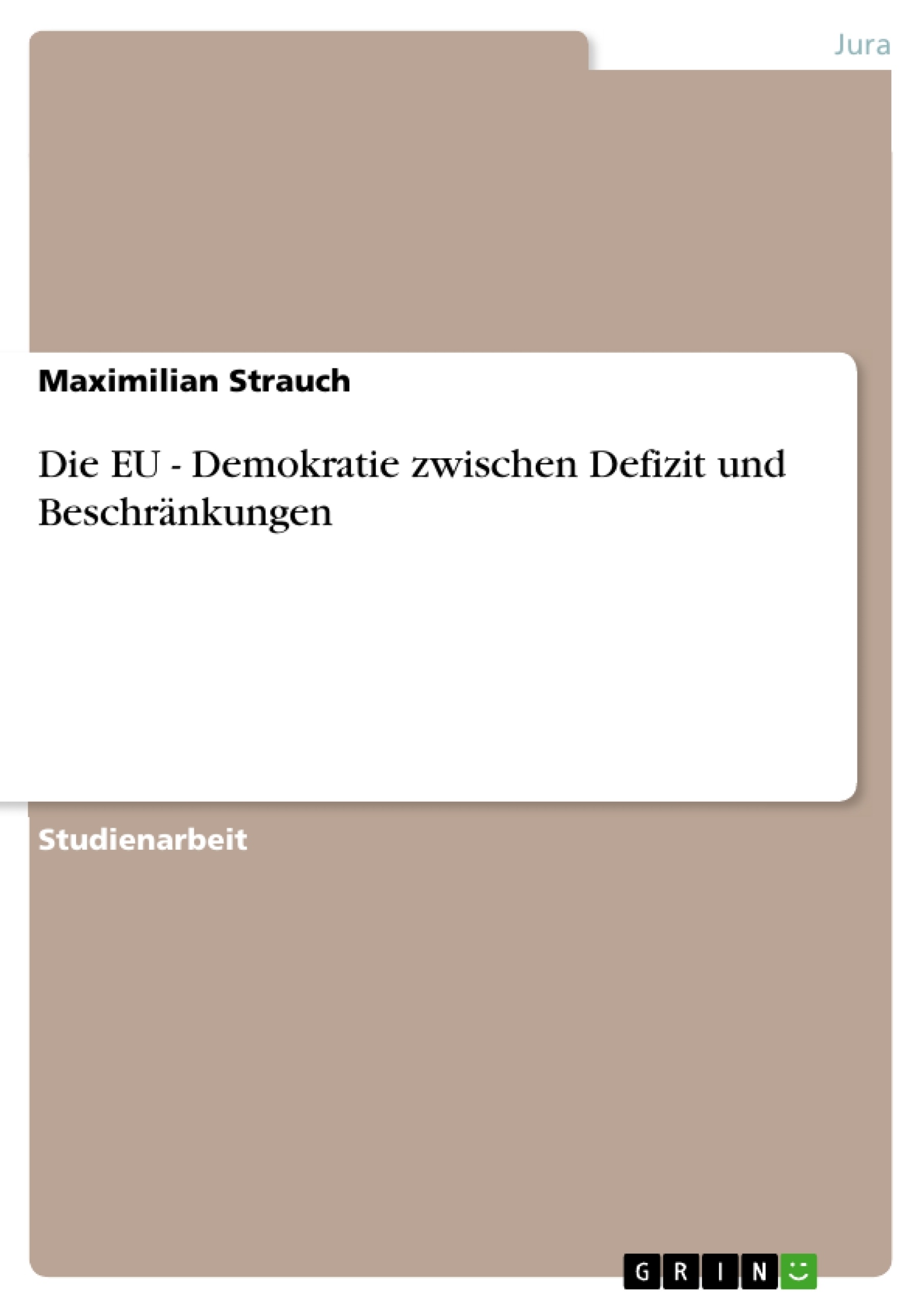Seit Beginn des Prozesses zu einem geeinten Europa mit der Ratifizierung der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahr 1951 und Entstehen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) durch Abschluss der so genannten „Römischen Verträge“ (1957) hat die komplexe Vernetzung der Wirtschaft und Politik der Mitgliedsländer stetig zugenommen. Stand anfangs noch die Schaffung eines geordneten europäischen Marktes im Vordergrund, lässt sich nicht zuletzt durch einen Vergleich der Präambeln des EWGV und des EUV das Bestreben feststellen, das innereuropäische Zusammenwachsen über eine gemeinsame Wirtschaftspolitik hinaus auf beinahe jeden Bereich des täglichen Lebens auszuweiten. Ihren Höhepunkt fand diese Entwicklung in der gescheiterten gemeinsamen EU-Verfassung, welche nun über die Verträge von Lissabon (13.12.2007) in abgemilderter Form trotzdem Ihren Einzug in Europa erhält – der Begriff der Verfassung schien doch zu sehr zu verdeutlichen, was längst an der Tagesordnung ist: die EU als supranationales Organ der Staaten hat durch zahlreiche übertragene Kompetenzen schon lange intensiven Einfluss auf die Politik der Nationalstaaten, welche sich diesem maximal durch Vertragsbruch entziehen können. Faktisch resultiert daraus ein Über-Unterordnungsverhältnis; im Spezialfall Deutschland verdeutlichte das BVerfG dies mit der Entscheidung „Solange II“, wonach der EuGH geeignet ist, den Grundrechtsschutz der Bundesbürger sicherzustellen – was der Bedeutung einer Legitimation der damit kontrollierten EU-Politik und ihres Einflusses auf Deutsches Recht gleichkommt. Bekräftigt wurde dies in der „Bananenmarktentscheidung“ des BVerfG, welche präzisiert, dass jedweder Ausbruch aus geltendem Europarecht mit Berufung auf die Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland nur erfolgen kann, wenn im gleichen Zug nachgewiesen werden kann, dass die „europäische Rechtsentwicklung […] unter den erforderlichen Grundrechtsstandard abgesunken sei“. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Legitimation der europäischen Organe, ihrer Arbeit untereinander, sowie den verschiedenen Einflussmöglichkeiten der EU auf die Nationalstaaten. Die Definition des Demokratiebegriffs soll dafür im Zusammenhang mit dem „Widerspruch zwischen einem Demokratiedefizit der EU und der sehr engen Verbindung der EU mit der größten Blütezeit der Demokratie in Europa“ erörtert werden, besonderes Augenmerk liegt dabei auf der BRD.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Grundlagen
- A. Der Demokratiebegriff
- B. Organe und Kompetenzen der Europäischen Union
- 1. Europäischer Rat
- 2. Rat der Europäischen Union – „Ministerrat“
- 3. Europäische Kommission
- 4. Europäisches Parlament
- 5. Europäischer Gerichtshof
- III. Hauptteil
- A. Probleme der Legitimation
- 1. Gleichheit der Wahlen
- 2. Gleichheit der Länder
- 3. Eskalierte Kompetenzen
- B. Arbeit der Organe bei Entscheidung & Durchsetzbarkeit
- 1. Europäischer Rat
- 2. Rat der Europäischen Union - „Ministerrat“
- 3. Europäische Kommission
- 4. Europäisches Parlament
- 5. Europäischer Gerichtshof
- IV. Zusammenfassung
- A. Aktuelle Situation
- B. Ein Ausblick und mögliche Lösung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Legitimation der europäischen Organe, ihre Zusammenarbeit und den Einfluss der EU auf die Nationalstaaten. Im Mittelpunkt steht die Erörterung des Demokratiebegriffs im Kontext des vermeintlichen Demokratiedefizits der EU und ihrer engen Verbindung zur Blütezeit der Demokratie in Europa, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland.
- Der Demokratiebegriff und seine Anwendung auf die EU
- Die Organe der EU und ihre jeweiligen Kompetenzen
- Probleme der Legitimation der EU-Organe
- Der Entscheidungsprozess und die Durchsetzbarkeit von EU-Recht
- Der Einfluss der EU auf die Nationalstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Prozess der europäischen Integration seit 1951 und die zunehmende Vernetzung von Wirtschaft und Politik der Mitgliedsstaaten. Sie hebt das Bestreben hervor, das innereuropäische Zusammenwachsen über eine gemeinsame Wirtschaftspolitik hinaus auszuweiten, und erwähnt die gescheiterte EU-Verfassung und den Vertrag von Lissabon. Der Fokus liegt auf dem Über-Unterordnungsverhältnis zwischen der EU und den Nationalstaaten, verdeutlicht durch die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts „Solange II“ und die „Bananenmarktentscheidung“. Die Arbeit befasst sich mit der Legitimation der europäischen Organe, ihrer Arbeit und dem Einfluss der EU auf die Nationalstaaten, wobei der Demokratiebegriff im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Demokratiedefizit der EU erörtert wird.
II. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die spätere Analyse. Teil A definiert den Demokratiebegriff, unterscheidet zwischen direkter und repräsentativer Demokratie und betont die Bedeutung von Volksherrschaft und Kontrolle der Repräsentanten durch das Volk. Teil B beschreibt die wichtigsten Organe der EU (Europäischer Rat, Rat der Europäischen Union, Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Europäischer Gerichtshof) und erläutert ihre jeweiligen Kompetenzen und die Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der EU.
III. Hauptteil: Der Hauptteil analysiert zunächst die Probleme der Legitimation der EU, indem er auf die Gleichheit der Wahlen, die Gleichheit der Länder und die eskalierten Kompetenzen eingeht. Im zweiten Teil wird die Arbeitsweise der einzelnen EU-Organe bei der Entscheidungsfindung und Durchsetzung von Rechtsakten detailliert untersucht. Dieser Teil beleuchtet die Interaktion der Organe und die Herausforderungen bei der Umsetzung von Entscheidungen.
Schlüsselwörter
EU-Demokratie, Legitimation, Europäische Organe, Kompetenzen, Entscheidungsfindung, Durchsetzbarkeit, Nationalstaaten, Demokratiedefizit, Bundesverfassungsgericht, Vertrag von Lissabon, Grundrechte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Legitimation der Europäischen Organe
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Legitimation der europäischen Organe, ihre Zusammenarbeit und den Einfluss der EU auf die Nationalstaaten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Demokratiebegriff im Kontext des vermeintlichen Demokratiedefizits der EU und ihrer Verbindung zur Entwicklung der Demokratie in Europa.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Demokratiebegriff und seine Anwendung auf die EU; die Organe der EU und ihre Kompetenzen; Probleme der Legitimation der EU-Organe; den Entscheidungsprozess und die Durchsetzbarkeit von EU-Recht; sowie den Einfluss der EU auf die Nationalstaaten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Grundlagen, Hauptteil und Zusammenfassung. Die Einleitung beschreibt die europäische Integration und den Fokus der Arbeit. Die Grundlagen definieren den Demokratiebegriff und stellen die EU-Organe vor. Der Hauptteil analysiert die Legitimationsprobleme und die Arbeitsweise der Organe. Die Zusammenfassung fasst die aktuelle Situation zusammen und gibt einen Ausblick.
Was sind die zentralen Probleme der Legitimation der EU?
Die Arbeit identifiziert die Gleichheit der Wahlen, die Gleichheit der Länder und die eskalierten Kompetenzen als zentrale Probleme der Legitimation der EU.
Wie arbeiten die EU-Organe zusammen?
Der Hauptteil beschreibt detailliert die Arbeitsweise des Europäischen Rates, des Rates der Europäischen Union, der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und des Europäischen Gerichtshofs bei der Entscheidungsfindung und Durchsetzung von Rechtsakten, inklusive der Interaktion zwischen den Organen und den Herausforderungen bei der Umsetzung von Entscheidungen.
Welche Rolle spielt der Demokratiebegriff?
Der Demokratiebegriff wird im Kontext des vermeintlichen Demokratiedefizits der EU erörtert. Es wird zwischen direkter und repräsentativer Demokratie unterschieden, und die Bedeutung von Volksherrschaft und Kontrolle der Repräsentanten wird hervorgehoben.
Welche Bedeutung haben die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts?
Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere „Solange II“, werden im Kontext des Über-Unterordnungsverhältnisses zwischen der EU und den Nationalstaaten erwähnt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: EU-Demokratie, Legitimation, Europäische Organe, Kompetenzen, Entscheidungsfindung, Durchsetzbarkeit, Nationalstaaten, Demokratiedefizit, Bundesverfassungsgericht, Vertrag von Lissabon, Grundrechte.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Legitimation der europäischen Organe, ihre Zusammenarbeit und den Einfluss der EU auf die Nationalstaaten. Sie zielt darauf ab, den Demokratiebegriff im Kontext des vermeintlichen Demokratiedefizits der EU zu erörtern.
Gibt es einen Ausblick?
Die Zusammenfassung enthält einen Ausblick und mögliche Lösungsansätze für die identifizierten Probleme.
- Arbeit zitieren
- Maximilian Strauch (Autor:in), 2008, Die EU - Demokratie zwischen Defizit und Beschränkungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/145180