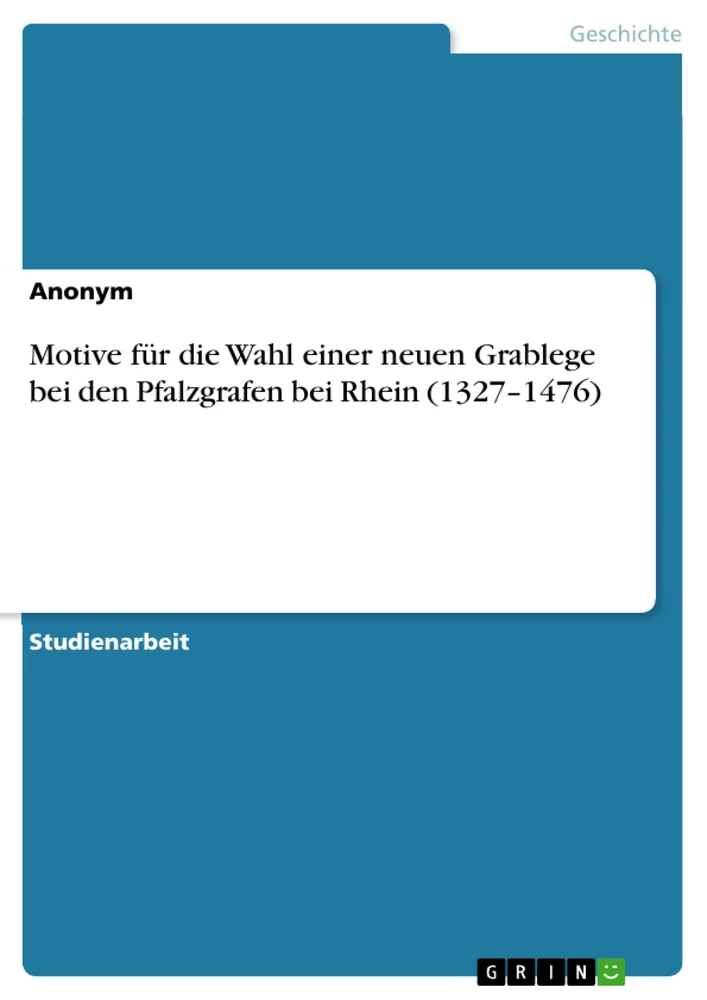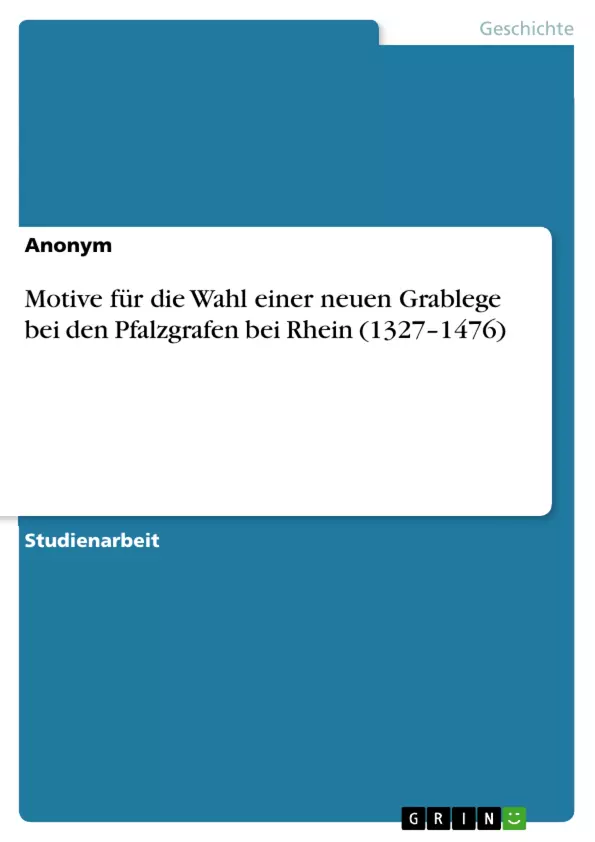Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Grablegen der Pfalzgrafen bei Rhein. Der Schwerpunkt liegt auf der Wahl der Grablege und ob diese aufgrund von persönlichen Vorlieben, des Zeitgeists oder um sich zu legitimieren ausgewählt wurde. Die betrachteten Grablegen sind das Zisterzienserkloster Schönau, die Stiftskirche St. Ägidius in Neustadt an der Weinstraße, die Heiliggeistkirche in Heidelberg und das Franziskanerkloster in Heidelberg.
Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die Pfalzgrafen bei Rhein Adolf, Rudolf II., Ruprecht III. und Friedrich der Siegreiche, da sie eine neue Grablege begründeten. Auf weitere Aspekte im Zusammenhang mit dem Tod von Hochadligen wie dem Stiftungsverhalten, den Testamenten, dem Sterben, dem Begräbnis und dem Begängnis wird nur Bezug genommen, sofern sie weitere Erkenntnisse für die Wahl der Grablege bringen. Den zeitlichen Rahmen bilden die Sterbedaten der Pfalzgrafen Adolf im Jahr 1327 und Friedrich im Jahr 1476. Pfalzgraf Adolf war der erste Wittelsbacher, der sich auf dem Territorium der Pfalzgrafschaft und nicht in Bayern begraben ließ und damit ein Novum wagte. Die betrachtete Zeitspanne endet mit dem Jahr 1476, da in diesem Jahr Friedrich der Siegreiche sich in dem Franziskanerkloster Heidelberg begraben ließ. Er ist deshalb der letzte Pfalzgraf, der eine neue Grablege vor Beginn der Reformation wählte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Motive bei der Wahl der Grablege
- Pfalzgraf Adolf (1300–1327)
- Pfalzgraf Rudolf II. (1306–1353)
- Pfalzgraf Ruprecht III. (1352–1410)
- Pfalzgraf Friedrich der Siegreiche (1425-1476)
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Wahl der Grablegen der Pfalzgrafen bei Rhein im Zeitraum von 1327 bis 1476. Ziel ist es, die Motive hinter diesen Entscheidungen zu erforschen und zu untersuchen, ob sie von persönlichen Präferenzen, dem Zeitgeist oder dem Wunsch nach Legitimation beeinflusst wurden.
- Die Rolle von persönlichen Vorlieben bei der Wahl der Grablege
- Der Einfluss des Zeitgeists auf die Grablege-Entscheidungen
- Die Bedeutung der Grablege für die Legitimation der Pfalzgrafen
- Die verschiedenen Grablegen der Pfalzgrafen: Zisterzienserkloster Schönau, Stiftskirche St. Ägidius, Heiliggeistkirche und Franziskanerkloster
- Die Beziehung zwischen den Pfalzgrafen und den jeweiligen Klöstern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und erläutert den Fokus der Untersuchung auf die Grablegen der Pfalzgrafen bei Rhein. Das Kapitel stellt die betrachteten Grablegen vor und benennt die wichtigsten Akteure: Adolf, Rudolf II., Ruprecht III. und Friedrich der Siegreiche.
Kapitel 2 untersucht die Motive der Pfalzgrafen bei der Wahl ihrer Grablegen. Es wird auf die Quellenlage eingegangen und die politischen und religiösen Umstände der jeweiligen Zeit beleuchtet.
Kapitel 2.1 analysiert die Wahl des Pfalzgrafen Adolf, des ersten Wittelsbachers, der sich nicht in Bayern, sondern in der Pfalz begraben ließ. Das Kapitel untersucht die politische Situation zu Adolfs Zeit und argumentiert, dass die Wahl seiner Grablege im Zisterzienserkloster Schönau mit seinem Bestreben nach Loslösung von Bayern zusammenhing.
Kapitel 2.2 beleuchtet die Grablege-Entscheidung von Rudolf II. und erörtert, wie seine Wahl der St. Ägidius Kirche in Neustadt an der Weinstraße mit der Trennung in eine pfälzische und eine bayrische Wittelsbacher-Linie zusammenhing. Das Kapitel betrachtet auch die politische und wirtschaftliche Situation der Pfalzgrafschaft zu Rudolfs Zeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Grablege der Pfalzgrafen bei Rhein im Spätmittelalter, insbesondere mit den Motiven der Wahl der Grablege. Zentrale Themen sind die Beziehung zwischen den Pfalzgrafen und den Klöstern, die politische und wirtschaftliche Situation der Pfalzgrafschaft, die Trennung der pfälzischen und bayrischen Wittelsbacher-Linie und die Legitimation der Herrschaftsansprüche der Pfalzgrafen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Motive für die Wahl einer neuen Grablege bei den Pfalzgrafen bei Rhein (1327–1476), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1449222