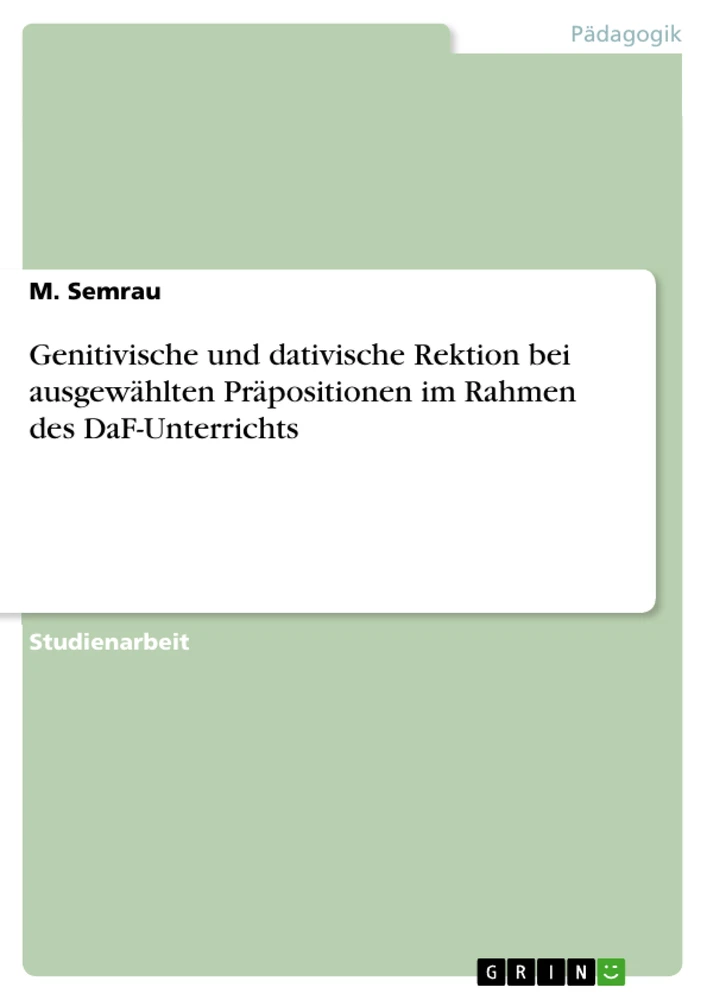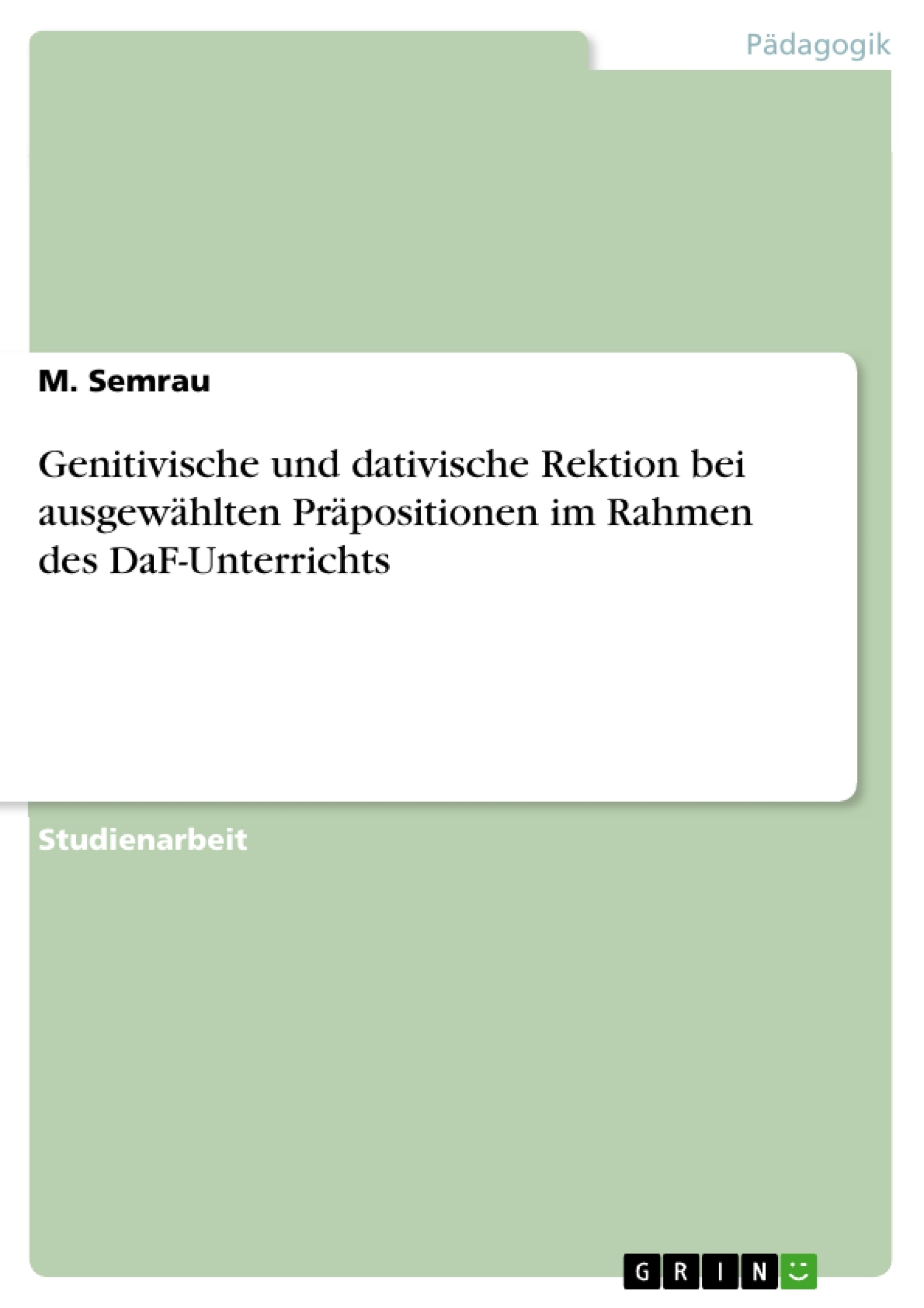Welche Kasusrektion wird bei bestimmten Präpositionen von DaF-Lernenden bevorzugt?
Auf welche Schwierigkeiten stoßen die Lernenden dabei?
Anhand welcher Kriterien bewertet die Deutschlehrkraft die gewählten Variationen?
Diese wissenschaftliche Auseinandersetzung setzt sich mit semantisch irrelevanten Rektionsschwankungen bei zehn ausgewählten Präpositionen auseinander und legt dabei den Fokus auf die Kasuswahl zwischen Dativ und Genitiv.
Das deutsche Kasussystem und die damit verbundene Kasuswahl führt bereits bei den meisten Muttersprachler*innen zu Unsicherheiten und stellt häufig einen Zweifelsfall dar. Auch beim Fremdspracherwerb ist die Kasuswahl eines der herausforderndsten Teilgebiete der deutschen Grammatik. Dieser Herausforderung müssen sich nicht nur Lernende, sondern auch Lehrende stellen, die bei der Vermittlung des Kasussystems oft didaktische Unsicherheiten aufweisen. Der Einfluss der Erstsprache scheint ebenfalls eine wichtige Rolle zu spielen, da manche Sprachen in struktureller Hinsicht dem Deutschen ähnlicher sind als andere, die kein oder ein stark reduziertes Kasussystem vorweisen, wie z.B. das Französische.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1. Die Komplexität der Standardnorm
- 3. Empirie
- 3.1. Eigene Korpusrecherche
- 3.1.1. Ergebnisse aus dem Deutschen Referenzkorpus
- 3.2. Untersuchung bei DaF-Lernenden
- 3.2.1. Methode und Durchführung
- 3.2.2. Kurz-Interviews mit einer Deutschlehrkraft
- 3.2.3. Analyse und Auswertung der Schülerergebnisse
- 3.1. Eigene Korpusrecherche
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Kasuswahl zwischen Dativ und Genitiv bei ausgewählten Präpositionen im DaF-Unterricht, insbesondere die „semantisch irrelevanten Rektionsschwankungen“. Ziel ist es, anhand von Korpusrecherchen und empirischen Daten von französischsprachigen Lernenden das Verhältnis dativischer und genitivischer Rektion zu erforschen und Einflussfaktoren zu identifizieren. Die Arbeit befasst sich mit den Schwierigkeiten von DaF-Lernenden im Umgang mit dem deutschen Kasussystem und der Bewertung dieser Variationen durch Lehrkräfte.
- Kasusrektion bei Präpositionen im Deutschen
- Schwierigkeiten von DaF-Lernenden im Umgang mit dem deutschen Kasussystem
- Einfluss der Erstsprache auf die Kasuswahl
- Bewertung von Kasusvariationen durch Deutschlehrkräfte
- Didaktische Implikationen für den DaF-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des Kasus im Deutschen, insbesondere für DaF-Lernende, dar. Sie hebt die Schwierigkeiten der Kasuswahl hervor, sowohl bei Muttersprachlern als auch bei Lernenden, und betont den Einfluss der Erstsprache. Die Arbeit konzentriert sich auf die semantisch irrelevanten Rektionsschwankungen bei zehn ausgewählten Präpositionen, wobei der Fokus auf der Wahl zwischen Dativ und Genitiv liegt. Die Leitfragen der Arbeit werden formuliert, und die gewählte ergebnisoffene Methodik wird erläutert. Die Struktur der Arbeit wird skizziert, wobei die theoretischen Grundlagen, die Korpusrecherche und die empirische Untersuchung der Lernergebnisse im Fokus stehen.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel nähert sich der Komplexität von Standardnormen im sprachlichen Gebrauch. Es beleuchtet den Begriff der Sprachnorm und bezieht sich auf wissenschaftliche Modelle wie das soziale Kräftefeld von Ulrich Ammon und das Sprachmanagement. Es bildet die theoretische Grundlage für die anschließende empirische Untersuchung, indem es den Rahmen für die Analyse der Kasuswahl und die Interpretation der Ergebnisse liefert. Die Komplexität der Normsetzung und der Einfluss von sozialen Faktoren auf die sprachliche Variation werden hier ausführlich diskutiert.
3. Empirie: Das Kapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse, die durch eine eigene Korpusrecherche im Deutschen Referenzkorpus (Cosmas II) und eine Untersuchung bei DaF-Lernenden gewonnen wurden. Die Korpusrecherche liefert Daten zur Häufigkeit der genitivischen und dativischen Rektion bei den ausgewählten Präpositionen. Die Untersuchung bei den DaF-Lernenden umfasst Schülerergebnisse und Interviews mit einer Deutschlehrkraft. Die Analyse der Daten zielt darauf ab, die bevorzugte Kasuswahl der Lernenden zu identifizieren, die damit verbundenen Schwierigkeiten zu beleuchten und die Bewertungskriterien der Lehrkraft zu verstehen. Die methodischen Grenzen der Arbeit, wie die Auswahl der Präpositionen und die begrenzte Datenmenge, werden hier ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Kasusrektion, Dativ, Genitiv, Präpositionen, DaF-Unterricht, Zweitspracherwerb, Korpuslinguistik, Empirie, Sprachnorm, Standardvarietät, Soziolinguistik, Sprachmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Kasuswahl zwischen Dativ und Genitiv bei ausgewählten Präpositionen im DaF-Unterricht
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Kasuswahl zwischen Dativ und Genitiv bei ausgewählten Präpositionen im Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterricht, insbesondere die "semantisch irrelevanten Rektionsschwankungen". Der Fokus liegt auf den Schwierigkeiten französischsprachiger Lernender und der Bewertung dieser Variationen durch Lehrkräfte.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert Korpusforschung (Deutsches Referenzkorpus – Cosmas II) mit empirischen Daten aus einer Untersuchung mit DaF-Lernenden. Diese Untersuchung beinhaltete die Analyse von Schülerarbeiten und Kurzinterviews mit einer Deutschlehrkraft. Die Ergebnisse werden analysiert um die bevorzugte Kasuswahl der Lernenden, die damit verbundenen Schwierigkeiten und die Bewertungskriterien der Lehrkraft zu verstehen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kasusrektion bei Präpositionen im Deutschen, die Schwierigkeiten von DaF-Lernenden mit dem deutschen Kasussystem, den Einfluss der Erstsprache auf die Kasuswahl, die Bewertung von Kasusvariationen durch Deutschlehrkräfte und die didaktischen Implikationen für den DaF-Unterricht.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien zur Sprachnorm und Sprachvariation, einschließlich des Konzepts des sozialen Kräftefelds von Ulrich Ammon und des Sprachmanagements. Diese Theorien liefern den Rahmen für die Analyse der Kasuswahl und die Interpretation der empirischen Ergebnisse. Die Komplexität der Normsetzung und der Einfluss sozialer Faktoren auf sprachliche Variation werden ausführlich diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Rahmen, einen empirischen Teil (mit eigener Korpusrecherche und Untersuchung bei DaF-Lernenden) und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Problematik dar und formuliert die Leitfragen. Der theoretische Rahmen beleuchtet die Komplexität von Standardnormen. Der empirische Teil präsentiert die Ergebnisse der Korpusrecherche und der Lerneruntersuchung. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert deren Implikationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kasusrektion, Dativ, Genitiv, Präpositionen, DaF-Unterricht, Zweitspracherwerb, Korpuslinguistik, Empirie, Sprachnorm, Standardvarietät, Soziolinguistik, Sprachmanagement.
Welche Ergebnisse wurden erzielt (in Kurzfassung)?
Die Ergebnisse der Korpusrecherche und der Untersuchung bei DaF-Lernenden zeigen die Häufigkeit der genitivischen und dativischen Rektion bei den ausgewählten Präpositionen und beleuchten die Schwierigkeiten der Lernenden im Umgang mit der Kasuswahl. Die Analyse umfasst auch die Bewertung dieser Variationen durch eine Deutschlehrkraft. Die genauen Ergebnisse werden im Detail in der Arbeit präsentiert.
Welche methodischen Grenzen werden angesprochen?
Die Arbeit erwähnt methodische Grenzen wie die Auswahl der Präpositionen und die begrenzte Datenmenge der empirischen Untersuchung.
- Arbeit zitieren
- M. Semrau (Autor:in), 2022, Genitivische und dativische Rektion bei ausgewählten Präpositionen im Rahmen des DaF-Unterrichts, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1448748