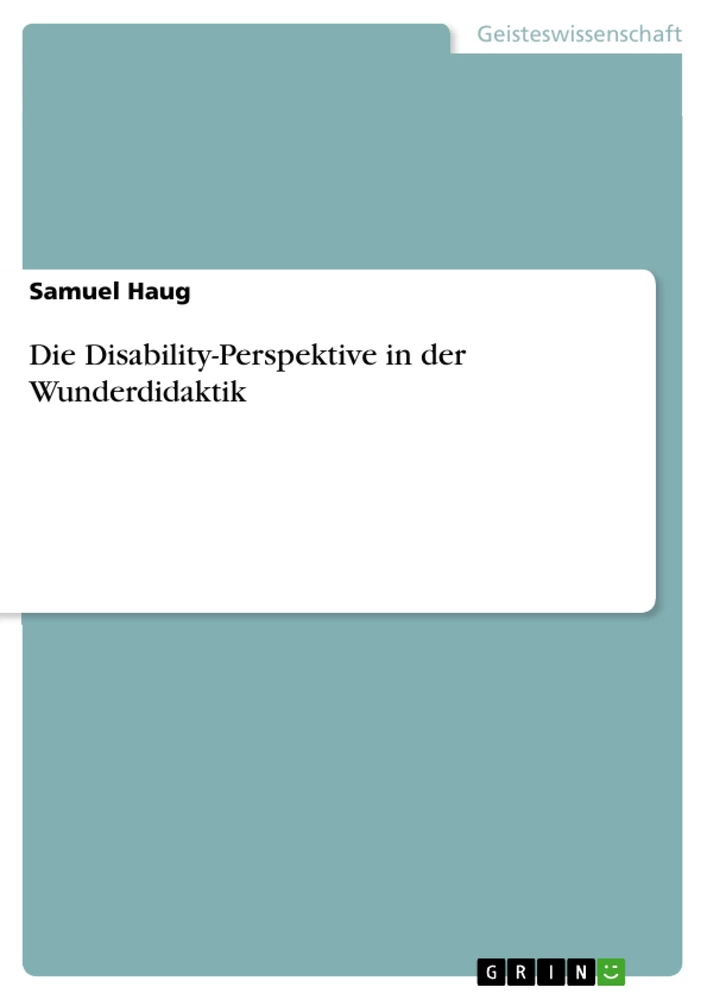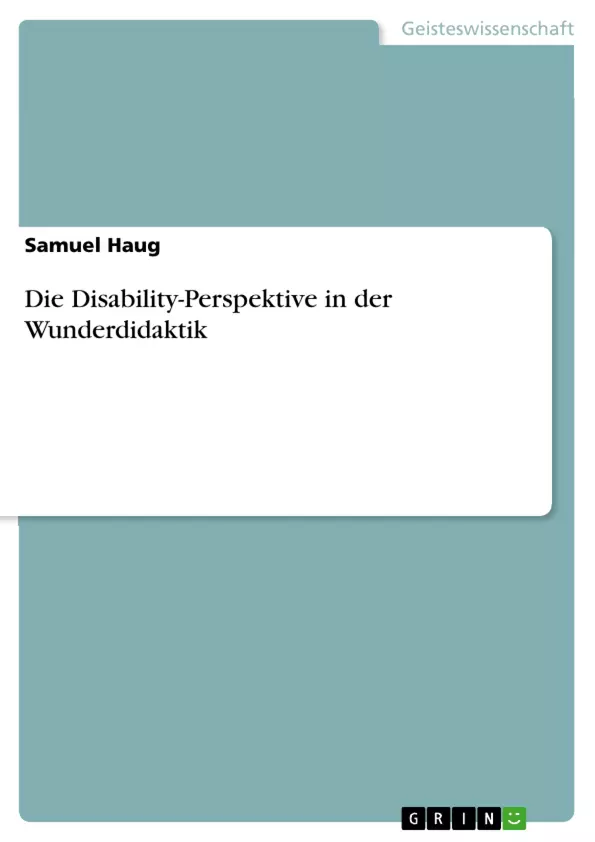„Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, und Tote werden auferweckt, und Armen wird das Evangelium verkündigt“ (Mt 11,5, ZB). Dieses Jesus-Wort steht stellvertretend für die durch Jesus von Nazareth verkündigte Heilsbotschaft der angebrochenen Königsherrschaft Gottes, welche sich nach der Vorstellung des antiken Judentums endzeitlich – bei gleichzeitiger Entmachtung des Teufels – uneingeschränkt vollzieht. „Als Folge der Entmachtung des Satans ist ein Eindringen in seinen Herrschaftsbereich möglich, indem der kranke Mensch vom Bösen befreit und in seiner schöpfungsgemäßen Bestimmung wiederhergestellt wird“. Das göttliche Heil wird also schon im Hier und Jetzt gegenwärtig und leiblich erfahrbar in Handlungen Jesu, in Heilungen und Exorzismen. Trotz höchst unterschiedlicher Deutungsperspektiven (z.B. allegorisch-spirituelle, rationalistische, existenziale, tiefenpsychologische, sozial- und kultkritische oder feministische Deutung) werden Wundererzählungen beinahe durchweg positiv bewertet (z.B. als Hoffnungs-, Befreiungs- oder Glaubensgeschichten; oder als Texte, die zu einer neuen Existenzmöglichkeit führen oder innerpsychische Konflikte auflösen). Grundsatzkritik an den neutestamentlichen Wundertexten äußert die Disability-Perspektive, eine radikale Form der sozialkritischen Wunderdeutung. Die Disability-Perspektive wird in dieser Arbeit dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1,,Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, und Tote werden auferweckt, und Armen wird das Evangelium verkündigt\" (Mt 11,5, ZB).
- Die Dis/ability Studies konzentrieren sich in ihrer Kritik auf das Differenzverhältnis von Behinderung und Nicht-Behinderung, wobei Behinderung wahrgenommen wird „als Konstruktion der Gesellschaft bzw. als gesellschaftliches Differenzierungsmerkmal, das in wissenschaftlichen und alltagsweltlichen Diskursen sowie politischen und bürokratischen Verfahren produziert wird“.
- Zunächst vermittelt es „unter einer fragwürdigen Gleichsetzung von Heilung und Heil [...], dass Behinderungen nicht im Sinne Gottes seien❝.
- Aber auch und gerade eine symbolische bzw. metaphorische Deutung der Heilungsgeschichte gerät häufig zu einem exklusivistischen Akt, der ebenfalls seine Wurzeln im Alten Testament hat:
- Dazu müssen zunächst die Begriff Heil und Heilung, die im Bereich der Wundererzählungen häufig gleichgesetzt werden, voneinander abgegrenzt und einer Revision unterzogen werden:
- Allerdings muss der Einwand hervorgebracht werden, dass die neutestamentlichen Wundererzählungen hierbei kaum weiterhelfen, sondern wie bereits beschrieben, eine Heilung zur Normalität vorgaukeln.
- Andererseits muss „fortwährend um neue, inklusive Deutungen gerungen werden […], um die Geschichten nunmehr auch anders interpretieren und im Kontext der heutigen Zeit und gesellschaftlichen Verhältnisse neu erzählen zu können❝.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung analysiert neutestamentliche Wundererzählungen aus der Perspektive der Disability Studies und beleuchtet kritisch die Darstellung von Behinderung in den biblischen Texten.
- Kritik an der Gleichsetzung von Heilung und Heil
- Die Konstruktion von „Normalität“ und die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung
- Religiöse Ausbeutung und die Verbindung von Behinderung mit Sünde und Strafe
- Die Notwendigkeit einer inklusiven Deutung von Wundererzählungen
- Die Bedeutung einer Revision der Begriffe „Heil“ und „Heilung“
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt die zentrale These der Disability-Perspektive dar, die Behinderung als gesellschaftliche Konstruktion begreift und die Darstellung von Heilung in den Wundererzählungen kritisch hinterfragt.
- Das zweite Kapitel analysiert die problematische Darstellung von Behinderung in den neutestamentlichen Texten, welche Menschen mit Behinderung als abweichend und als Objekte der Heilung und Normalisierung darstellt.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die spirituellen und metaphorischen Deutungen der Heilungsgeschichte, die zu einer Ausbeutung von Menschen mit Behinderung führen können, indem ihre Erfahrungen für andere Zwecke instrumentalisiert werden.
- Das vierte Kapitel fordert eine Revision des Begriffs "Heilung" und eine Unterscheidung zwischen medizinischer und sozialer Heilung, wobei letztere als Inklusion verstanden wird.
- Das fünfte Kapitel plädiert für eine inklusive Deutung der Wundererzählungen, die Behinderungen nicht als Defizite, sondern als Teil der menschlichen Vielfalt betrachtet.
Schlüsselwörter
Disability-Perspektive, Heilungswunder, Inklusion, Exklusion, Normalität, Behinderung, Theologie, Bibel, Neutestamentliche Texte, Kritik, Deutung, Befreiungstheologie, soziale Heilung, spirituelle Ausbeutung.
- Arbeit zitieren
- Samuel Haug (Autor:in), 2022, Die Disability-Perspektive in der Wunderdidaktik, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1438213