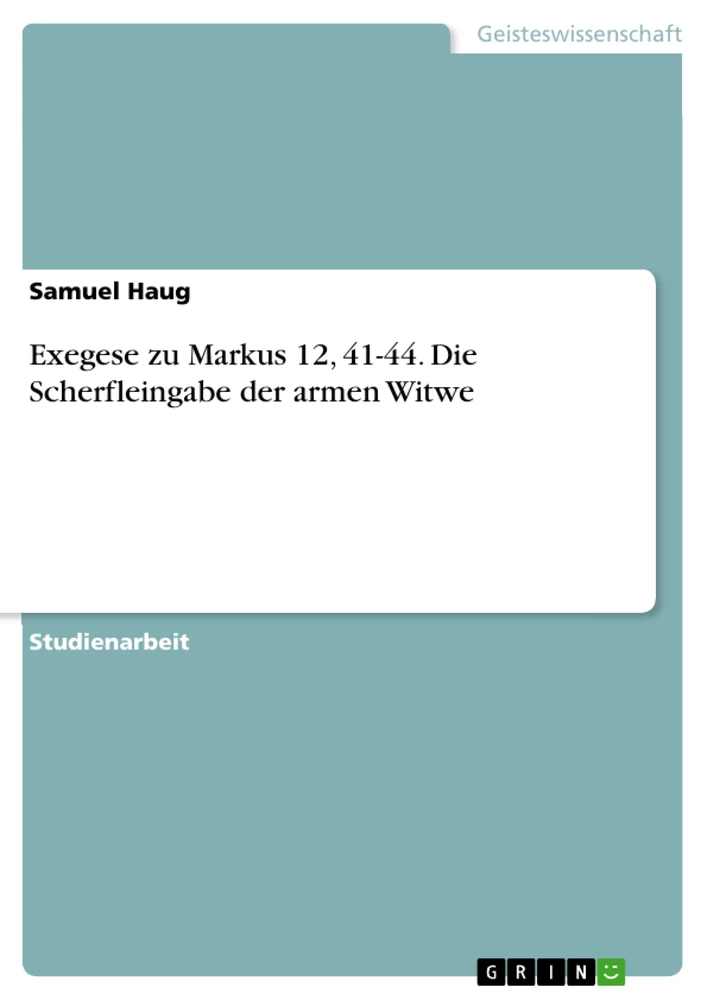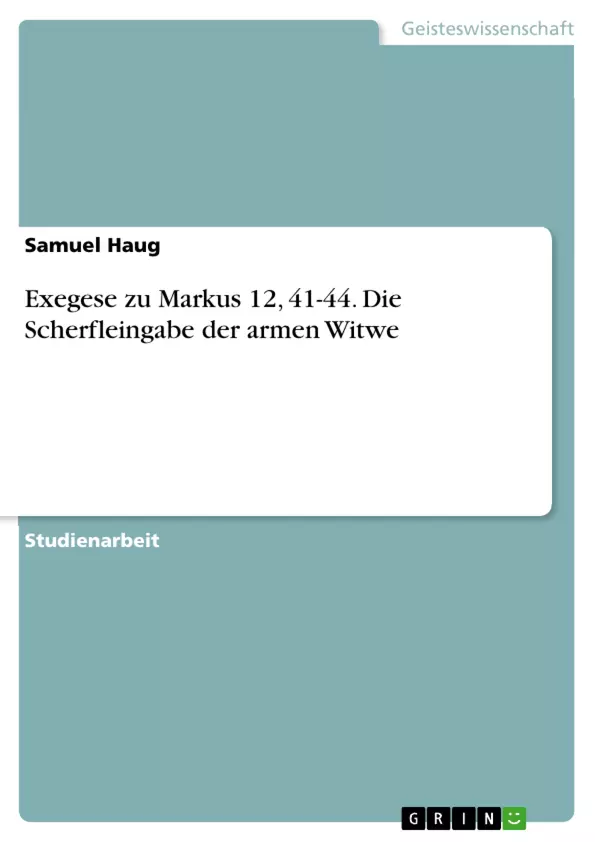In der folgenden Arbeit soll die Scherfleingabe der armen Witwe in Mk 12,41-44 exegetisch untersucht werden.
Die Perikope folgt im Anschluss an einige Streit- und Schulgespräche, in denen der markinische Jesus zu zentralen theologischen Themen vor der jüdischen Obrigkeit Stellung bezieht. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Ereignissen wirkt die Gabe der armen Witwe fast unscheinbar, weshalb die Stelle für mich herausgestochen ist: Jesus beobachtet die Gabe der Witwe in der Schatzkammerhalle still und alleine und ruft anschließend nur seine Jünger zu sich, wobei von der Menschenmenge und Gesetzeslehrern keine Rede mehr ist. Markus beschreibt im vorangegangenen Erzählstoff eine als vordergründig geschilderte Frömmigkeit der Schriftgelehrten und kontrastiert dazu die echte Gebebereitschaft der armen Witwe, welche ein Exempel für die Nachfolger Christi darstellt. Daher hat die Scherfleingabe der Witwe aus meiner Sicht einen besonderen Stellenwert. Der markinische Jesus weist der geringeren Gabe der armen Witwe einen höheren Wert zu, als den vergleichsweise höheren materiellen Gaben der übrigen Menschen. Im Folgenden möchte ich mit wissenschaftlich-exegetischer Methodik zum einen die Bedeutung der Textstelle hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Jesus und Menschen der sozialen Unterschicht untersuchen. Zum anderen erhoffe ich mir, mit exegetischem Vorgehen die Stellung und Relevanz der Perikope im Kontext des Evangeliums nach Markus zu erforschen. Da das Erlernen der griechischen Sprache kein Inhalt des Studiums der evangelischen Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule ist, werde ich zur Textsicherung mit einer deutschen Interlinearübersetzung des Novum Testamentum Graece und einem Wörterbuch arbeiten, um die Texte verschiedener deutscher Übersetzungen (LUT, ELB, ZB, GNB) besser vergleichen und beurteilen zu können. Im synchronen Arbeitsschritt werde ich die Perikope in der syntaktischen und semantischen Analyse zunächst sprachlich untersuchen, die Gattung des Textes bestimmen sowie die Absicht des Textes (Pragmatik) beschreiben. Anschließend wird die Perikope im Markusevangelium verortet und mögliche innerbiblische Verweise werden analysiert. Im Diachronen Methodenschritt werden mögliche Veränderungen durch Markus als Redaktor mithilfe der Literar- und Redaktionskritik untersucht, um im anschließend Schritt den historischen Kontext zu skizzieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: hermeneutische Vorüberlegungen
- Einleitungsfragen
- Textsicherung
- Textkritische Rückfrage
- Übersetzungsvergleich
- Textabgrenzung
- Synchrone Methodenschritte
- Syntaktische Analyse
- Semantische Analyse
- Gattungsbestimmungen
- Pragmatische Analyse
- Intertextualität
- Kontextanalyse
- Diachrone Methodenschritte
- Literarkritischer Arbeitsschritt
- Redaktionskritischer Arbeitsschritt
- Historische Kontextualisierung
- Schluss: hermeneutische Reflexion
- Anhang
- Übersetzungsvergleich
- Syntax
- Semantik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der exegetischen Untersuchung der Scherfleingabe der armen Witwe in Mk 12,41-44. Sie will die Bedeutung der Textstelle hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Jesus und Menschen der sozialen Unterschicht erforschen und die Stellung der Perikope im Kontext des Evangeliums nach Markus beleuchten. Die Arbeit analysiert die Textstelle sowohl sprachlich als auch im Kontext des Markusevangeliums und betrachtet historische und literarische Einflüsse.
- Die Bedeutung der Gabe der armen Witwe im Vergleich zu den Gaben der Reichen
- Das Verhältnis von Jesus zu den Armen und Bedürftigen
- Die Interpretation der Perikope im Kontext der markinischen Theologie
- Der literarische und historische Hintergrund der Textstelle
- Die Rolle der Scherfleingabe als Beispiel für die Nachfolge Christi
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Perikope in das Markusevangelium eingeordnet. Es werden Fragen zur Entstehung des Evangeliums, zur Datierung, zur Lokalisierung, zum Verfasser, zu den Adressaten und zur Gliederung des Werks behandelt. Außerdem werden die theologischen Schwerpunkte des Markusevangeliums beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die exegetische Untersuchung von Mk 12,41-44. Die Schlüsselwörter umfassen: Scherfleingabe, arme Witwe, soziale Unterschicht, Jesus, Markusevangelium, Kontextanalyse, Literar- und Redaktionskritik, hermeneutische Reflexion.
- Quote paper
- Samuel Haug (Author), 2021, Exegese zu Markus 12, 41-44. Die Scherfleingabe der armen Witwe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1438209