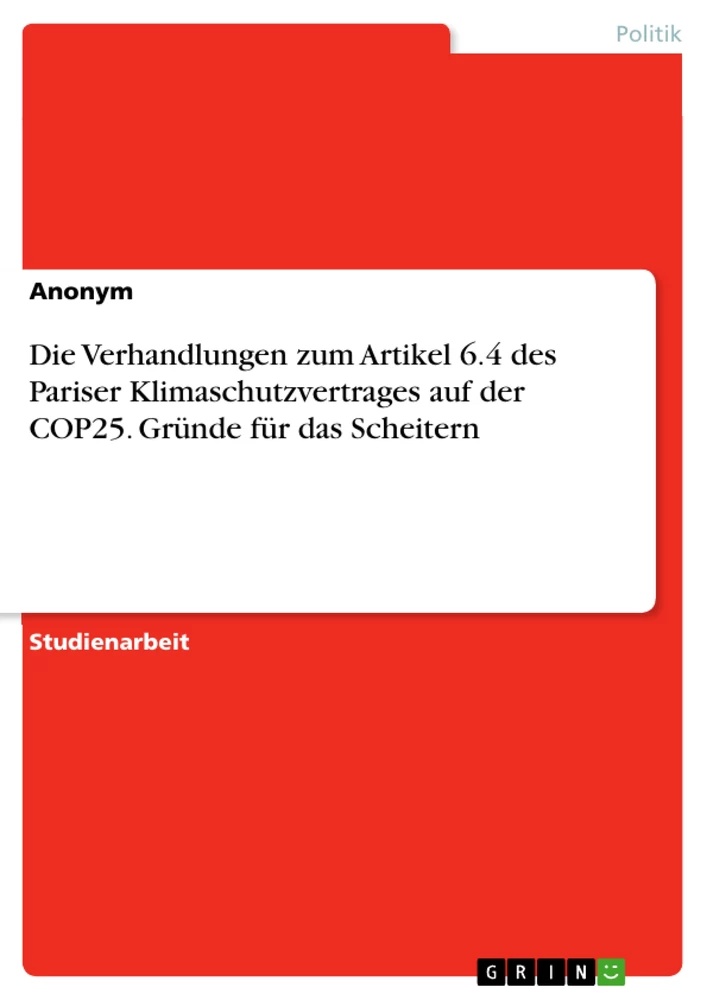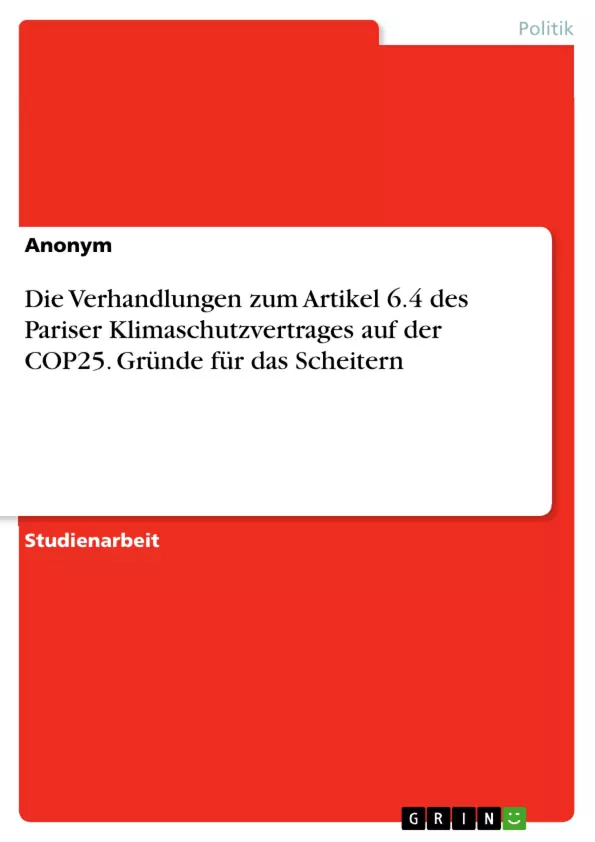Die Hausarbeit analysiert, warum die Verhandlungen auf der 25. COP in Madrid im Art. 6.4 des Pariser Klimaschutzvertrages vorgesehenen Mechanismus zum Handel von Emissionsminderungszertifikaten nicht erfolgreich waren.
"Tiempo De Actuar" – Zeit zu handeln, so lautete das offizielle Motto der 25. UN-Klimakonferenz in Madrid (COP25). Tatsächlich aber konnten sich die 179 Teilnehmerstaaten in vielen wichtigen Punkten nur auf einen Minimalkonsens oder eine Vertagung auf die nächste Klimakonferenz einigen. Viele Beobachter kritisierten daher die Verhandlungsergebnisse und monierten, dass bei dem zentralen Aspekt, der detaillierten Ausgestaltung des Pariser Klimaschutzvertrages, erneut keine nennenswerten Fortschritte erzielt worden seien.
So war es eines der zentralen Ziele, die genaue Ausgestaltung des in Art. 6.4 des Pariser Klimaschutzvertrages vorgesehenen Mechanismus zum Handel von Emissionsminderungszertifikaten festzulegen. Hier konnten sich die Teilnehmer am Ende der Konferenz aber nur darauf einigen, die Verhandlungen auf der nächsten UN-Klimakonferenz fortzuführen. Der Verhandlungsverlauf und die Frage, warum sich die Teilnehmer nicht auf eine Ausgestaltung einigen konnten, wird in dieser Arbeit untersucht, wobei der Fokus auf den nationalstaatlichen Verhandlungsdelegationen und weniger auf den weiteren Akteuren, die ebenfalls auf den UN-Klimakonferenzen vertreten sind, liegt. Eine Untersuchung dieser Frage ist von besonderer Relevanz, da es sich bei dem Art. 6.4 um einen zentralen Aspekt des Pariser Klimaschutzabkommens handelt, dessen genaue Ausgestaltung bis heute nicht abschließend festgelegt werden konnte.
Zur Beantwortung der Forschungsfrage, wird die von Mayntz und Scharpf entwickelte Forschungsheuristik des Akteurzentrierten Institutionalismus herangezogen. Dazu werden im ersten Teil die zentralen Untersuchungselemente, der institutionelle Kontext, die Akteur*innen und die Akteurskonstellation beschrieben, sowie auf die Analyse von Verhandlungen eingegangen. Anschließend werden diese Elemente bei der COP25 untersucht und der Verhandlungsverlauf sowie die Ergebnisse nachgezeichnet. Der Fokus liegt dabei auf der Akteurskonstellation und den eigentlichen Verhandlungen über den Art 6.4 sowie der Rolle der brasilianischen Delegation. Abschließend werden Lösungsvorschläge für den Konflikt aufgezeigt und es erfolgt ein Fazit sowie ein Ausblick auf die weiteren Entwicklungen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Enttäuschung von Madrid
- Der Weg zur COP25
- Der Akteurzentrierte Institutionalismus
- Der institutionelle Kontext
- Die Akteur*innen
- Die Akteurskonstellationen
- Die Analyse von Verhandlungen
- Analyse der COP25
- Institutioneller Kontext der internationalen Klimaverhandlungen
- Zentrale Akteur*innen auf der COP25
- Die Akteurskonstellation auf der COP25
- Die Verhandlungen über Art. 6.4
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der 25. UN-Klimakonferenz in Madrid (COP25) und analysiert die gescheiterten Verhandlungen über die genaue Ausgestaltung von Art. 6.4 des Pariser Klimaschutzvertrages. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle der nationalstaatlichen Verhandlungsdelegationen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Konflikte und Herausforderungen bei der Ausgestaltung des Emissionshandelsmechanismus zu identifizieren und zu erklären, warum sich die Teilnehmer*innen nicht auf eine Lösung einigen konnten.
- Analyse der gescheiterten Verhandlungen über Art. 6.4 des Pariser Klimaschutzvertrages auf der COP25
- Anwendung des Akteurzentrierten Institutionalismus zur Erklärung der Verhandlungsergebnisse
- Untersuchung des institutionellen Kontextes, der Akteur*innen und der Akteurskonstellation auf der COP25
- Identifizierung der zentralen Konflikte und Herausforderungen im Verhandlungsprozess
- Diskussion möglicher Lösungsvorschläge und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschreibt die Enttäuschung der internationalen Gemeinschaft über die Ergebnisse der COP25, insbesondere hinsichtlich der Verhandlungsergebnisse zu Art. 6.4. Der Weg zur COP25 wird im zweiten Kapitel erläutert, wobei die historischen Entwicklungen der internationalen Klimapolitik und die Herausforderungen bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutzvertrages beleuchtet werden. Das dritte Kapitel stellt die theoretische Grundlage der Arbeit, den Akteurzentrierten Institutionalismus, vor. Es werden die zentralen Untersuchungselemente des AZI erläutert, darunter der institutionelle Kontext, die Akteur*innen und die Akteurskonstellation. Im vierten Kapitel wird die COP25 mithilfe des AZI analysiert, wobei der Fokus auf den institutionellen Kontext der internationalen Klimaverhandlungen, die zentralen Akteur*innen und die Akteurskonstellation auf der COP25 sowie auf den Verhandlungsverlauf über Art. 6.4 liegt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenfelder dieser Arbeit sind: Internationale Klimapolitik, COP25, Pariser Klimaschutzvertrag, Art. 6.4, Emissionshandel, Akteurzentrierter Institutionalismus, Verhandlungsanalyse, nationale Verhandlungsdelegationen, institutioneller Kontext, Akteurskonstellation, Konfliktpotenzial.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Die Verhandlungen zum Artikel 6.4 des Pariser Klimaschutzvertrages auf der COP25. Gründe für das Scheitern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1430936