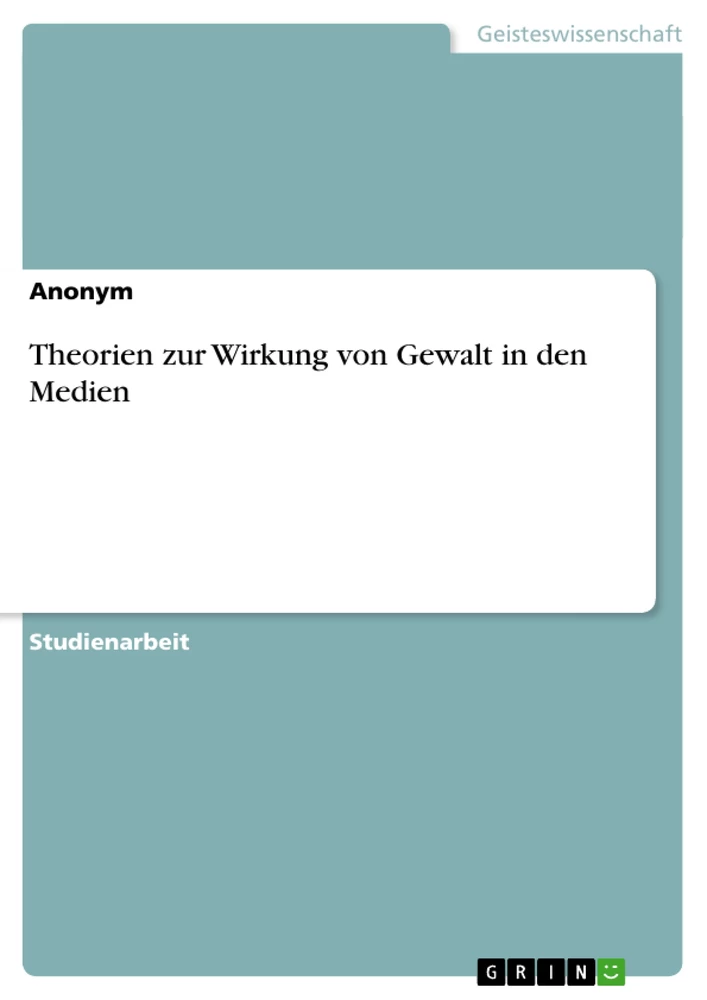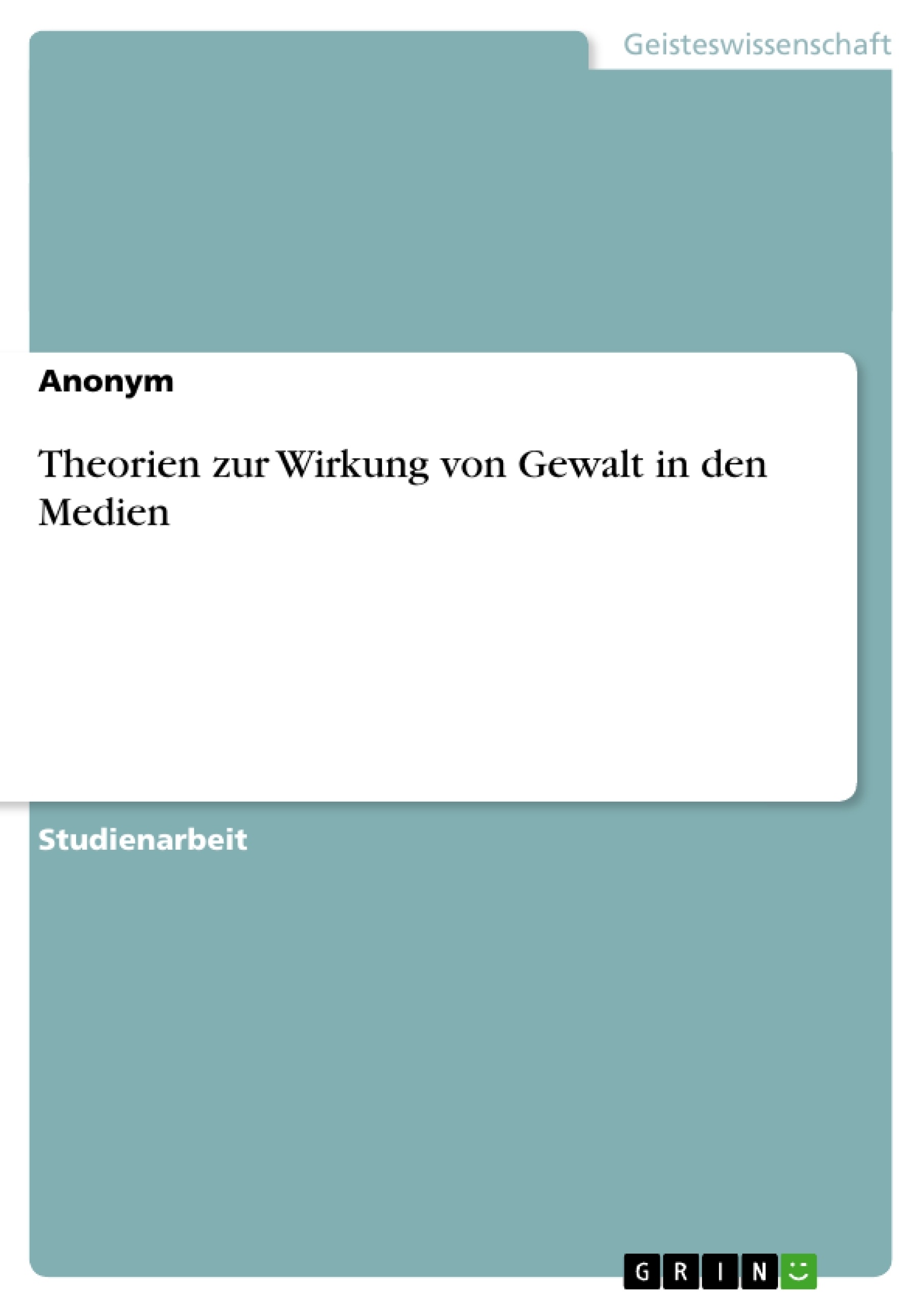In der vorliegenden Ausarbeitung des Referats geht es darum, grundlegende Theorien des Zusammenhangs von Gewaltkonsum in den Medien und Gewalt in der Realität vorzustellen.
Unter Gewalt wird im folgenden „die Manifestation von Macht und/oder Herrschaft, mit der Folge und/oder dem Ziel der Schädigung von einzelnen oder Gruppen von Menschen“ (THEUNERT 1996:59) verstanden. Es geht dabei sowohl um personale, also dem Individuum zugefügte physische und/oder psychische Gewalt, als auch um strukturelle Gewalt, die sich in bestimmten Hierarchien oder Rollenzuweisungen in der Gesellschaft widerspiegelt.
Der Begriff „Medien“ wird in erster Linie den Rundfunk umfassen, da er aufgrund der doppelten Reizübertragung, visuell und akustisch eine intensivere Rezeption ermöglicht. In Teilen können die Modelle jedoch auch auf den Hörfunk und die Printmedien übertragen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung in das Thema
- Wirkungsebenen von Mediengewalt
- Wirkungen auf physiologischer Ebene
- Wirkungen auf emotionaler Ebene
- Wirkungen auf kognitiver Ebene
- Triebtheorien
- Katharsisthese
- Inhibitionsthese
- Erregungstheorien
- Frustrations-Aggressions-These
- Excitation-Transfer-Theorie
- Lerntheorien
- Lernen am Modell
- Rechtfertigungsthese
- Habitualisierungsthese
- Suggestionsthese
- Lernen am Modell
- Kritik an den vorgestellten Theorieansätzen
- Verengung der Mediengewaltproblematik auf die Aggression
- Ausblendung des sozial kontextuierten Rezipienten
- Nicht-Berücksichtigung des Kontextes der Gewaltdarstellung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Erforschung der verschiedenen Theorien, die den Zusammenhang zwischen Mediengewalt und Gewalt in der Realität untersuchen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der verschiedenen theoretischen Ansätze zu vermitteln und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen aufzuzeigen.
- Wirkungsebenen von Mediengewalt auf physiologischer, emotionaler und kognitiver Ebene
- Triebtheorien wie die Katharsisthese und die Inhibitionsthese
- Erregungstheorien, die den Einfluss von Frustration und Erregung auf Aggression untersuchen
- Lerntheorien, die sich mit dem Lernen von aggressivem Verhalten durch Beobachtung und Nachahmung auseinandersetzen
- Kritik an den vorgestellten Theorien, insbesondere hinsichtlich der Verengung der Problematik, der Ausblendung des Rezipientenkontextes und der Nicht-Berücksichtigung des Kontextes der Gewaltdarstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Zusammenhangs von Mediengewalt und Gewalt in der Realität ein und definiert die zentralen Begriffe „Gewalt“ und „Medien“.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Wirkungsebenen von Mediengewalt. Dabei werden die Wirkungen auf physiologischer, emotionaler und kognitiver Ebene des Rezipienten analysiert.
Im dritten Kapitel werden die Triebtheorien, insbesondere die Katharsisthese und die Inhibitionsthese, vorgestellt. Diese Theorien erklären den Einfluss von Mediengewalt auf die Aggression des Rezipienten anhand von Triebimpulsen.
Das vierte Kapitel analysiert die Erregungstheorien, darunter die Frustrations-Aggressions-These und die Excitation-Transfer-Theorie. Diese Theorien untersuchen den Zusammenhang zwischen Erregung, Frustration und Aggression.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Lerntheorien, die den Einfluss von Mediengewalt auf das Lernen von aggressivem Verhalten erklären. Hierzu zählen das Lernen am Modell, die Habitualisierungsthese und die Suggestionsthese.
Schlüsselwörter
Mediengewalt, Gewalt in der Realität, Wirkungsebenen, Triebtheorien, Katharsisthese, Inhibitionsthese, Erregungstheorien, Frustrations-Aggressions-These, Excitation-Transfer-Theorie, Lerntheorien, Lernen am Modell, Habitualisierungsthese, Suggestionsthese, Kritik, Rezeption, Kontext, Aggression.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2000, Theorien zur Wirkung von Gewalt in den Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/14307