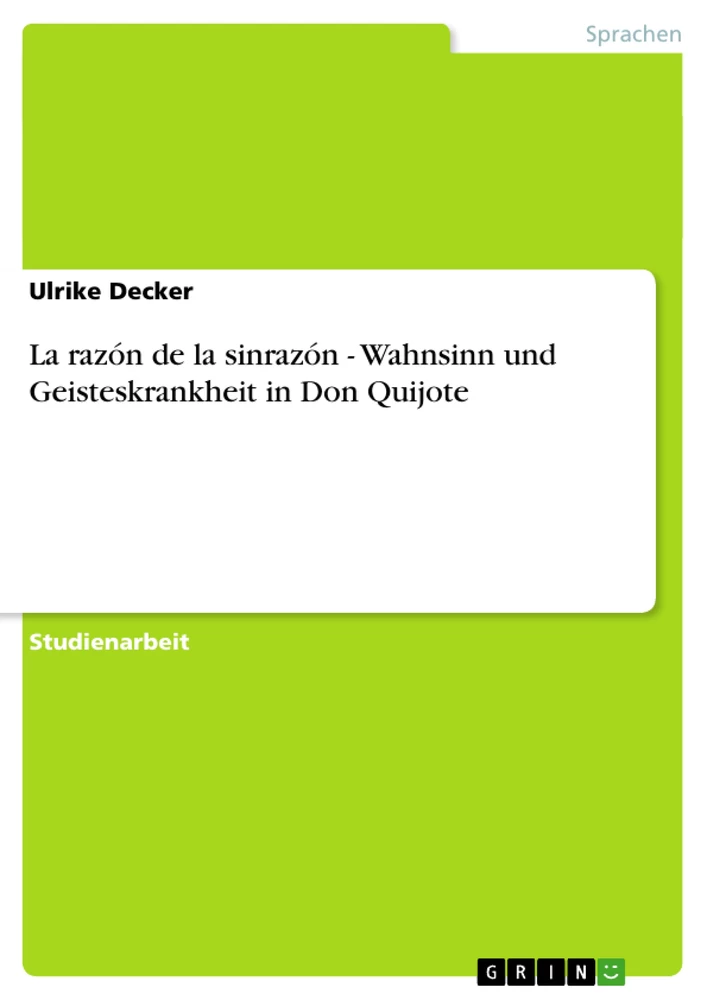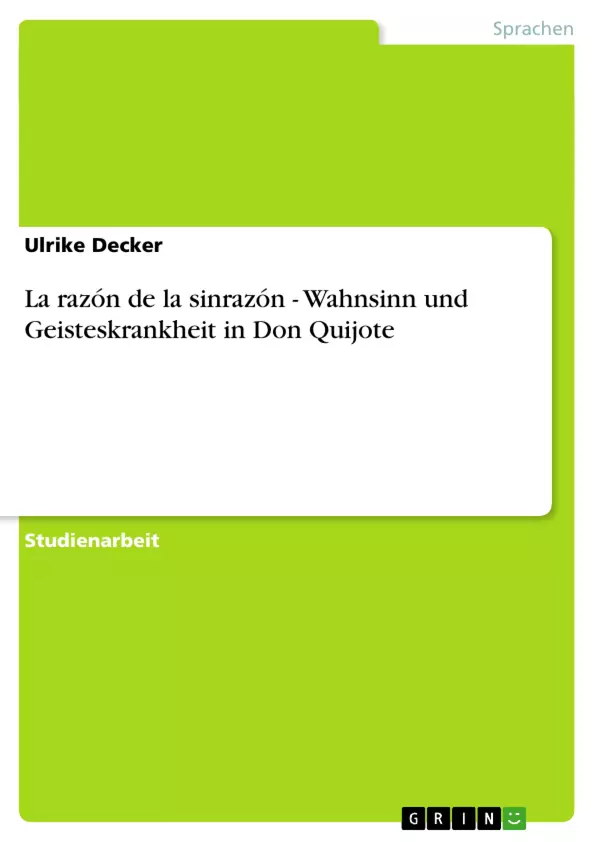1. Einleitung
Was treibt einen alten Mann dazu, von einem Tag zum anderen Haus und Hof zu verlassen, sein Pferd zu satteln und sich als Ritter kostümiert in unbequemer Rüstung unter größten Strapazen auf die Suche nach Abenteuern zu machen? Wer sich durch die hunderte von Seiten haarsträubender Geschichten liest, die Cervantes Roman Don Quijote ausmachen, dem stellt sich diese Frage unweigerlich immer wieder von Neuem. Wer ist dieser Ritter von der traurigen Gestalt? Ein Philosoph, gar ein Prophet oder ein einfacher hirnverbrannter Spinner? Ob Prophet oder Spinner, eine gehörige Prise Wahnsinn gehört in jedem Fall dazu, sich auf derlei Abenteuer einzulassen. Und so scheint mir die Frage nach Quijotes Geisteszustand geradezu unerläßlich zum Verständnis eines der bemerkenswertesten Werke der spanischen Literatur, einem der Meilensteine der Weltliteratur.
Bis vor etwa zehn bis zwanzig Jahren beschäftigte sich die Literaturwissenschaft, die reichlich Untersuchungen zu verschiedensten Aspekten des Quijote hervorbrachte, kaum mit dem Thema des Wahnsinns – einem Aspekt, der, wie ich meine, untrennbar mit der Person und Charakterzeichnung des Ritters von der traurigen Gestalt verknüpft ist. Vor allem in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren wurden jedoch Untersuchungen veröffentlicht, die Cervantes Roman unter psychoanalytischen Gesichtspunkten beleuchten und so eine weitere Dimension in der Interpretation des Werkes eröffnen.
In der folgenden Arbeit habe ich mich entschieden, den Aspekt des Wahnsinns bei Quijote unter unterschiedlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Beginnen möchte ich mit einer Zusammenfassung der veränderten Einstellung zu Geisteskrankheiten vom Mittelalter bis zur Barockzeit, die Aufschluß über den kulturellen Kontext, in dem Don Quijote entstand, geben soll und über die epochenspezifische Auffassung von Verrücktheit. Ist Quijote geistesgestört oder bewußt verrückt? – diese Frage steht im Mittelpunkt des nächsten Kapitels. Im Anschluß wird der Geisteszustand Quijotes einer Analyse unter psychologischen bzw. psychopathologischen Aspekten unterzogen, um desweiteren auf seine literarisch-metaphorische Qualität hin untersucht zu werden. Die Verbindung zwischen Verrücktheit und Idealismus soll im fogenden unter die Lupe genommen werden. Sancho Panza als Gegenpol zu Quijote und sein Verhältnis zu Realität und Wahn gehen schließlich einer Analyse des metafiktionalen Charakters des Werkes voraus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Inhaltsübersicht
- 2.1 Die Geschichte des Wahnsinns vom Mittelalter zur Barockzeit
- 2.2 Don Quijote - ein Fall für die Psychiatrie?
- 2.3 Pathologische Diagnose des Patienten Don Quijote
- 2.4 Wahnsinn als Metapher
- 2.5 Wahnsinn und Idealismus
- 2.6 Quijote, Sancho und der Rest der Welt
- 2.7 Wahnsinn und Fiktion
- 3. La razón de la sinrazón
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Aspekt des Wahnsinns in Cervantes' Don Quijote. Ziel ist es, den kulturellen Kontext des Romans zu beleuchten und verschiedene Interpretationen des Quijotes' Geisteszustands zu analysieren. Die Untersuchung geht dabei über eine rein psychopathologische Betrachtung hinaus und beleuchtet die literarisch-metaphorische Bedeutung des Wahnsinns im Werk.
- Die historische Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheiten vom Mittelalter bis zur Barockzeit
- Die psychopathologische Diagnose des Don Quijote
- Der Wahnsinn als literarische Metapher und seine Funktion im Roman
- Die Beziehung zwischen Wahnsinn und Idealismus bei Don Quijote
- Das Verhältnis von Don Quijote und Sancho Panza und ihre unterschiedliche Wahrnehmung der Realität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Geisteszustand Don Quijotes und seiner Bedeutung für das Verständnis des Romans. Sie verweist auf die bisherige Forschungslandschaft, die den Aspekt des Wahnsinns lange vernachlässigt hat, und kündigt den methodischen Ansatz der Arbeit an, der den Wahnsinn unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet: historisch-kulturell, psychopathologisch, literarisch-metaphorisch, sowie im Kontext des Verhältnisses von Quijote und Sancho Panza. Die Einleitung betont die Relevanz der Frage nach Quijotes Geisteszustand für die Interpretation eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur.
2.1 Die Geschichte des Wahnsinns vom Mittelalter zur Barockzeit: Dieses Kapitel skizziert die Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheiten vom Mittelalter bis zur Barockzeit. Im Mittelalter wurden psychische Krankheiten mit Dämonenbesessenheit gleichgesetzt, was zu Stigmatisierung und Ausgrenzung führte. Die Renaissance brachte eine veränderte Perspektive mit sich: Der Wahnsinn wurde als Zustand der Freiheit und Ungehemmtheit interpretiert, und in intellektuellen Kreisen fand eine teilweise Entstigmatisierung statt. Narrenfeste und künstlerische Darstellungen spiegelten diese neue Sichtweise wider. Gegen Mitte des 17. Jahrhunderts kehrte sich die Tendenz jedoch wieder um, und Wahnsinn wurde als Abweichung von der Norm stigmatisiert und unterdrückt. Der Abschnitt betont den Wandel der gesellschaftlichen und kulturellen Wahrnehmung von Geisteskrankheiten als Kontext für das Verständnis von Don Quijotes Rolle und seiner Darstellung im Werk.
Schlüsselwörter
Don Quijote, Wahnsinn, Geisteskrankheit, Barockzeit, Mittelalter, Cervantes, Literaturanalyse, Metapher, Idealismus, Realität, Fiktion, Sancho Panza, Psychoanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu "Don Quijote und der Wahnsinn"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Aspekt des Wahnsinns in Miguel de Cervantes' Don Quijote. Sie analysiert den kulturellen Kontext des Romans und verschiedene Interpretationen von Don Quijotes Geisteszustand. Dabei geht sie über eine rein medizinische Betrachtung hinaus und beleuchtet die literarisch-metaphorische Bedeutung des Wahnsinns.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheiten vom Mittelalter bis zur Barockzeit, die psychopathologische Diagnose Don Quijotes, den Wahnsinn als literarische Metapher und seine Funktion im Roman, die Beziehung zwischen Wahnsinn und Idealismus bei Don Quijote, sowie das Verhältnis zwischen Don Quijote und Sancho Panza und deren unterschiedliche Wahrnehmung der Realität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Inhaltsübersicht (mit Unterkapiteln zur Geschichte des Wahnsinns, Don Quijote aus psychiatrischer Sicht, pathologischer Diagnose, Wahnsinn als Metapher, Wahnsinn und Idealismus, Quijote, Sancho und die Welt, sowie Wahnsinn und Fiktion) und ein Kapitel mit dem Titel "La razón de la sinrazón".
Wie wird der Wahnsinn in der Arbeit betrachtet?
Der Wahnsinn wird aus verschiedenen Perspektiven betrachtet: historisch-kulturell (Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheiten), psychopathologisch (Diagnose Don Quijotes), literarisch-metaphorisch (Funktion des Wahnsinns im Roman) und im Kontext des Verhältnisses zwischen Don Quijote und Sancho Panza.
Welche Bedeutung hat die historische Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheiten für die Arbeit?
Die Darstellung der Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheiten vom Mittelalter bis zur Barockzeit dient als Kontext für die Interpretation von Don Quijotes Rolle und seiner Darstellung im Roman. Es wird gezeigt, wie sich die gesellschaftliche und kulturelle Wahrnehmung von Geisteskrankheiten im Laufe der Zeit veränderte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Don Quijote, Wahnsinn, Geisteskrankheit, Barockzeit, Mittelalter, Cervantes, Literaturanalyse, Metapher, Idealismus, Realität, Fiktion, Sancho Panza, Psychoanalyse.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den kulturellen Kontext des Romans zu beleuchten und verschiedene Interpretationen von Don Quijotes Geisteszustand zu analysieren, um zu einem tieferen Verständnis des Werkes beizutragen.
Wie wird die Einleitung der Arbeit beschrieben?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach Don Quijotes Geisteszustand und seiner Bedeutung für das Verständnis des Romans. Sie verweist auf die bisherige Forschungslandschaft und kündigt den methodischen Ansatz der Arbeit an.
- Quote paper
- Ulrike Decker (Author), 2001, La razón de la sinrazón - Wahnsinn und Geisteskrankheit in Don Quijote, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/14195