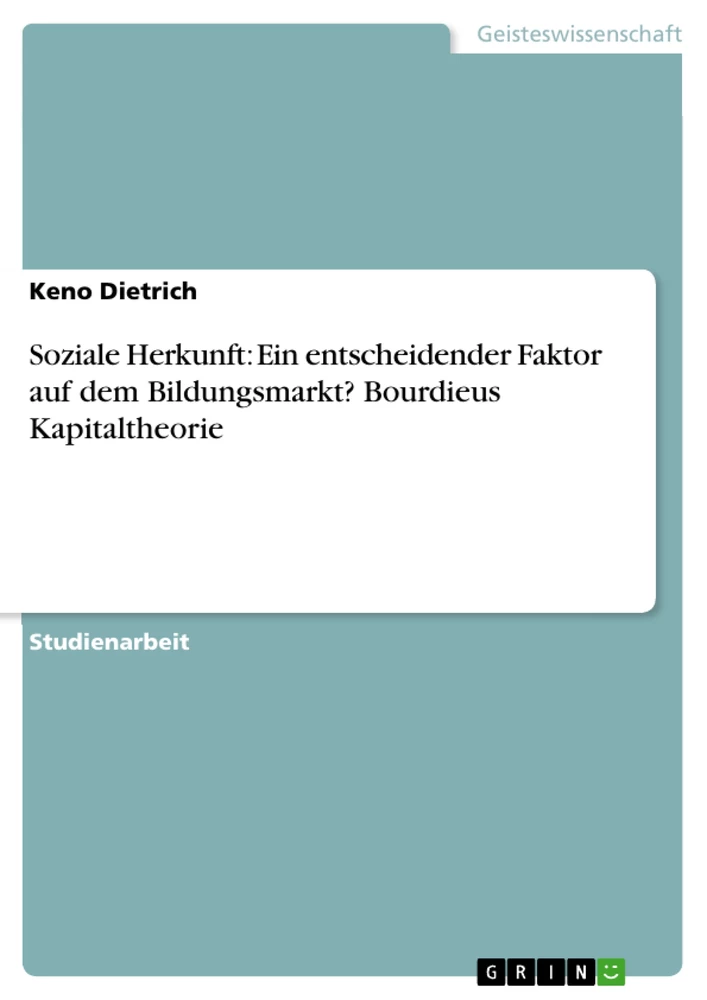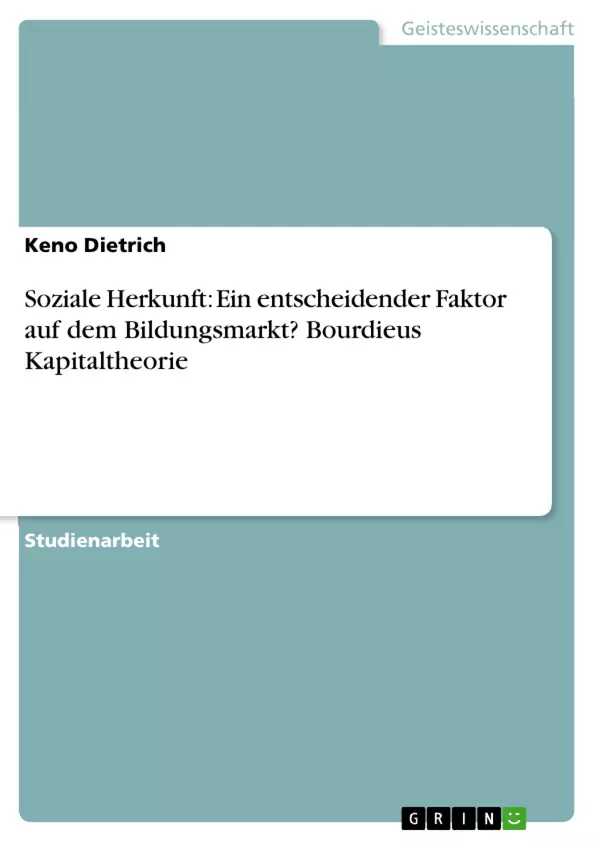Die vorliegende Arbeit ist als theoretisches Grundgerüst zur Erforschung von Bildungsungleichheiten am ersten Bildungsübergang der BRD zu verstehen. Als theoretische Basis dient hierbei die Ungleichheitstheorie Pierre Bourdieus sowie die auf Raymond Boudon zurückgehende Unterscheidung zwischen primären und sekundären Effekten der sozialen Herkunft. Aus Platzgründen ist der Rückgriff auf empirisches Material nicht möglich. Die zum Schluss, aus der Theorie heraus, formulierten
Hypothesen bieten lediglich erste Überlegungen, die der weiteren Erforschung am empirischen Material bedürfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pierre Bourdieu: Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital
- Das symbolische Kapital
- Habitus, sozialer Raum und soziale Felder
- Primäre und sekundäre Effekte sozialer Herkunft
- Hypothesengenerierung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit dient als theoretisches Fundament zur Analyse von Bildungsungleichheiten am ersten Bildungsübergang in der Bundesrepublik Deutschland. Sie basiert auf der Ungleichheitstheorie von Pierre Bourdieu und der Unterscheidung zwischen primären und sekundären Effekten der sozialen Herkunft, die auf Raymond Boudon zurückgeht. Aufgrund von Platzbeschränkungen werden keine empirischen Daten berücksichtigt. Die am Ende aus der Theorie abgeleiteten Hypothesen stellen lediglich erste Überlegungen dar, die einer weiteren empirischen Untersuchung bedürfen.
- Analyse der Bildungsungleichheiten im ersten Bildungsübergang in Deutschland
- Anwendung der Ungleichheitstheorie von Pierre Bourdieu
- Unterscheidung zwischen primären und sekundären Effekten sozialer Herkunft
- Entwicklung von Hypothesen zur Erklärung von Bildungsungleichheiten
- Bedeutung von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital für den Bildungserfolg
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und den theoretischen Rahmen der Arbeit vor. Sie erläutert den Fokus auf Bildungsungleichheiten am ersten Bildungsübergang in der Bundesrepublik Deutschland und die Verwendung der Theorie von Pierre Bourdieu sowie der Unterscheidung zwischen primären und sekundären Effekten der sozialen Herkunft. Zudem wird auf die methodische Vorgehensweise und die Limitationen der Arbeit hingewiesen.
Pierre Bourdieu: Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Erweiterung des marxschen Kapitalbegriffs durch Pierre Bourdieu. Es werden die drei Kapitalformen – ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital – vorgestellt und deren Bedeutung für die Reproduktion sozialer Ungleichheiten erläutert. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Dimensionen des kulturellen Kapitals (inkorporiertes, objektiviertes und institutionalisiertes Kapital) und deren Einfluss auf die Bildungserfolge von Individuen.
Primäre und sekundäre Effekte sozialer Herkunft
In diesem Kapitel wird die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Effekten der sozialen Herkunft beleuchtet. Dabei werden die unterschiedlichen Mechanismen, die zu Bildungsungleichheiten führen, sowie die Rolle von Kapitalformen und Habitus erläutert.
Hypothesengenerierung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Ableitung von Hypothesen aus den theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel. Es werden verschiedene Faktoren, die zu Bildungsungleichheiten beitragen können, identifiziert und in Form von Hypothesen formuliert.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheiten, Pierre Bourdieu, Ungleichheitstheorie, Soziales Kapital, Kulturelles Kapital, Ökonomisches Kapital, Habitus, Sozialer Raum, Primäre Effekte, Sekundäre Effekte, Bildungsübergang, Bundesrepublik Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Keno Dietrich (Autor:in), 2012, Soziale Herkunft: Ein entscheidender Faktor auf dem Bildungsmarkt? Bourdieus Kapitaltheorie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1419097