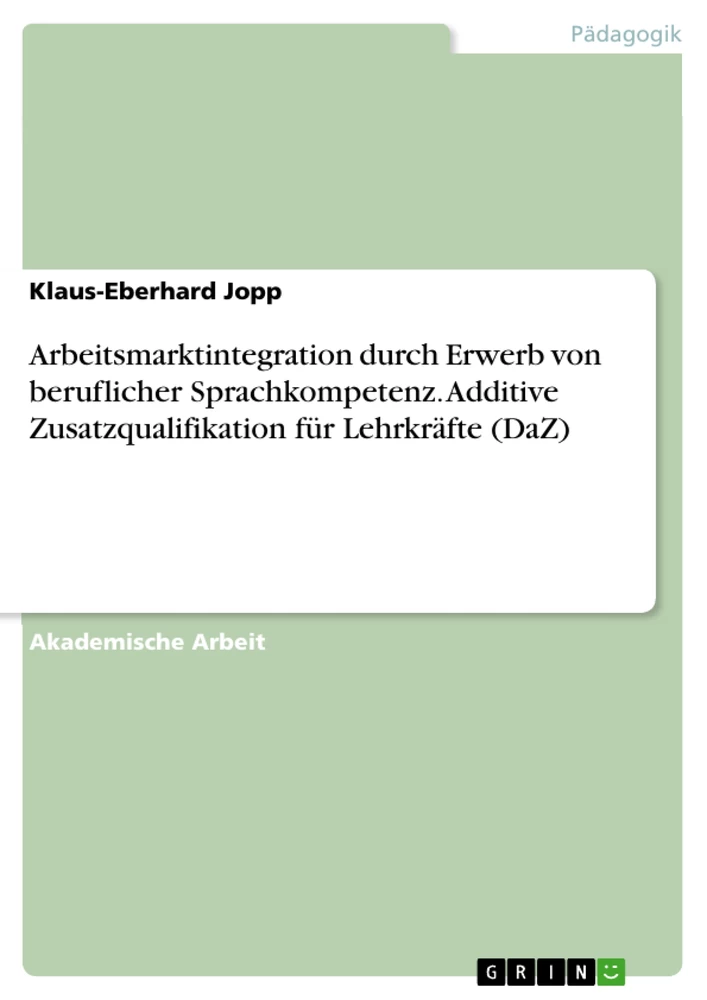Lehrkräfte im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) nehmen eine wichtige Schlüsselfunktion bei der gesellschaftlichen und beruflichen Integration von Geflüchteten und Migranten ein. Mit der Additiven Zusatzqualifikation bietet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Lehrkräften ein Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramm, das an den Anforderungen der Berufssprache in unterschiedlichsten Branchen ausgerichtet ist. Die vorliegende Studienarbeit behandelt detailliert die einzelnen Module der Fortbildung und setzt sich mit den Möglichkeiten einer gelingenden Arbeitsmarktintegration auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- Einstiegsreflexion
- Einleitung
- Ziele meiner Teilnahme an der Zusatzqualifikation BSK
- Schwächen und Stärken
- Erweiterung meiner Skills
- Beruf Pflegefachfrau/-mann: Begründung meiner Auswahl
- 1. Grundlagen der Berufspädagogik
- 2. Berufsbezogene linguistische Kompetenz
- 2.1 Textauswahl
- 2.2 Zusammenfassung des Textes
- 2.3 Textanalyse
- 3. Sprachenlernen und Schlüsselkompetenzen im Erwachsenenalter
- 3.1 Überlegungen Unterrichtseinheit eins (UE 1)
- 3.2 Unterrichtsorganisation
- 3.3 Überlegungen Unterrichtseinheit zwei (UE 2)
- 3.4 Unterrichtsorganisation
- 4. Didaktik und Methodik im berufsbezogenen Deutschunterricht
- 4.1 Dokumentation der Unterrichtsplanung (UE 1) und Reflexion
- Reflexion Micro-Teaching
- Rückmeldung der Kursleiterin zu UE1
- 4.2 Dokumentation der Unterrichtsplanung (UE 2) und Reflexion
- 5. Evaluieren, Prüfen, Testen
- 5.1 Die Balance zwischen zwei Lernzieldimensionen finden
- 5.2 Lehr- und Lernmethoden zur Prüfungsvorbereitung
- 6. Digitale Kompetenz
- 6.1 Überlegungen zur Durchführung
- 7. Aufgaben, Rollen und professionelles Handeln der LK in BSK
- 7.1 Beobachtungsbogen – Verlaufsprotokoll
- 7.2 Was ich als gelungen empfand und selbst ausprobieren möchte
- 7.3 Dazu habe ich Fragen. Das ist mir unklar.
- 7.4 Das würde ich anders machen
- 8. Interkulturalität und Integration in den Arbeitsmarkt
- Abschlussreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Arbeitsmarktintegration von Migranten durch den Erwerb von Berufssprachkompetenz. Der Fokus liegt auf der additiven Zusatzqualifizierung von Lehrkräften, um den Sprachunterricht effektiver zu gestalten und die Lerner besser auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.
- Berufssprachliche Kompetenz im Kontext der Arbeitsmarktintegration
- Didaktische und methodische Ansätze im berufsbezogenen Deutschunterricht
- Evaluierung und Prüfung von Lernerfolgen im Bereich Berufssprache
- Integration von digitalen Kompetenzen in den Unterricht
- Interkulturalität und Integration am Arbeitsplatz
Zusammenfassung der Kapitel
Einstiegsreflexion: Diese Reflexion gibt einen Überblick über den beruflichen Werdegang des Autors, der verschiedene Tätigkeiten in der Wirtschaft und Pädagogik ausübte, bevor er sich wieder dem Unterricht in Integrations- und Sprachkursen zuwandte. Sie dient als Grundlage für die Darstellung der Stärken und Schwächen im Bezug auf die Zusatzqualifizierung.
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den disruptiven und vielseitigen Werdegang des Autors, der von einem Germanistikstudium über verschiedene Tätigkeiten im Bereich Logistik und Verwaltung bis hin zum Unterricht an Krankenpflegeschulen und Deutschkursen für Spätaussiedler reichte. Schließlich führte ihn sein Weg in die Kommunikationswirtschaft und zurück in den pädagogischen Bereich, in dem er nun an der Zusatzqualifikation teilnimmt.
Ziele meiner Teilnahme an der Zusatzqualifikation BSK: Der Autor beschreibt seine Motivation, an der Zusatzqualifikation Berufssprachkompetenz teilzunehmen. Seine Erfahrungen im Bereich der Werbung und seine aktuelle Tätigkeit in Integrations- und Sprachkursen bilden den Kontext seiner Ziele, nämlich zeitgemäße Ansätze für einen berufssprachlich und arbeitsplatzorientierten Unterricht zu erlernen.
Schwächen und Stärken: Der Autor analysiert seine Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Zusatzqualifikation. Seine Stärken liegen in seinem breiten Berufswissen, seinen Erfahrungen mit Bewerbungsgesprächen und Kommunikationskampagnen sowie seiner Kreativität. Als Schwäche sieht er den Bedarf an mehr didaktischer Disziplinierung im Bereich der Methodik und Didaktik und möchte sein Wissen über digitale Lern-Apps erweitern.
Erweiterung meiner Skills: In diesem Abschnitt erläutert der Autor seine Erwartungen an die Zusatzqualifikation. Er möchte sein Wissen und seine Fähigkeiten erweitern, um seine Unterrichtsvorbereitungen gezielter auf die Bedürfnisse der Kursteilnehmer auszurichten und das Gesamtprogramm Sprache (GPS) besser verstehen und umsetzen zu können.
Beruf Pflegefachfrau/-mann: Begründung meiner Auswahl: Die Wahl des Pflegeberufs als Schwerpunkt begründet der Autor mit seinem Interesse an medizinischen Themen, seinen beruflichen Erfahrungen im Gesundheitswesen und seinen persönlichen Erfahrungen mit der Pflege einer Angehörigen. Er betont die Bedeutung des Pflegeberufs und die Notwendigkeit einer besseren gesellschaftlichen Anerkennung.
1. Grundlagen der Berufspädagogik: Dieses Kapitel behandelt das Thema Berufsanerkennung, insbesondere für Pflegeberufe. Es erläutert das Verfahren, die notwendigen Sprachkenntnisse (meist B2) und die Herausforderungen bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Das Kapitel stellt auch das Projekt Triple Win der GIZ zur Anwerbung von Pflegefachkräften aus dem Ausland vor.
2. Berufsbezogene linguistische Kompetenz: In diesem Kapitel wird die Textauswahl für das Modul "Berufsbezogene linguistische Kompetenz" erläutert. Der Autor wählte Textauszüge zum Arbeitszeitgesetz, da dieses Thema durch einen Beschluss des Bundesarbeitsgerichts an Aktualität gewonnen hat. Es folgt eine Zusammenfassung und Analyse des Textes hinsichtlich des Registers, der Kommunikationsform, Textsorte und Grammatik.
3. Sprachenlernen und Schlüsselkompetenzen im Erwachsenenalter: Dieses Kapitel beschreibt die Planung von zwei Unterrichtseinheiten im Rahmen des Micro-Teachings. Die erste Einheit konzentriert sich auf die Texterschließung des Arbeitszeitgesetzes, während die zweite Einheit die Entwicklung einer Schreibstrategie (Verfassen einer E-Mail) zum Ziel hat. Die Unterrichtsorganisation und -methoden werden detailliert dargestellt.
4. Didaktik und Methodik im berufsbezogenen Deutschunterricht: Dieses Kapitel dokumentiert die Durchführung und Reflexion der beiden Unterrichtseinheiten aus Modul 3. Es werden der Ablauf, die Methoden, die Rückmeldungen der Kursleiterin und die Lernerfolge der Teilnehmer beschrieben. Der Autor reflektiert seine Erfahrungen und identifiziert Verbesserungsansätze für zukünftige Unterrichtsplanungen.
5. Evaluieren, Prüfen, Testen: Hier wird die Herausforderung diskutiert, Lernerfolgskontrollen in berufsbezogenen B2-Spezialkursen für Gesundheitsfachberufe durchzuführen, da es noch kein einheitliches Verfahren gibt. Es werden verschiedene Lehr- und Lernmethoden zur Prüfungsvorbereitung vorgestellt, darunter regelmäßiges Wissenstraining, Lese- und Schreibübungen, Rollenspiele und die Verwendung von Mind Maps.
6. Digitale Kompetenz: Dieses Kapitel beschreibt die Überlegungen und die Durchführung einer Unterrichtssimulation mit digitalen Tools (Worldwall, Tricider, Etherpad, Mentimeter). Der Autor reflektiert seine Erfahrungen mit der technischen Umsetzung und den Lernerfolgen und schlägt Verbesserungen für zukünftige Anwendungen vor. Er erwähnt auch den Zusammenhang zwischen Deutschkenntnissen und der beruflichen Positionierung von Migranten in der Pflege.
7. Aufgaben, Rollen und professionelles Handeln der LK in BSK: Dieses Kapitel beschreibt die Hospitation im B2-Kurs "Berufsbezogenes Deutsch". Der Autor beobachtet den Unterricht, analysiert die Methoden der Kursleiterin und reflektiert über gelungene Aspekte und mögliche Verbesserungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Präsentation von Berufsbildern durch die Kursteilnehmer und der Vermittlung von Grammatik (Adjektive).
8. Interkulturalität und Integration in den Arbeitsmarkt: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Interkulturalität und Integration am Arbeitsplatz. Der Autor analysiert Lehrwerke im Hinblick auf die Behandlung dieser Themen und schlägt eine Unterrichtssequenz zum Thema Rassismus und Integration vor.
Schlüsselwörter
Arbeitsmarktintegration, Berufssprachkompetenz, Zusatzqualifizierung, Lehrkräfte, Berufssprachkurs, Didaktik, Methodik, Evaluierung, Prüfung, Digitale Kompetenz, Interkulturalität, Integration, Pflegeberuf, Arbeitszeitgesetz, Sprachlernen, Schlüsselkompetenzen, Berufsanerkennung, Gesamtprogramm Sprache (GPS), Register Berufssprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Zusatzqualifikation Berufssprachkompetenz
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Diese Studienarbeit untersucht die Arbeitsmarktintegration von Migranten durch den Erwerb von Berufssprachkompetenz. Der Fokus liegt auf der additiven Zusatzqualifizierung von Lehrkräften, um den Sprachunterricht effektiver zu gestalten und die Lerner besser auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Die Arbeit dokumentiert den Erfahrungsbericht des Autors während einer Zusatzqualifikation im Bereich Berufssprachkompetenz (BSK).
Welche Themen werden in der Studienarbeit behandelt?
Die Studienarbeit behandelt verschiedene Aspekte der berufssprachlichen Kompetenz und des berufsbezogenen Deutschunterrichts. Zu den wichtigsten Themen gehören: Berufssprachliche Kompetenz im Kontext der Arbeitsmarktintegration, didaktische und methodische Ansätze im berufsbezogenen Deutschunterricht, Evaluierung und Prüfung von Lernerfolgen, Integration digitaler Kompetenzen, Interkulturalität und Integration am Arbeitsplatz sowie die Rolle von Lehrkräften in der BSK-Zusatzqualifizierung. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Pflegeberuf.
Welche Kapitel umfasst die Studienarbeit?
Die Studienarbeit gliedert sich in mehrere Kapitel, beginnend mit einer Einstiegs- und abschließenden Abschlussreflexion. Dazwischen werden die Ziele der Teilnahme an der Zusatzqualifikation, Stärken und Schwächen des Autors, die Erweiterung seiner Skills, sowie eine Begründung der Auswahl des Pflegeberufs als Schwerpunkt beschrieben. Die Hauptkapitel befassen sich mit Grundlagen der Berufspädagogik, berufsbezogener linguistischer Kompetenz (inkl. Textanalyse), Sprachenlernen und Schlüsselkompetenzen im Erwachsenenalter (mit detaillierten Unterrichtsplanungen und Reflexionen), Didaktik und Methodik im berufsbezogenen Deutschunterricht, Evaluierung, Prüfung und Testen, digitaler Kompetenz, Aufgaben, Rollen und professionellem Handeln der Lehrkraft in BSK, sowie Interkulturalität und Integration in den Arbeitsmarkt.
Welche Methoden wurden im Rahmen der Studienarbeit angewendet?
Die Studienarbeit kombiniert Reflexion, Analyse von Lehrmaterialien und die Dokumentation eigener Unterrichtsplanungen und -durchführungen (Micro-Teaching). Der Autor analysiert Texte zum Arbeitszeitgesetz, plant und reflektiert Unterrichtseinheiten, dokumentiert die Rückmeldungen der Kursleiterin und evaluiert den Einsatz digitaler Tools. Er beobachtet außerdem den Unterricht einer erfahrenen Lehrkraft und reflektiert über deren Methoden.
Welche Ergebnisse werden in der Studienarbeit präsentiert?
Die Studienarbeit präsentiert die Erfahrungen und Reflexionen des Autors während seiner Zusatzqualifikation. Sie zeigt, wie er seine Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des berufsbezogenen Deutschunterrichts erweitert hat und wie er die gelernten Methoden und Konzepte in der Praxis anwenden kann. Die Ergebnisse umfassen detaillierte Unterrichtsplanungen, Reflexionen zur eigenen Unterrichtspraxis und zur Hospitation im B2-Kurs sowie Überlegungen zur Integration digitaler Kompetenzen und interkultureller Aspekte im Unterricht. Es wird eine fundierte Auseinandersetzung mit der Thematik der Arbeitsmarktintegration von Migranten im Pflegebereich geboten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Studienarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Arbeitsmarktintegration, Berufssprachkompetenz, Zusatzqualifizierung, Lehrkräfte, Berufssprachkurs, Didaktik, Methodik, Evaluierung, Prüfung, Digitale Kompetenz, Interkulturalität, Integration, Pflegeberuf, Arbeitszeitgesetz, Sprachenlernen, Schlüsselkompetenzen, Berufsanerkennung, Gesamtprogramm Sprache (GPS), Register Berufssprache.
Für wen ist diese Studienarbeit relevant?
Diese Studienarbeit ist relevant für Lehrkräfte, die im Bereich des berufsbezogenen Deutschunterrichts tätig sind oder sich dafür interessieren. Sie ist auch interessant für Personen, die sich mit der Arbeitsmarktintegration von Migranten und der Bedeutung von Berufssprachkompetenz befassen. Weiterhin bietet sie Einblicke in die didaktischen und methodischen Ansätze im Umgang mit digitalen Medien im Unterricht.
- Arbeit zitieren
- Klaus-Eberhard Jopp (Autor:in), 2023, Arbeitsmarktintegration durch Erwerb von beruflicher Sprachkompetenz. Additive Zusatzqualifikation für Lehrkräfte (DaZ), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1416344