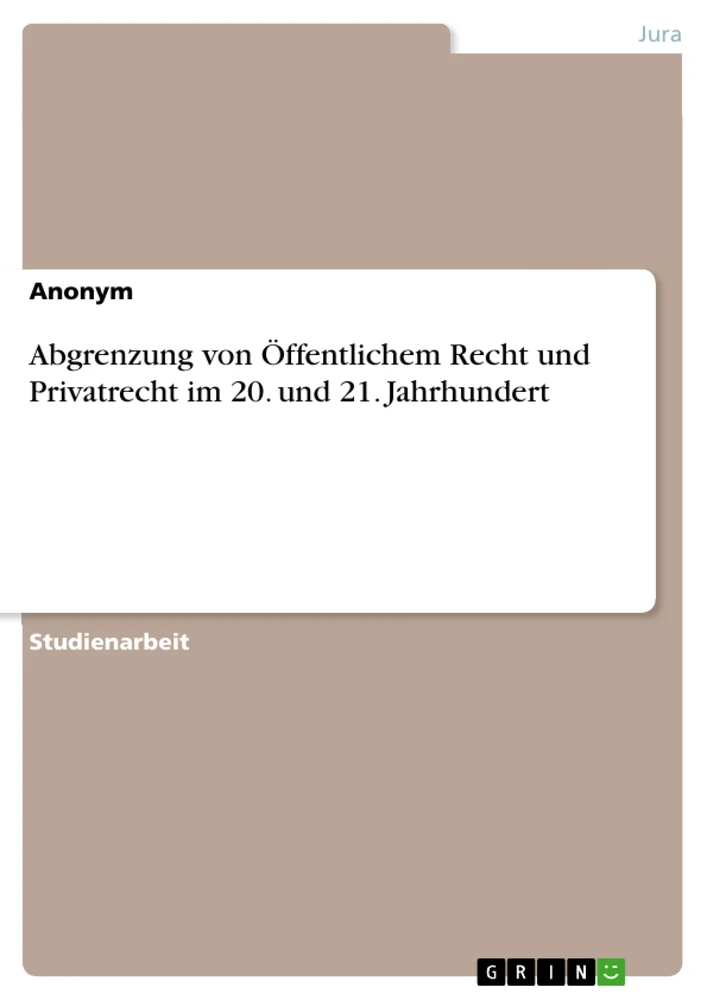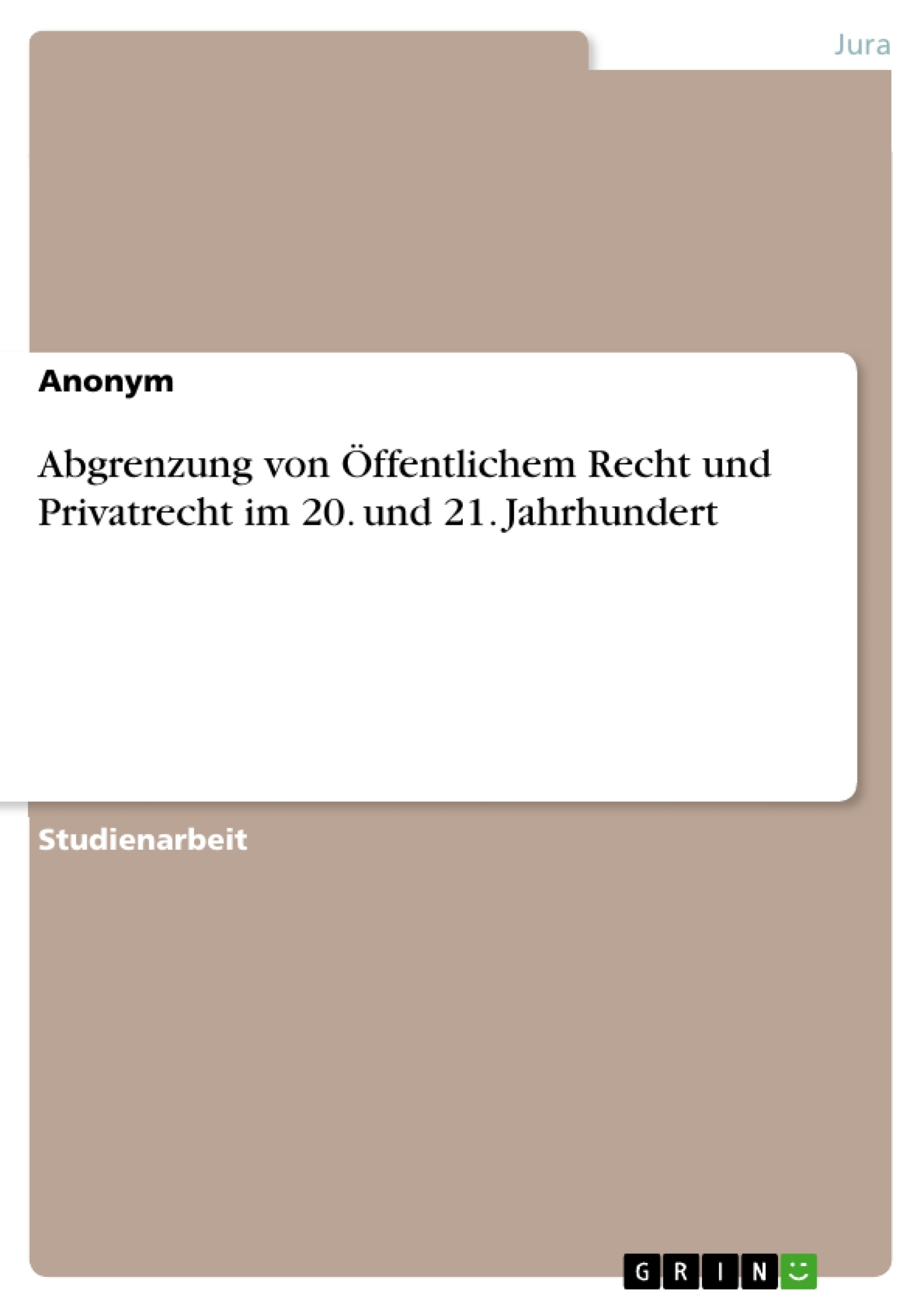Während sich im liberalen Rechtsstaat des 19. Jahrhunderts die Dichotomie „Öffentliches Recht und Privatrecht" als Ausfluss der strikten Trennung zwischen Staat und Gesellschaft i. S. e. strikten Gegensatzes herausbildete und das Privatrecht als die vorrangige Teilrechtsordnung angesehen wurde, wurde in den einzelnen Phasen des 20. und 21. Jahrhunderts ein starker Autonomieverlust des Privatrechts und darüber hinaus bzw. dadurch auch ein Bedeutungsverlust der Dichotomie beobachtet.
Aufgrund dieser angedeuteten Entwicklungen und der damit einhergehenden nach wie vor bestehenden Aktualität, soll der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Fragestellung liegen, ob die Unterscheidung heutzutage dennoch berechtigt und sinnvoll erscheint. Soll also die Unterscheidung aufgehoben/aufgegeben werden? Soll ihr lediglich eine sehr geringe Bedeutung zukommen? Oder soll die Unterscheidung vielmehr unter Anerkennung eines gewissen Bedeutungsverlustes aufrechterhalten werden? Diejenigen, die weiterhin die Unterscheidung für berechtigt und sinnvoll halten, betonen dabei jedoch, dass mittlerweile nicht mehr die Abgrenzungsfrage, sondern vielmehr die Feinabstimmung2 der beiden im Wettbewerb stehenden Teilrechtsordnungen, im Vordergrund stehen würde.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Kurzer Rückblick: Liberaler Rechtsstaat im 19. Jahrhundert - Strikte Trennung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht
- I. Strikte Trennung zwischen Staat und Gesellschaft als Grundlage für die Dichotomie „Öffentliches Recht und Privatrecht"; dabei Vorrang des Privatrechts
- II. Entstehung des BGB, zugleich Wende zum 20. Jahrhundert
- C. Bedeutungsverlust des Privatrechts und der Dichotomie innerhalb des 20. und 21. Jahrhunderts
- I. Abkehr vom Liberalismus mit seiner strikten Trennung von Staat und Gesellschaft in der Weimarer Republik
- 1. Kurze geschichtliche Einordnung: Weimarer Republik (9.11.1918 - 30.1.1933)
- 2. Schon hier Bedeutungsgewinn des öffentlichen Rechts als Abkehr vom Liberalismus des 19. Jahrhunderts
- II. Nahezu vollständiger Verlust der Bedeutung des Privatrechts und der Dichotomie „Öffentliches Recht und Privatrecht" in den beiden totalitären Staatssystemen
- 1. Nationalsozialistische Diktatur (seit dem 30.1.1933)
- 2. Sozialistische Diktatur der DDR (seit 1945/49)
- III. Aber auch in dem sozialen Rechtsstaat der BRD ab 1945 Bedeutungsverlust des Privatrechts und der Dichotomie
- 1. Autonomieverlust des Privatrechts durch zahlreiche Beschränkungen der Privatautonomie; insbesondere durch die (mittelbare) Drittwirkung der Grundrechte
- 2. Einfluss dieser Entwicklungen und weiterer Verschränkungen der Teilrechtsordnungen auf die Unterscheidung von öffentlichem und privatem Recht insbesondere im 21. Jahrhundert
- I. Abkehr vom Liberalismus mit seiner strikten Trennung von Staat und Gesellschaft in der Weimarer Republik
- D. Dennoch Sinn und Berechtigung einer weiteren Unterscheidung zwischen Öffentlichem Recht und Privatrecht?
- I. Überblick über den Meinungsstand zu den Konsequenzen aus dem Bedeutungsverlust der Dichotomie: Aufrechterhaltung der Unterscheidung?
- II. Stellungnahme: vor allem Bestimmung des Wesens der beiden Teilrechtsordnungen
- III. Bestimmung des Wesens der beiden Teilrechtsordnungen - Unterscheidung sinnvoll?
- IV. Weiterhin Unterscheidung sinnvoll und berechtigt, dabei Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen
- E. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Abgrenzung zwischen öffentlichem und privatem Recht im 20. und 21. Jahrhundert. Sie analysiert den Bedeutungsverlust der traditionellen Dichotomie im Kontext verschiedener politischer Systeme und juristischer Entwicklungen. Die Arbeit beleuchtet sowohl die historische Entwicklung als auch aktuelle Debatten um die weiterhin bestehende Relevanz dieser Unterscheidung.
- Historische Entwicklung der Dichotomie „Öffentliches Recht und Privatrecht"
- Einfluss totalitärer Systeme auf die Abgrenzung
- Drittwirkung der Grundrechte und ihr Einfluss auf das Privatrecht
- Aktuelle Debatten um die Relevanz der Unterscheidung
- Wesensmerkmale des öffentlichen und privaten Rechts
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung dient als kurzer Überblick über die Thematik der Arbeit und führt in die folgenden Kapitel ein. Sie skizziert die Problematik des Bedeutungsverlusts der traditionellen Trennung von öffentlichem und privatem Recht und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor.
B. Kurzer Rückblick: Liberaler Rechtsstaat im 19. Jahrhundert - Strikte Trennung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht: Dieses Kapitel beleuchtet den liberalen Rechtsstaat des 19. Jahrhunderts und die strikte Trennung zwischen öffentlichem und privatem Recht, die ihn charakterisierte. Es wird die klare Abgrenzung zwischen Staat und Gesellschaft und die damit verbundene Vorrangstellung des Privatrechts herausgearbeitet. Die Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) wird als wichtiger Meilenstein in diesem Kontext eingeordnet und als Übergang zum 20. Jahrhundert dargestellt.
C. Bedeutungsverlust des Privatrechts und der Dichotomie innerhalb des 20. und 21. Jahrhunderts: Dieses Kapitel analysiert den zunehmenden Bedeutungsverlust der Dichotomie im 20. und 21. Jahrhundert. Es untersucht die Abkehr vom Liberalismus in der Weimarer Republik und den nahezu vollständigen Verlust der Bedeutung der Unterscheidung unter den totalitären Systemen des Nationalsozialismus und der DDR. Darüber hinaus wird der Bedeutungsverlust im Kontext des sozialen Rechtsstaates der Bundesrepublik Deutschland untersucht, wobei insbesondere die Drittwirkung der Grundrechte und deren Auswirkungen auf die Privatautonomie im Mittelpunkt stehen. Wichtige Gerichtsentscheidungen (z.B. Lüth-Urteil, Entscheidungen zum Stadionverbot oder Facebook-Sperrung) werden analysiert und kritisch bewertet.
D. Dennoch Sinn und Berechtigung einer weiteren Unterscheidung zwischen Öffentlichem Recht und Privatrecht?: Das Kapitel diskutiert die Frage nach der Sinnhaftigkeit und Berechtigung der Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht trotz des festgestellten Bedeutungsverlusts der Dichotomie. Es werden verschiedene Meinungen und Ansätze dazu vorgestellt und kritisch gewürdigt. Im Fokus steht die Bestimmung des Wesens beider Rechtsordnungen, ihre jeweiligen Aufgaben, Funktionen und Prinzipien, sowie die Stellung des Individuums in beiden Bereichen. Die Analyse zeigt, dass trotz Überschneidungen weiterhin wesentliche Unterschiede bestehen und die Unterscheidung als sinnvolle, wenn auch modifizierte, Kategorisierung erhalten bleiben sollte. Die Argumentation stützt sich auf eine differenzierte Analyse der Abgrenzungstheorien und deren praktische Handhabbarkeit. Das Kapitel argumentiert schließlich für die Beibehaltung der Unterscheidung, indem es Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen charakterisiert.
Schlüsselwörter
Öffentliches Recht, Privatrecht, Dichotomie, Rechtsstaat, Liberalismus, Totalitarismus, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, DDR, Bundesrepublik Deutschland, Drittwirkung der Grundrechte, Privatautonomie, Verfassungsrecht, Zivilrecht, Regulierung, Abgrenzungstheorien, Gemeinrechtslehre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Bedeutungsverlust der Dichotomie Öffentliches Recht/Privatrecht
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung und den Bedeutungsverlust der traditionellen Trennung zwischen öffentlichem und privatem Recht im 20. und 21. Jahrhundert. Sie analysiert den Wandel dieser Dichotomie im Kontext verschiedener politischer Systeme (Weimarer Republik, Nationalsozialismus, DDR, Bundesrepublik Deutschland) und juristischer Entwicklungen, insbesondere der Drittwirkung der Grundrechte.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Dichotomie "Öffentliches Recht und Privatrecht", den Einfluss totalitärer Systeme auf die Abgrenzung, die Drittwirkung der Grundrechte und deren Einfluss auf das Privatrecht, aktuelle Debatten um die Relevanz der Unterscheidung sowie die Wesensmerkmale des öffentlichen und privaten Rechts. Sie betrachtet auch wichtige Gerichtsentscheidungen, die diese Entwicklungen prägten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Rückblick auf den liberalen Rechtsstaat des 19. Jahrhunderts mit seiner strikten Trennung von öffentlichem und privatem Recht, eine Analyse des Bedeutungsverlustes dieser Dichotomie im 20. und 21. Jahrhundert, eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der weiterhin bestehenden Unterscheidung und eine abschließende Zusammenfassung. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterpunkte.
Welchen Zeitraum umfasst die Analyse?
Die Analyse erstreckt sich über das 19. Jahrhundert, das 20. Jahrhundert und den Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie betrachtet die Entwicklung von der strikten Trennung im liberalen Rechtsstaat bis hin zum Bedeutungsverlust dieser Trennung im Kontext des sozialen Rechtsstaates und der totalitären Regime.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Trotz des festgestellten Bedeutungsverlusts der Dichotomie "Öffentliches Recht/Privatrecht" argumentiert die Arbeit für die Beibehaltung der Unterscheidung, indem sie Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen charakterisiert. Obwohl Überschneidungen bestehen, bleiben wesentliche Unterschiede bestehen, die eine sinnvolle, wenn auch modifizierte, Kategorisierung rechtfertigen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Öffentliches Recht, Privatrecht, Dichotomie, Rechtsstaat, Liberalismus, Totalitarismus, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, DDR, Bundesrepublik Deutschland, Drittwirkung der Grundrechte, Privatautonomie, Verfassungsrecht, Zivilrecht, Regulierung, Abgrenzungstheorien, Gemeinrechtslehre.
Welche Quellen werden verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist nicht explizit in der bereitgestellten HTML-Struktur enthalten. Weitere Informationen wären in der vollständigen Arbeit zu finden.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit der Entwicklung des Rechts und der Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht auseinandersetzt. Sie eignet sich für Studierende der Rechtswissenschaften und Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen befassen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Abgrenzung von Öffentlichem Recht und Privatrecht im 20. und 21. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1415320