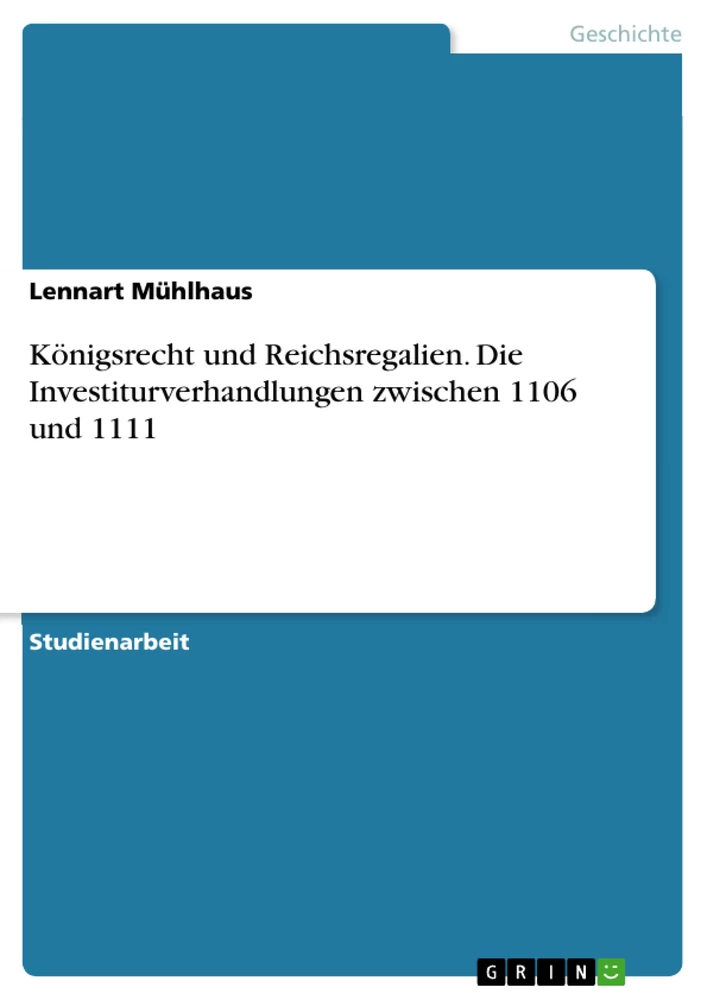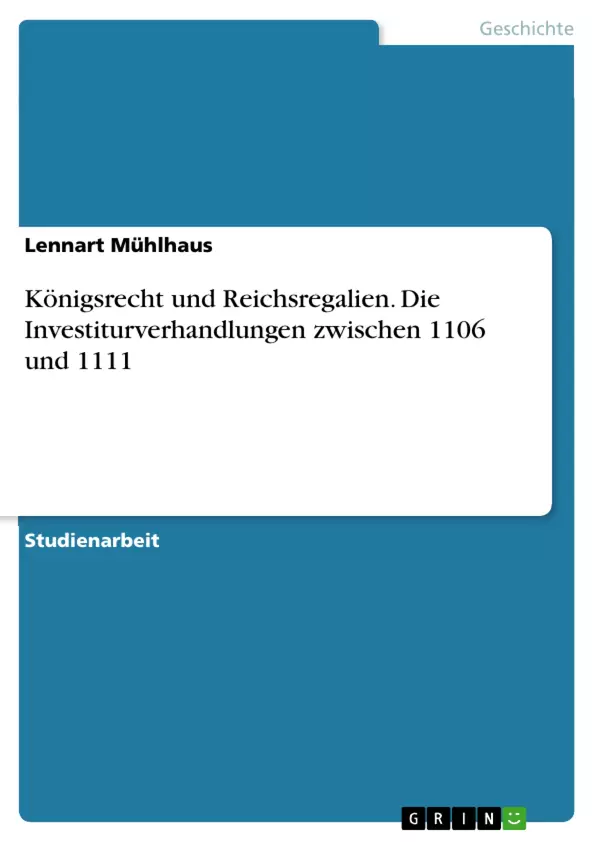In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, warum es auch mit Henrich V. zunächst nicht zu einer Einigung
in der Investiturfrage kam und wie und warum der Vertrag von 1111 dann trotzdem möglich gemacht wurde. Dafür soll zunächst auf die Ausgangssituation im Verhältnis zwischen König und Papst zum Herrschaftsantritt Heinrichs V. 1105 sowie dessen Entwicklung in den darauffolgenden Jahren eingegangen werden.
Da die Investiturfrage in diesen Jahren in England und Frankreich gelöst wurde, sollen auch diese Einigungen sowie mögliche Gründe, warum der Investiturstreit im römisch-deutschen Reich so viel länger andauerte und so viel konfliktreicher war als in den anderen beiden Reichen, näher betrachtet werden.
Im zweiten Teil wird es um den Italienfeldzug Heinrichs und die Verhandlungen bis zum Vertragsschluss und seiner Kaiserkrönung gehen, wobei die Argumentationsweise der kaiserlichen Seite anhand des Traktats de investitura episcoporum
analysiert und auf mögliche Parallelen zum Vertrag von Santa Maria in Turri untersucht werden soll, vor allem, was das Verständnis von Kirchenbesitz betrifft.
Wohl kaum ein Konflikt hat die salische Königs- und Kaiserdynastie so sehr geprägt wie der Investiturstreit. Er nahm ungefähr die Hälfte der hunderteinjährigen salischen Herrschaft über das römisch-deutsche Reich und nahezu die gesamte Herrschaft der Kaiser Heinrich IV. und seinem Sohn Heinrich V. ein.
Der Konflikt, in dem sich König und Papst um die Frage nach der Einsetzung der Bischöfe stritten, wurde ursprünglich zwischen Heinrich IV. und Papst Gregor VII. geführt und fand im Gang nach Canossa 1077 seinen ersten Höhepunkt und bestimmte auch die nachfolgenden Jahrzehnte maßgeblich, bis Heinrich V. und Papst Calixt II. ihn im Jahr 1122 im Wormser Konkordat beilegten.
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Einleitung
- 2.) Festgefahrene Verhandlungen 1106/07
- 2.1.) Die Synode von Guastella
- 2.2.) Verhandlungen bei Châlons und das Konzil von Troyes
- 2.3.) Der Investiturstreit in Frankreich und England
- 3.) Der Regalienbegriff bei den Verhandlungen zur Kaiserkrönung
- 3.1.) Der Italienzug Heinrichs V. und erstes Aufeinandertreffen
- 3.2.) Die Argumentation der kaiserlichen Seite am Beispiel des Traktats „de investitura episcoporum“
- 3.3.) Eine Lösung der Investiturfrage? Der Vertrag von Santa Maria in Turri
- 4.) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gescheiterten Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich V. und Papst Paschalis II. zum Investiturstreit zwischen 1106 und 1111. Sie analysiert die Gründe für das Scheitern frühzeitiger Lösungsansätze und beleuchtet den Weg zum Vertrag von 1111, der zwar zunächst erfolgreich schien, aber letztendlich zum erneuten Ausbrechen des Konflikts führte. Die Arbeit fokussiert auf die Entwicklung der Verhandlungen und die jeweiligen Argumentationen beider Seiten.
- Die anfänglichen Hoffnungen auf eine schnelle Lösung des Investiturstreits unter Heinrich V.
- Die Rolle der Synoden und Verhandlungen in Guastella und Châlons-sur-Marne.
- Der Regalienbegriff und seine Bedeutung in den Verhandlungen.
- Die Argumentation der kaiserlichen Seite, insbesondere im Kontext des Traktats „de investitura episcoporum“.
- Der Vertrag von 1111 und sein Scheitern.
Zusammenfassung der Kapitel
1.) Einleitung: Die Einleitung skizziert den Investiturstreit als prägenden Konflikt der salischen Kaiserdynastie, der sich über Jahrzehnte hinzog und die Herrschaft Heinrichs IV. und Heinrichs V. maßgeblich beeinflusste. Sie hebt den Konflikt zwischen König und Papst um die Einsetzung von Bischöfen hervor, wobei der Gang nach Canossa 1077 als erster Höhepunkt und das Wormser Konkordat 1122 als endgültige Lösung genannt werden. Der Fokus liegt auf dem gescheiterten Vertrag von 1111 und den Gründen für das anhaltende Scheitern der Verhandlungen unter Heinrich V., trotz anfänglicher Hoffnungen auf eine schnelle Einigung.
2.) Festgefahrene Verhandlungen 1106/07: Dieses Kapitel analysiert die Verhandlungen zwischen Heinrich V. und Papst Paschalis II. in den Jahren 1106 und 1107. Es beginnt mit der Synode von Guastella im Jahr 1106, deren Ziel die Beseitigung der Nachwirkungen des Schismas und die Klärung des Verhältnisses zwischen Kirche und Reich war. Obwohl Paschalis Kompromissbereitschaft zeigte, indem er bereits investierte Bischöfe bestätigte, blieben die Positionen hinsichtlich der Laieninvestitur unvereinbar. Die anschließenden Verhandlungen bei Châlons-sur-Marne im Jahr 1107 zeigten die anhaltende Unvereinbarkeit der Positionen, da Heinrich die Investitur als rein weltlichen Akt darstellte, während Paschalis auf dem geistlichen Aspekt bestand. Die unterschiedlichen Interpretationen des „ius regni“ und die Abwesenheit führender deutscher Kleriker unterstrichen die Schwierigkeiten einer Einigung.
Schlüsselwörter
Investiturstreit, Heinrich V., Papst Paschalis II., Regalien, Laieninvestitur, „ius regni“, Synode von Guastella, Verhandlungen von Châlons-sur-Marne, Vertrag von 1111, Traktat „de investitura episcoporum“, Schisma, Kaiserkrönung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Investiturstreit unter Heinrich V.
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die gescheiterten Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich V. und Papst Paschalis II. zum Investiturstreit in den Jahren 1106 bis 1111. Sie untersucht die Gründe für das Scheitern früher Lösungsansätze und beleuchtet den Weg zum Vertrag von 1111, der zwar anfänglich erfolgreich schien, aber letztendlich zum erneuten Ausbrechen des Konflikts führte. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Verhandlungen und den Argumentationen beider Seiten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt u.a. die anfänglichen Hoffnungen auf eine schnelle Lösung, die Rolle der Synoden und Verhandlungen in Guastella und Châlons-sur-Marne, den Regalienbegriff und seine Bedeutung, die Argumentation der kaiserlichen Seite (besonders im Kontext des Traktats „de investitura episcoporum“), und das Scheitern des Vertrags von 1111.
Welche Ereignisse werden in Kapitel 2 ("Festgefahrene Verhandlungen 1106/07") beschrieben?
Kapitel 2 analysiert die Verhandlungen von 1106 und 1107. Es beginnt mit der Synode von Guastella (1106), die die Klärung des Verhältnisses zwischen Kirche und Reich zum Ziel hatte. Trotz Kompromissbereitschaft Paschalis' blieben die Positionen zur Laieninvestitur unvereinbar. Die Verhandlungen in Châlons-sur-Marne (1107) zeigten die anhaltende Unvereinbarkeit, da Heinrich die Investitur als weltlichen Akt, Paschalis als geistlichen Akt sah. Unterschiedliche Interpretationen des „ius regni“ und das Fehlen deutscher Kleriker erschwerten eine Einigung.
Welche Bedeutung hat der Regalienbegriff in den Verhandlungen?
Der Regalienbegriff spielt eine zentrale Rolle in den Verhandlungen. Die Arbeit untersucht seine Bedeutung im Kontext der Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Papst um die Einsetzung von Bischöfen und die damit verbundenen weltlichen und geistlichen Rechte.
Welche Rolle spielt der Traktat „de investitura episcoporum“?
Der Traktat „de investitura episcoporum“ dient als Beispiel für die Argumentation der kaiserlichen Seite. Die Arbeit analysiert die Argumente, die im Traktat vorgebracht werden, um die Position Heinrichs V. zu verstehen.
Was war das Ergebnis des Vertrags von 1111 und warum scheiterte er?
Der Vertrag von 1111 schien zunächst erfolgreich, führte aber letztendlich zum erneuten Ausbrechen des Konflikts. Die Arbeit analysiert die Gründe für sein Scheitern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Thematik der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Investiturstreit, Heinrich V., Papst Paschalis II., Regalien, Laieninvestitur, „ius regni“, Synode von Guastella, Verhandlungen von Châlons-sur-Marne, Vertrag von 1111, Traktat „de investitura episcoporum“, Schisma, Kaiserkrönung.
Wie wird die Einleitung (Kapitel 1) gestaltet?
Die Einleitung skizziert den Investiturstreit als prägenden Konflikt der salischen Kaiserdynastie, hebt den Konflikt um die Einsetzung von Bischöfen hervor (Gang nach Canossa 1077, Wormser Konkordat 1122) und fokussiert auf das Scheitern des Vertrags von 1111 und die Gründe für das anhaltende Scheitern der Verhandlungen unter Heinrich V.
- Arbeit zitieren
- Lennart Mühlhaus (Autor:in), 2023, Königsrecht und Reichsregalien. Die Investiturverhandlungen zwischen 1106 und 1111, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1414969