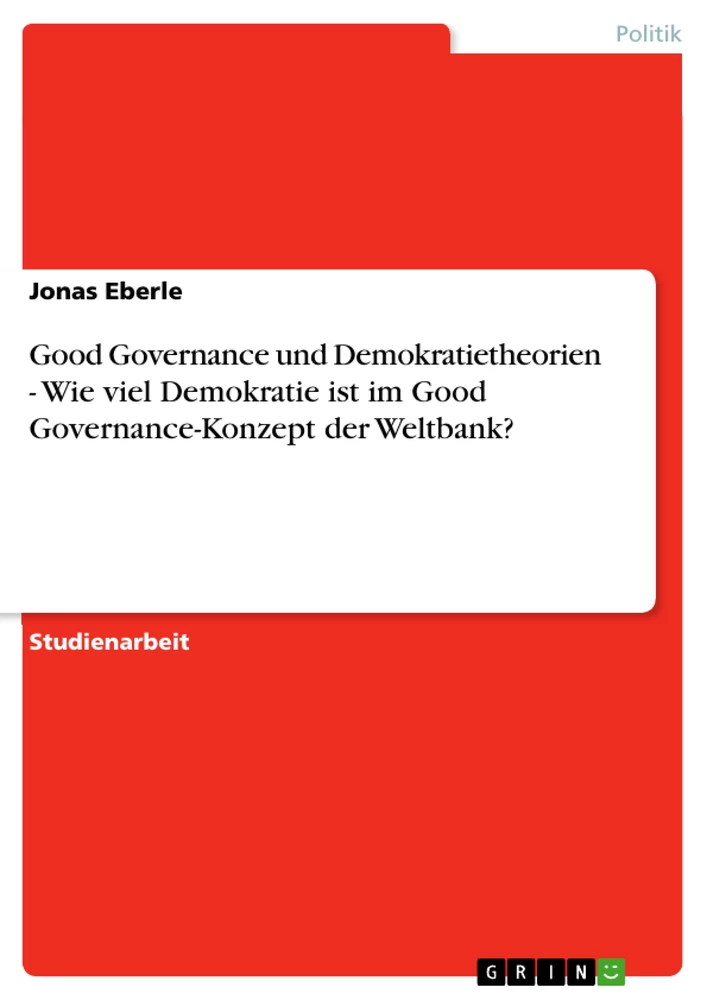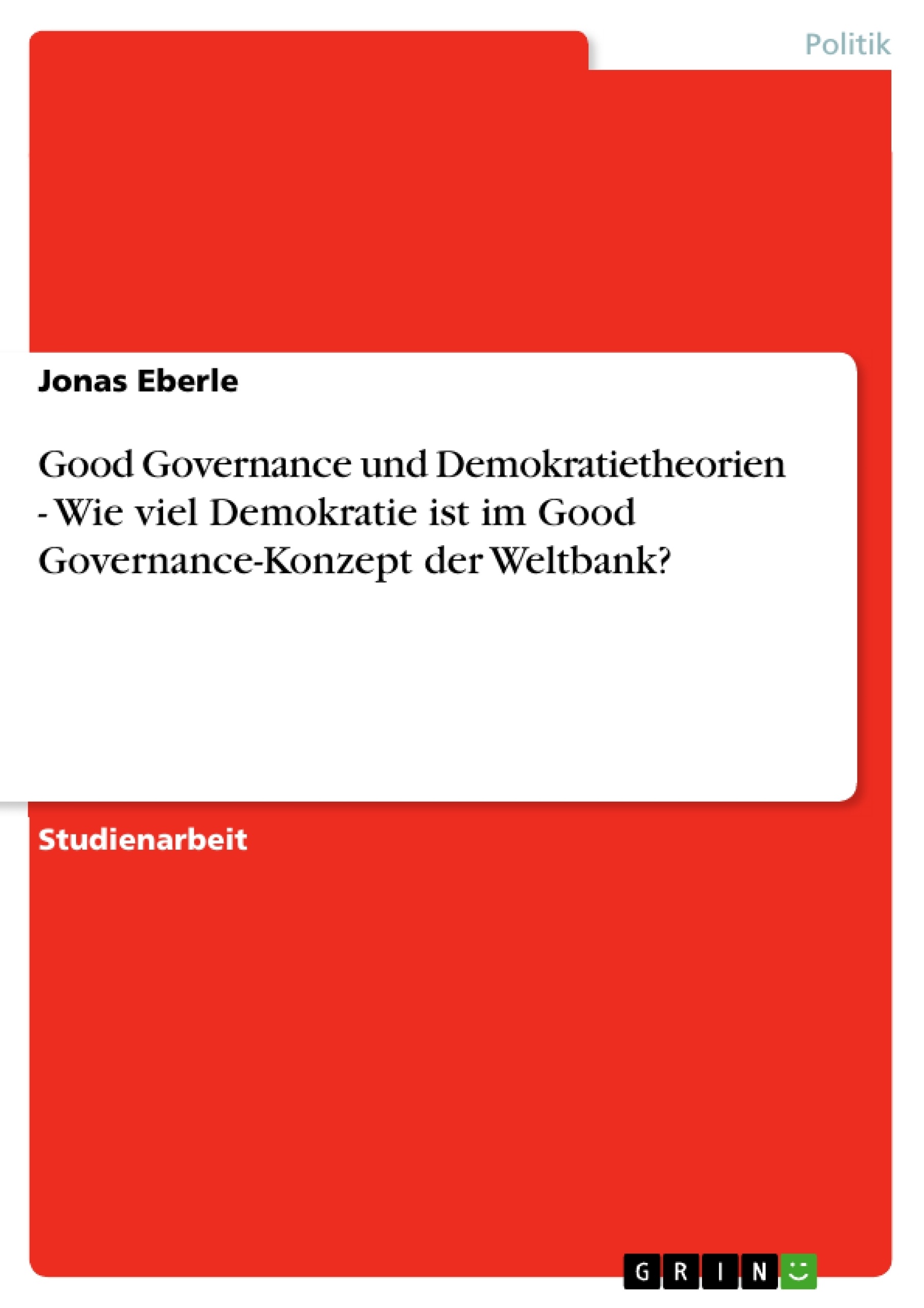‚Good Governance’ ist ein z.Zt. vieldiskutierter Ansatz der Verwaltungswissenschaft und Entwicklungspolitik. Er findet in der praktischen Politik (bei UN, OECD, Weltbank, GTZ/BMZ u.a.) global Anwendung.
Eine erste Literaturschau macht deutlich, dass der Versuch einer sowohl genauen als auch allgemeinen Begriffsbestimmung von ‚Good Governance’ Schwierigkeiten bereiten kann. Markus Adam schreibt dazu:
„[...] es gibt keine bestimmte, präjudizierende Interpretation des Begriffes weder in der akademischen noch in der populären Sprache. Auch ist die Abgrenzung schwierig, und die Grenzen zu anderen verwandten Begriffen wie dem des „government“ sind weich. Als Ergebnis findet sich in der Literatur eine unglaubliche Fülle von Definitionen, die sich keineswegs auf dasselbe Set an Problemen oder Phänomenen beziehen müssen. Und es ist darüber hinaus schwierig, die sehr unterschiedliche Nutzung des Begriffes Governance zu klassifizieren und in eine Typologie zu bringen.“
Doch kann für einen sinnvollen Gebrauch des Begriffes ‚Good Governance’ eine präzise Bestimmung nicht entbehrt werden, um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Da er in verschiedenen Kontexten in unterschiedlicher Weise angewandt wird, muss die Definition mit Bedacht ausgeführt werden.
Zunächst wird daher in einer Literaturdiskussion nach dem Wesen des Begriffs gefragt. Wie beschreibt er das, auf das er in der praktischen Entwicklungspolitik bei diversen Organisationen angewendet wird?
Ist das Wesen bestimmt, wird ein Beispiel einer aktuellen Anwendung folgen. Es wird bewusst ein Auszug aus publizistischem, nicht explizit wissenschaftlichem Material sein, um Unterschiede zu verdeutlichen.
Danach wird es eingehender um den ‚Good Governance’ – Ansatz der Weltbank gehen. Die Wahl fällt auf diese Organisation, da sie multinational agiert, eine hohe weltweite Akzeptanz und dadurch entsprechenden Vorbildcharakter aufweist, eine lange Tradition der Beschäftigung mit Entwicklungs-Fragen besitzt und vermutlich den elaboriertesten ‚Good Governance’ – Ansatz bietet. Außerdem bietet sich die Weltbank aufgrund der Tatsache an, dass einige Fachliteratur auf sie Bezug nimmt. Dies erleichtert die Einordnung in die Fachdiskussion.
Jeder Ansatz repräsentiert (idealerweise) ein vollständiges Handlungsmodell, dem sich nur unter Beachtung aller seiner relevanten Elemente sinnvoll genähert und dem nur so gerecht werden kann. Eine Vermischung ist gefährlich und soll vermieden werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1. Good Governance
- I.2. Demokratietheorie
- II. Hauptteil
- I.3. Begriffsbestimmung
- I.3.1 Governance und die Konnotation „good“
- I.3.2 Beispiele für Good Governance - Konzepte
- I.4. Das Good Governance – Konzept der Weltbank
- I.4.1 Grundlegende Demokratieprinzipien
- I.4.2 Vertragstheorie / Kontraktualismus
- I.4.3 Input/Output-Orientierung
- I.4.4 Pluralismus
- I.3. Begriffsbestimmung
- II. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept von „Good Governance“ im Kontext der Weltbank und untersucht, inwiefern dieses Konzept mit demokratischen Prinzipien in Einklang steht. Die Analyse konzentriert sich auf die Definition von „Good Governance“, die Entwicklungsperspektive der Weltbank und die Relevanz demokratischer Elemente in diesem Konzept.
- Begriffsbestimmung von „Good Governance“ und seine Anwendung in der Praxis
- Das „Good Governance“-Konzept der Weltbank und seine Implikationen
- Die Rolle von Demokratie im „Good Governance“-Ansatz der Weltbank
- Kritikpunkte und Herausforderungen des „Good Governance“-Konzepts
- Zusammenhang zwischen „Good Governance“ und nachhaltiger Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über das Konzept „Good Governance“ und seine Relevanz in der heutigen Zeit. Sie stellt die Beziehung zu demokratischen Prinzipien und den normativen Charakter dieses Ansatzes dar. Im Hauptteil wird die Begriffsbestimmung von „Good Governance“ und seine Anwendung in verschiedenen Kontexten beleuchtet. Dabei werden die drei Hauptaspekte von Governance, wie von Peter Blunt definiert, sowie der „Managerialismus“-Aspekt, wie von der Weltbank vertreten, analysiert. Darüber hinaus wird die Konnotation von „good“ im Zusammenhang mit Governance diskutiert. Die Untersuchung fokussiert sich dann auf das „Good Governance“-Konzept der Weltbank, wobei die grundlegenden Demokratieprinzipien, die Vertragstheorie und die Input/Output-Orientierung sowie der Pluralismus als wichtige Elemente des Ansatzes hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter in dieser Arbeit sind „Good Governance“, „Demokratie“, „Weltbank“, „Entwicklungspolitik“, „Governance“, „Managerialismus“, „Vertragstheorie“, „Input/Output-Orientierung“ und „Pluralismus“. Diese Begriffe repräsentieren die Kernkonzepte der Arbeit, die sich mit dem Zusammenspiel von „Good Governance“ und demokratischen Prinzipien im Kontext der Weltbank auseinandersetzen.
- Quote paper
- Jonas Eberle (Author), 2002, Good Governance und Demokratietheorien - Wie viel Demokratie ist im Good Governance-Konzept der Weltbank?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/14136