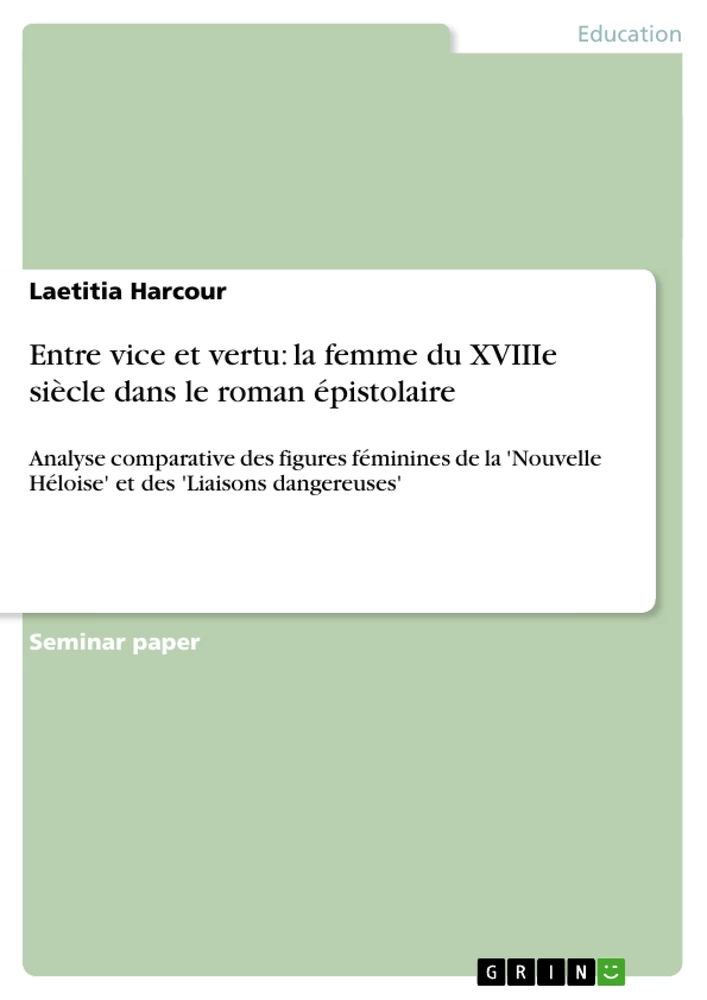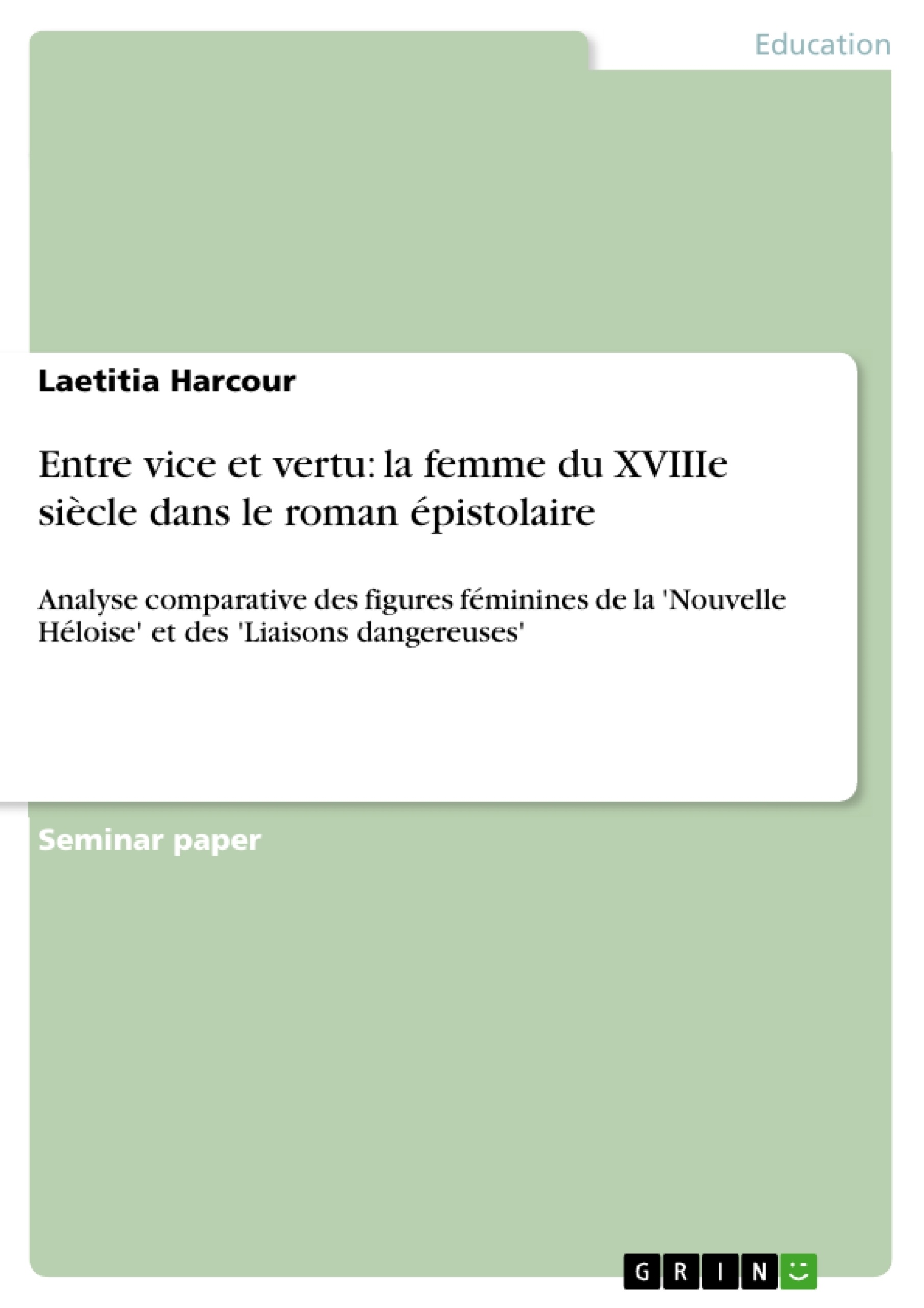Au XVIIIe siècle s´opère un changement profond du concept de vertu. De la valeur chevaleresque, on passe à la chasteté, et presque exclusivement à celle du sexe féminin. Pourtant, ce siècle des Lumières est aussi celui du libertinage, qui se caractérise par un relâchement des moeurs et aboutit à ce que l´on pourrait interpréter comme une première libération sexuelle, notable pour les femmes. Deux oeuvres majeures de la littérature de langue francaise, communément mises en parallèle autant en raison de l´intertextualité présente dans l´oeuvre de Laclos que pour leur positionnement par rapport à ce concept de vertu, permettent de s´interroger sur la nature réelle de cette évolution.
Inhaltsverzeichnis
- INTRODUCTION.
- 1. LE XVIIIE SIECLE : SIECLE DES LUMIERES OU SIECLE DE LIBERTINAGE ?
- 1.1. Les auteurs licencieux et leur rapport à la société.
- 1.1.1. L'érotisme de Crébillon......
- 1.1.2. Sade ou la pornographie raisonnée..
- 1.2. Liberté de l'esprit et liberté du corps....
- 1.2.1. Liberté intellectuelle..
- 1.2.2. Liberté des mœurs
- 1.3. La volonté des femmes de ne pas être en reste de cette libération..
- 1.3.1. Statut juridique de la femme
- 1.3.2. Quelle émancipation avant la Révolution ?.
- 2. LA TENTATION DU VICE ET L'ASPIRATION A LA VERTU
- 2.1. La distribution des rôles dans les rapports entre hommes et femmes
- 2.1.1. L'homme qui pervertit
- 2.1.2. La femme : proie ou séductrice ?
- 2.2. La résistance garante de la vertu ?...
- 2.2.1. De l'art de faire sa cour
- 2.2.2. Résistance réelle et résistance feinte
- 2.3. Les raisons sociales
- 2.3.1. Les mariages de convenance ....
- 2.3.2. Les formes d'amour acceptées par la société.
- 3. L'EDUCATION DES FILLES
- 3.1. L'apport du XVIIIe siècle par rapport aux siècles précédents
- 3.1.1. La relation mère-fille..
- 3.1.2. Précepteurs et couvents
- 3.1.3. Théoriciens de l'éducation
- 3.2. La question traitée par les personnages dans le roman..
- 3.2.1. La soif de connaissance.
- 3.2.2. Le souci de la réputation et le poids du devoir.......
- 3.3. La volonté des auteurs : un roman pour l´édification des lectrices ?…...………………………….
- 3.3.1. La société : un lieu de perdition
- 3.3.2. Dangers de l'ignorance et avantages de l'instruction...........
- 4. LA LIBERTE HUMAINE
- 4.1. La liberté des femmes
- 4.1.1. Trop peu libres pour être vertueuses ?.
- 4.1.2. L´émancipation aux dépens de la vertu.
- 4.2. Les hommes : des êtres plus libres ?.
- 4.2.1. Prisonniers de leur condition sociale.
- 4.2.2. Prisonniers de leur propre comportement
- 4.3. La remise en question de la pensée dichotomique
- 4.3.1. Le bien et le mal dans les deux romans....
- 4.3.2. ...et la manière dont les personnages en jouent
- 4.3.3. Le rôle de l'Église et la question de la morale
- Die Entwicklung des Verträglichkeitsbegriffs im 18. Jahrhundert
- Der Einfluss von Aufklärung und Libertinage auf die Geschlechterrollen
- Die Darstellung der Frau im epistellare Roman
- Die Frage nach der Freiheit und Selbstbestimmung der Frau
- Der Einfluss von Erziehung und gesellschaftlichen Konventionen auf die Lebenswege der Protagonistinnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung der Frau im 18. Jahrhundert, insbesondere in der französischen Literatur. Im Zentrum der Analyse stehen zwei einflussreiche epistellare Romane, "Julie ou la Nouvelle Héloïse" von Jean-Jacques Rousseau und "Les Liaisons dangereuses" von Pierre Choderlos de Laclos. Die Arbeit untersucht, wie diese Romane die Rolle der Frau in einer sich wandelnden Gesellschaft spiegeln und welche Konflikte zwischen Tradition und Moderne sich in den Lebensentwürfen der weiblichen Protagonistinnen manifestieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet den Wandel des Verträglichkeitsbegriffs im 18. Jahrhundert. Sie erläutert die spezifische Situation der Frau in dieser Epoche und die Bedeutung des epistellare Romans als Medium, um gesellschaftliche Verhältnisse und individuelle Konflikte zu reflektieren.
Das erste Kapitel widmet sich der besonderen Situation des 18. Jahrhunderts, das als Jahrhundert der Aufklärung, aber auch des Libertinage gilt. Es werden die moralischen und sozialen Rahmenbedingungen für die Lebensentwürfe der Frauen analysiert.
Kapitel 2 setzt sich mit der spannungsvollen Beziehung zwischen "Vice" und "Vertu" auseinander. Die Arbeit untersucht die Rolle des Mannes als Verführer und der Frau als potentielle Opfer oder Verführerin. Die Rolle der gesellschaftlichen Konventionen und die Folgen von unstandesgemäßen Liebesbeziehungen werden beleuchtet.
Kapitel 3 konzentriert sich auf die Erziehung der Mädchen im 18. Jahrhundert. Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Bildung für Frauen und wie diese auf ihre Lebensentwürfe und ihre Interaktion mit der Gesellschaft Einfluss nehmen.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Frage der Freiheit und Selbstbestimmung im 18. Jahrhundert. Es wird untersucht, inwieweit die Lebensentwürfe der weiblichen Protagonistinnen von ihren gesellschaftlichen Vorgaben geprägt sind und welche Handlungsspielräume ihnen offen stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Frauendarstellung, Aufklärung, Libertinage, epistellare Romane, Vertu, Vice, Freiheit, Selbstbestimmung, Erziehung, Gesellschaft, Geschlechterrollen und die Werke von Jean-Jacques Rousseau und Pierre Choderlos de Laclos.
- Quote paper
- Laetitia Harcour (Author), 2008, Entre vice et vertu: la femme du XVIIIe siècle dans le roman épistolaire, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/141208