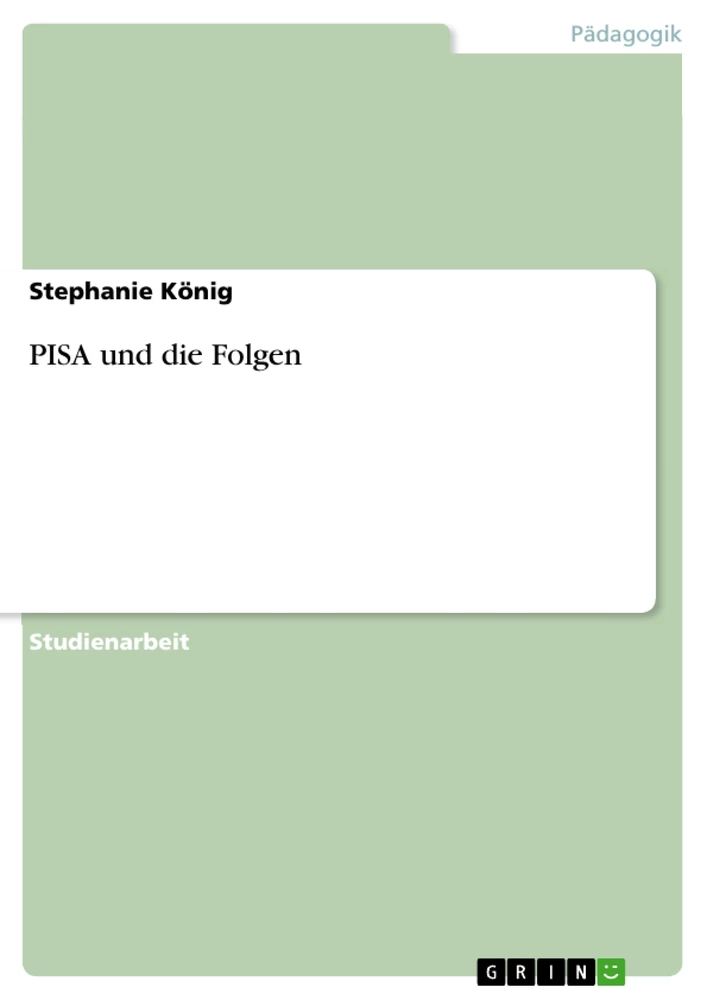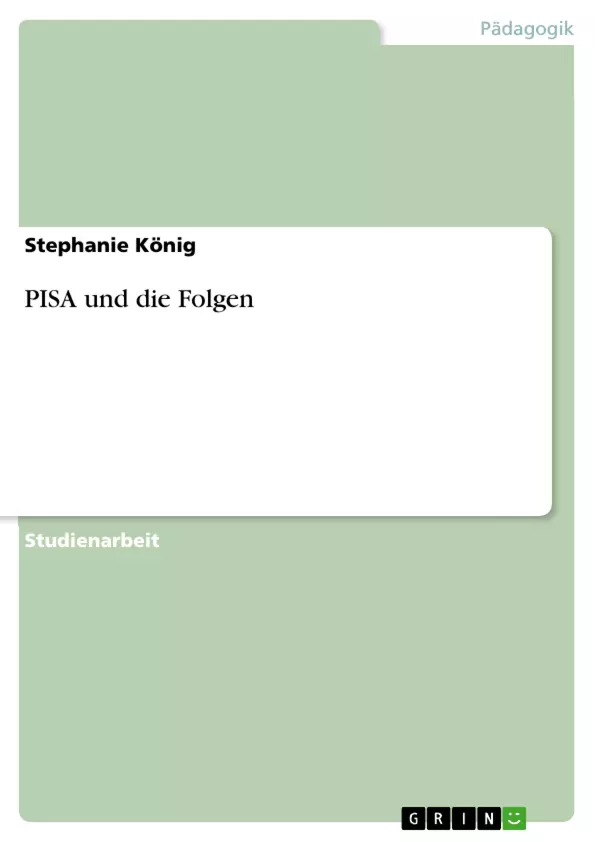"Gesamtleistung schlecht, Versetzung ausgeschlossen." Das waren die Worte unseres Kanzlers in einem Bericht des Magazins Focus (27/2002) über die im Dezember 2001 erschienen Ergebnisse der PISA- Studie. Mit dieser Hausarbeit möchte ich keine weitere Auswertung der Studie vorlegen. Es soll sich hierbei in erster Linie um die daraus resultierenden Konsequenzen handeln. Aber was muss nun geschehen, oder besser was sollte geschehen? Sind unsere Kinder dümmer als in andern Ländern? Oder liegen die Ursachen am vorherrschendem Schulsystem? Sollte es zu Schulreformen kommen? Wie sollten diese Aussehen? In einschlägigen Literaturen kann man sich ein gutes Bild über die heutige Schulen und deren verschiedenen Formen machen. Aber sieht es dort wirklich so aus? Sind Lehrer heute immer noch Pädagogen die im Interesse der Gesellschaft junge Leute heranziehen? Warum konnte es dann zu diesem schlechten Ergebnis kommen?
PISA ist nicht die erste Studie, die unseren Bildungsstand untersucht hat. Einige Zeit vorher gab es unter anderem die TIMMS-Studie. In ihr stellte sich heraus, das unsere mathematischen Kenntnisse nur im Mittelfeld liegen. Damals ging auch ein Schrei durch die Behörden. Ein Land wie Deutschland kann nicht nur im Mittelfeld liegen. Desto erschütternder waren dann die Ergebnisse der PISA-Untersuchungen. Denn solch ein Ergebnis schlägt sich auch auf die Wirtschaftlichkeit des Landes nieder. Ist hier der richtige Ansatz? Fast noch erschreckender als die PISA- Ergebnisse waren die PISA- E- Ergebnisse. Was sagen eigentlich die Betroffenen, die Lehrer und die Schüler? Ist es Zufall das Waldorf-Schulen bessere Ergebnisse erzielen? Das etwas passieren muss, ist glaube ich jedem klar. Aber was? Diese und ähnliche Fragen möchte ich mit dieser Hausarbeit versuchen zuklären und verschiedene Motivationen und Konzepte kompetenter Personen näher betrachten. Um einen besseres Verständnis für den ganzen Sachverhalt zu erzielen, möchte ich anfangs näher auf die PISA- Untersuchungen und auf deren Ergebnissen eingehen. Denn darauf basieren die ganzen nachfolgenden Aussagen, Konzepte und Reformversuche.
Inhalt
1. Einleitung
2. PISA-Allgemein
2.1. Was ist PISA?
2.2. Wer nimmt Teil?
2.3. Begriffserklärungen der einzelnen Untersuchungen
2.4. Befunde
3. PISA-E
3.1. Was ist PISA-E?
3.2. Was und wie wurde untersucht?
3.3. Befunde
4. Geschlechterunterschiede
5. Umweltbedingungen
5.1. Soziale Herkunft
5.2. Lebens- und Lernbedingungen
6. deutsche Schulen
6.1. laut Lehrplan
6.2. in Wirklichkeit
7. andere Schulformen
7.1. Waldorfschulen
7.2. Internate
8. Konsequenzen
8.1. Was sagt PISA über unser Bildungssystem aus?
8.2. Schulreformen
8.2.1. Notwendig?
8.2.2. Verschiedene Versuche
8.2.3. Was wurde bereits geändert?
9. Zukunft des Bildungssystems
1. Einleitung
„Gesamtleistung schlecht, Versetzung ausgeschlossen.“ Das waren die Worte unseres Kanzlers in einem Bericht des Magazins Focus (27/2002) über die im Dezember 2001 erschienen Ergebnisse der PISA- Studie. Mit dieser Hausarbeit möchte ich keine weitere Auswertung der Studie vorlegen. Es soll sich hierbei in erster Linie um die daraus resultierenden Konsequenzen handeln. Aber was muss nun geschehen, oder besser was sollte geschehen? Sind unsere Kinder dümmer als in andern Ländern? Oder liegen die Ursachen am vorherrschendem Schulsystem? Sollte es zu Schulreformen kommen? Wie sollten diese Aussehen? In einschlägigen Literaturen kann man sich ein gutes Bild über die heutige Schulen und deren verschiedenen Formen machen. Aber sieht es dort wirklich so aus? Sind Lehrer heute immer noch Pädagogen die im Interesse der Gesellschaft junge Leute heranziehen? Warum konnte es dann zu diesem schlechten Ergebnis kommen?
PISA ist nicht die erste Studie, die unseren Bildungsstand untersucht hat. Einige Zeit vorher gab es unter anderem die TIMMS-Studie. In ihr stellte sich heraus, das unsere mathematischen Kenntnisse nur im Mittelfeld liegen. Damals ging auch ein Schrei durch die Behörden. Ein Land wie Deutschland kann nicht nur im Mittelfeld liegen. Desto erschütternder waren dann die Ergebnisse der PISA-Untersuchungen. Denn solch ein Ergebnis schlägt sich auch auf die Wirtschaftlichkeit des Landes nieder. Ist hier der richtige Ansatz? Fast noch erschreckender als die PISA- Ergebnisse waren die PISA- E- Ergebnisse. Was sagen eigentlich die Betroffenen, die Lehrer und die Schüler? Ist es Zufall das Waldorf-Schulen bessere Ergebnisse erzielen? Das etwas passieren muss, ist glaube ich jedem klar. Aber was? Diese und ähnliche Fragen möchte ich mit dieser Hausarbeit versuchen zuklären und verschiedene Motivationen und Konzepte kompetenter Personen näher betrachten. Um einen besseres Verständnis für den ganzen Sachverhalt zu erzielen, möchte ich anfangs näher auf die PISA- Untersuchungen und auf deren Ergebnissen eingehen. Denn darauf basieren die ganzen nachfolgenden Aussagen, Konzepte und Reformversuche.
2. PISA- Allgemein
2.1. Was ist PISA ?
„Wenn ignorante Jugendliche in der Bahn ihre dreckigen Schuhe auf den Sitz legen, dann heißt es: PISA hat es ja gesagt! Wenn dagegen der Kandidat bei ´Wer wird Millionär´ mehr errät, als Günther Jauch verantworten kann, dann hört man: Wir sind vielleicht doch nicht so dumm, wie PISA behauptet!“
(www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2002/1206/feuilleton/0075/index.html, Stand: 02.03.2003)
Über PISA wird viel geredet, aber kaum einer kennt die Bedeutung des Wortes. PISA steht für „Programme for International Student Assessment“. Die von der OECD ( Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) in Auftrag gegebene, standardisierte Leistungsmessung, ist die bisher weltweit größte Schulleistungsuntersuchung. Es wurde nicht nur das Wissen der Schüler, sondern auch deren Fähigkeit dieses in Alltagssituationen anzuwenden, untersucht. Auch der soziale Hintergrund und die familiären Beziehungen wurden miteinbezogen. Der Test soll den teilnehmenden Staaten Stärken und Schwächen des jeweiligen Bildungssystems aufzeigen. Insgesamt sind drei Zyklen der Leistungserhebungen vorgesehen. Den Anfang bildete die Durchführung aus dem Jahre 2000, mit dem Schwerpunkt der Lesekompetenz. Im Jahr 2003 wird die mathematische Grundausbildung und im Jahr 2006 die naturwissenschaftlichen Grundausbildung die Kernkompetenzen bilden. In Deutschland ist das Max-Plank-Institut in Berlin für die Durchführung verantwortlich. Die zu bearbeitenden Tests wurden von einer großen Anzahl kompetenter Experten zusammengestellt und entwickelt. Es ist eine Mischung aus Multiple Choice- Aufgaben und selbst zu beantwortenden Fragen. Außerdem erhalten sie einen Bogen auf dem die sozialen Hintergründe erfragt werden. Es hat sich gezeigt, das jenes soziale Umfeld einen entscheidenden Einfluss auf die Fähigkeit der Schüler hat.
2.2. Wer nimmt teil?
An PISA nehmen ca. 180.000 Schüler aus insgesamt 32 Staaten teil. Unter ihnen sind 28 OECD-Mitgliedstaaten. Das Alter wurde auf 15 Jahre festgelegt. In den meisten teilnehmenden Ländern besteht zu diesem Zeitpunkt noch die Schulpflicht. Die Schüler haben aber schon den größten Teil ihrer schulischen Ausbildung absolviert und können damit einen guten Rückblick bieten. Je nach Land sind dies etwa 4.500 bis 10.000 Schüler. Aus Deutschland nahmen etwa 5.000 Schüler aus 219 Schulen teil.
2.3. Begriffserklärungen der einzelnen Untersuchungen
PISA untersucht das Wissen in drei Bereiche. Der erste Bereich bezieht sich auf die Lesekompetenz (Reading Literacy), der zweite auf die mathematische Grundausbildung (Mathematical Literacy) und der dritte Bereich befasst sich mit der naturwissenschaftliche Grundausbildung (Scientific Literacy). Es geht in erster Linie nicht nur um den Wissensstand, sondern auch um deren Anwendung. Denn nur durch die praktische Anwendung zeigt Wissen seine Brauchbarkeit. Zusätzlich zu den Aufgaben, wurden die Schüler angewiesen einen weiteren Bogen auszufüllen. Auf diesem Formular wurden Hintergrundfragen zu ihrer eigenen Person, über ihren Schulleiter sowie der besuchten Schule gestellt. Die Untersuchung aus dem Jahre 2000 hatte den Schwerpunkt auf die Lesekompetenz gelegt. 2003 werden die mathematischen Grundkenntnisse und 2006 die naturwissenschaftlichen Grundkenntnisse die Schwerpunkte bilden. Die Test sind so ausgerichtet, das sie sich etwa zu zwei Dritteln mit dem jeweiligen Schwerpunkt beschäftigen und der restliche Teil sollte dann einen groben Überblick über die zwei verbleibenden Teile aufweisen. In diesen Untersuchungen werden Fragen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestellt. Diese sind Kompetenzstufen von eins ( sehr leicht) bis fünf (schwierig) eingeteilt.
2.4. Befunde
Allgemein sollen die Untersuchungen das Wissen und die Fähigkeit der Wissensanwendungen der Schüler, die sich am Ende ihrer Schulpflicht befinden, widerspiegeln. Die deutschen Befunde hatten Schlagzeile wie ´Katastrophe´, ´Bildungsmisere´ oder ´Deutschland muss nachsitzen´ hervorgerufen. Als Grundlage für diese Artikel dienten Ergebnisse die besagen, das der deutsche Schüler sich nur um unteren Drittel bewege. 20% können Texte nicht oder nur mühsam inhaltlich verstehen. Dazu kommt das sich in der Spitzengruppe nur 9% der Befragten befinden, in anderen Länder wie Finnland oder Kanada sind dies 15%. Ein weiterer Fakt ist, das es in Deutschland den größten Streuungsfaktor gibt, wir damit den größten Abstand zwischen guten und weniger guten Schülern aufweisen. Die mit unter geringsten Ergebnisse erzielten Schüler die einen Migrationshintergrund nachwiesen.. Das zeigt, das Deutschland es nicht schafft Schüler mit ausländischen Wurzeln in das hiesige System einzugliedern. Aber ist gibt auch ein Ergebnis bei dem Deutschland an der Spitze steht. Dies betrifft das Durchschnittsalter der Lehrer. Über die Hälfte der Lehrer hat die 50 oder mehr erreicht. Wir haben damit die ältesten Lehrer unter allen 32 teilnehmenden Ländern.
[...]
- Quote paper
- Stephanie König (Author), 2003, PISA und die Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/14111