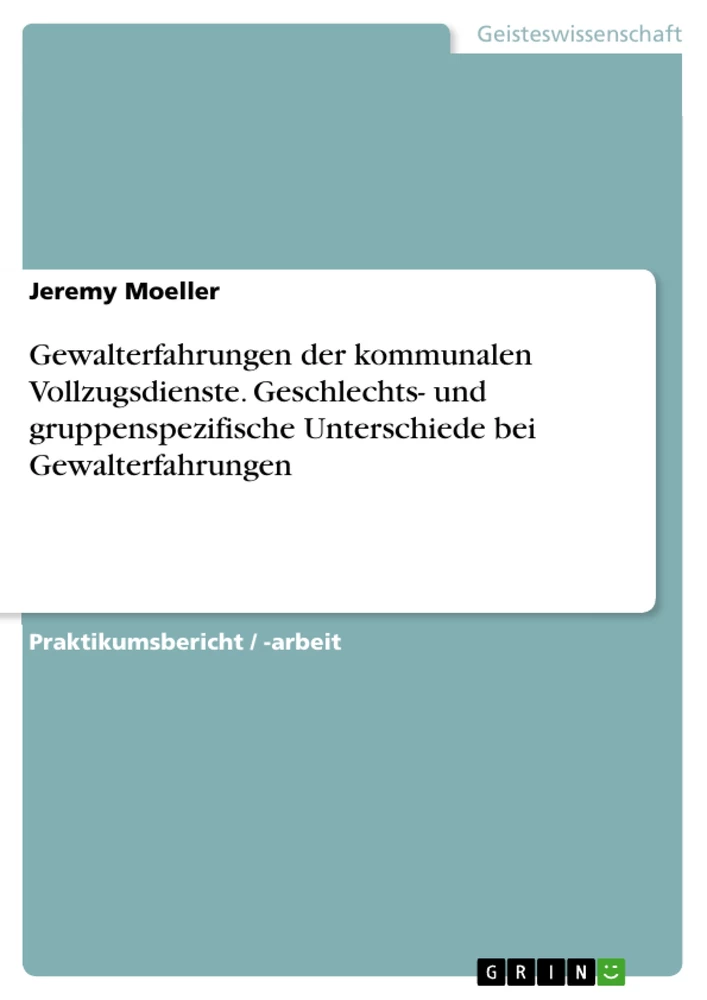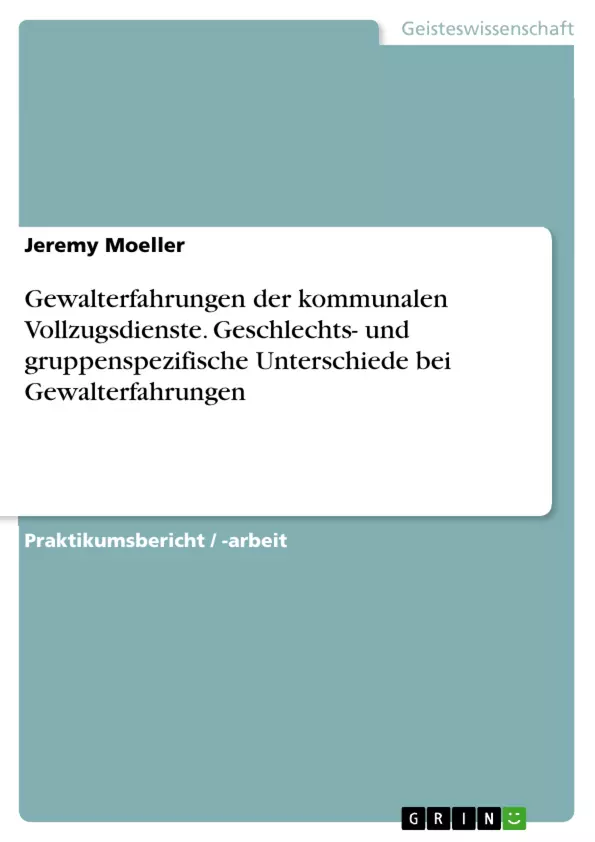Die vorliegende Studie thematisiert die Gewalterfahrungen kommunaler Vollzugsbeamter in Rheinland-Pfalz. Dabei steht die unterschiedliche Gewalterfahrung von Geschlechtern und die Offenheit für Gewalt in Gruppen im Vordergrund. Mithilfe eines angepassten Fragebogens von einer Vorgängerstudie zum Thema Gewalt gegen Rettungskräfte wurden kommunale Vollzugsbeamte befragt. Die erste Hypothese überprüfte die Vermutung, dass sich die Gewalterfahrungen der Versuchspersonen geschlechtsspezifisch signifikant unterscheiden. Zur Überprüfung von geschlechtsspezifischen Unterschieden hinsichtlich dem Ausmaß der erlebten Gewalt im Dienst wurde ein t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt, der zu einem signifikanten Ergebnis führte. Eine weitere Hypothese überprüfte, inwieweit Unterschiede hinsichtlich der Gewalterfahrung der kommunalen Vollzugsbeamten mit Einzelpersonen oder Gruppen bestehen.
Im öffentlichen Diskurs steht seit langem die Anwendung und Form von Gewalt von Vollzugsbeamten zum Schutze des Staates. Seit neustem wird jedoch die Gewalt gegen Polizisten und Polizistinnen diskutiert. Laut einer Veröffentlichung des Bundeskriminalamtes wurden 2019 fast 3000 Fälle mehr von tätlichen Angriffen bzw. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte als im Jahr 2018 erfasst. Dies entspricht einem Zuwachs von 8,6%. Auch die öffentliche Presse beschäftigt sich mit der Gewalt gegen Polizeibeamte, wie die Überschrift eines Artikels in der FAZ im Mai 2020 zeigt: "Die Polizei darf nicht zum Freiwild werden".
Gewaltanwendungen verletzen das Recht auf körperliche Unversehrtheit, sowie das Recht auf Freiheit. Kommunale Vollzugsbeamte erfahren in ihrem Einsatz wiederholt Gewalt, da sich die Betroffenen oftmals wehren und dies auch zu Verletzungen seitens der Beamten führt. Zur Frage von Geschlechtsunterschieden hinsichtlich der Erfahrung von Gewalt im Dienst fanden Ellrich, Baier und Pfeiffer in einer Studie heraus, dass beispielsweise Polizistinnen weniger Gewalt bei Einsätzen mit häuslicher Gewalt erfahren als ihre männlichen Kollegen. Die Gewalterfahrungen des kommunalen Vollzugsdienstes sind im Gegensatz zur Polizei noch wenig beleuchtet und sollen Gegenstand dieses empirischen Praktikums sein
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Theoretischer Hintergrund
- 1.1.1 Begriffsdefinition
- 1.1.2 Theoretischer Überblick
- 1.1.2.1 Gewalt gegen Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz
- 1.1.2.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf Gewalterfahrungen
- 1.1.2.3 Erklärungsansätze zu Gruppen und Gewalt
- 1.1.2.3.1 Rational-Choice-Theorie
- 1.1.2.3.2 Reaktanztheorie
- 1.2 Design und Hypothesen
- 2. Methode
- 2.1 Stichprobenbeschreibung
- 2.2 Material
- 2.3 Ablauf
- 3. Ergebnis
- 4. Diskussion
- 4.1 Interpretation der Ergebnisse
- 4.2 Kritische Reflexion der Methode
- 4.2.1 Objektivität
- 4.2.2 Reliabilität
- 4.2.3 Validität
- 4.3 Anregung für weitere Studien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede in Gewalterfahrungen von MitarbeiterInnen im kommunalen Vollzugsdienst in Rheinland-Pfalz. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob die Art der Gewalterfahrung (Einzelperson vs. Gruppe) unterschiedlich ist.
- Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Gewalterfahrungen im kommunalen Vollzugsdienst
- Gewalterfahrungen im Kontext von Gruppenkonflikten
- Vergleich der Gewalterfahrungen im kommunalen Vollzugsdienst mit denen der Polizei
- Methodische Reflexion der Datenerhebung und -analyse
- Anregungen für zukünftige Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Gewalterfahrungen im kommunalen Vollzugsdienst ein und beleuchtet den aktuellen Forschungsstand. Sie thematisiert den Anstieg von Gewalt gegen Polizeibeamte und betont die Forschungslücke bezüglich des kommunalen Vollzugsdienstes. Es werden Begriffsdefinitionen (Gewalt, kommunaler Vollzugsdienst) geliefert und theoretische Grundlagen, wie die Rational-Choice-Theorie und die Reaktanztheorie, eingeführt, um die Gewalterfahrungen zu erklären. Die Studie will untersuchen, ob geschlechtsspezifische Unterschiede bei Gewalterfahrungen existieren und ob Gruppenkonfrontationen einen Einfluss haben. Die Hypothesen werden formuliert und die Methodik der Studie wird kurz angerissen.
2. Methode: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie. Es wird die Stichprobenbeschreibung erläutert, das verwendete Material (Fragebogen) vorgestellt und der Ablauf der Datenerhebung dargestellt. Es wird auf die Adaption eines bestehenden Fragebogens zur Gewalt gegen Rettungskräfte eingegangen und die methodischen Schritte zur Datenerfassung und -auswertung transparent dargestellt. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der verwendeten Instrumente und Methoden werden hier grundlegend dargelegt.
3. Ergebnis: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten statistischen Analysen. Es werden die Ergebnisse zum Geschlecht und der Gewalterfahrung sowie zu den Gewalterfahrungen in Einzel- versus Gruppenkonflikten berichtet. Die Darstellung der Ergebnisse folgt den methodischen Vorgaben, und die gewonnenen Daten werden in Bezug auf die Hypothesen interpretiert. Statistische Kennzahlen werden aufgeführt und ihre Bedeutung im Kontext der Studie erläutert.
4. Diskussion: Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse im Lichte des theoretischen Hintergrunds. Sie beleuchtet die Bedeutung der Ergebnisse und diskutiert deren Limitationen. Kritische Reflexion der verwendeten Methode hinsichtlich Objektivität, Reliabilität und Validität wird gegeben. Es werden Vorschläge für weitere Studien formuliert um die gewonnenen Erkenntnisse zu erweitern und zu vertiefen.
Schlüsselwörter
Gewalterfahrungen, kommunaler Vollzugsdienst, Geschlechtsspezifische Unterschiede, Gruppenkonflikte, Polizei, Rational-Choice-Theorie, Reaktanztheorie, Empirische Studie, Rheinland-Pfalz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Geschlechtsspezifische Unterschiede in Gewalterfahrungen von Mitarbeiter*innen im kommunalen Vollzugsdienst in Rheinland-Pfalz
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede in Gewalterfahrungen von Mitarbeiter*innen im kommunalen Vollzugsdienst in Rheinland-Pfalz. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob die Art der Gewalterfahrung (Einzelperson vs. Gruppe) unterschiedlich ist und wie diese Erfahrungen im Vergleich zu denen der Polizei aussehen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Studie stützt sich auf die Rational-Choice-Theorie und die Reaktanztheorie, um Gewalterfahrungen zu erklären. Diese Theorien liefern einen Rahmen für das Verständnis der Motive und Entscheidungsfindungsprozesse im Kontext von Gewalt.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine quantitative Methode. Es wurde ein Fragebogen (adaptiert von einem bestehenden Fragebogen zur Gewalt gegen Rettungskräfte) eingesetzt. Das Kapitel "Methode" beschreibt detailliert die Stichprobenbeschreibung, das verwendete Material und den Ablauf der Datenerhebung und -auswertung.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Das Kapitel "Ergebnis" präsentiert die Ergebnisse der statistischen Analysen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Gewalterfahrungen und zu den Unterschieden zwischen Gewalterfahrungen in Einzel- und Gruppenkonflikten. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die aufgestellten Hypothesen interpretiert.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert?
Die "Diskussion" interpretiert die Ergebnisse im Lichte des theoretischen Hintergrunds und beleuchtet deren Bedeutung und Limitationen. Eine kritische Reflexion der Methode hinsichtlich Objektivität, Reliabilität und Validität wird durchgeführt. Es werden Vorschläge für weitere Studien formuliert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Gewalterfahrungen, kommunaler Vollzugsdienst, geschlechtsspezifische Unterschiede, Gruppenkonflikte, Polizei, Rational-Choice-Theorie, Reaktanztheorie, Empirische Studie, Rheinland-Pfalz.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung (mit theoretischem Hintergrund, Design und Hypothesen), Methode, Ergebnis und Diskussion (mit kritischer Reflexion und Anregungen für weitere Studien). Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die HTML-Datei enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Abschnitts kurz beschreibt.
Für wen ist diese Studie relevant?
Diese Studie ist relevant für Wissenschaftler*innen, die sich mit Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst, geschlechtsspezifischen Unterschieden in Gewalterfahrungen und der Anwendung der Rational-Choice-Theorie und Reaktanztheorie befassen. Sie ist auch relevant für Praktiker*innen im kommunalen Vollzugsdienst und für die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen.
Wo finde ich den vollständigen Text der Studie?
(Hier sollte ein Link zum vollständigen Text eingefügt werden, falls verfügbar)
- Quote paper
- Jeremy Moeller (Author), 2021, Gewalterfahrungen der kommunalen Vollzugsdienste. Geschlechts- und gruppenspezifische Unterschiede bei Gewalterfahrungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1402598