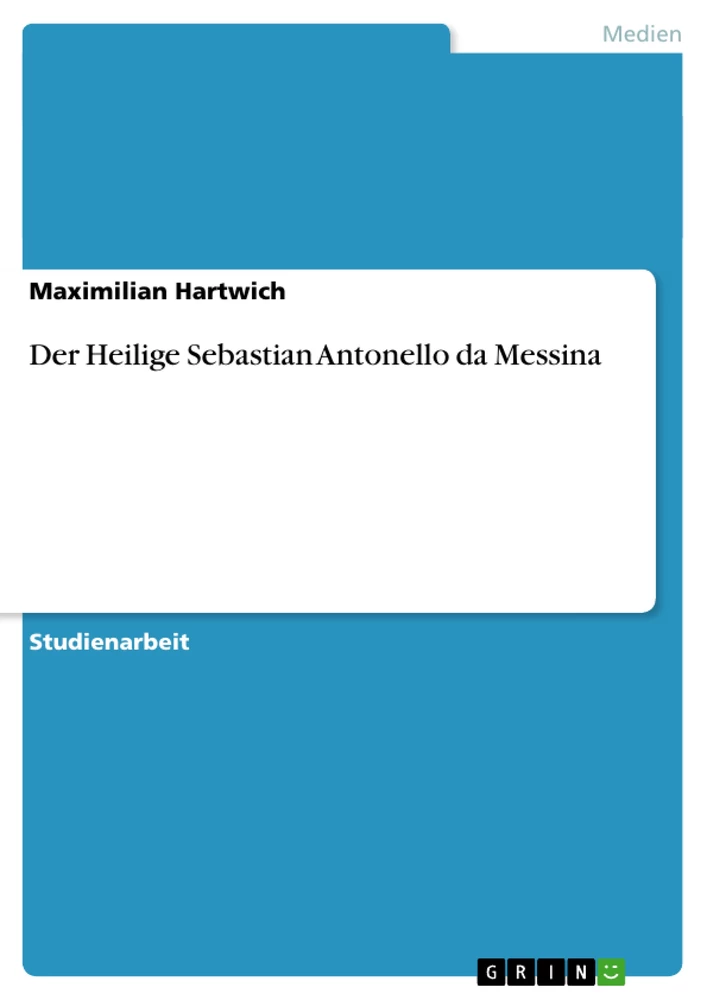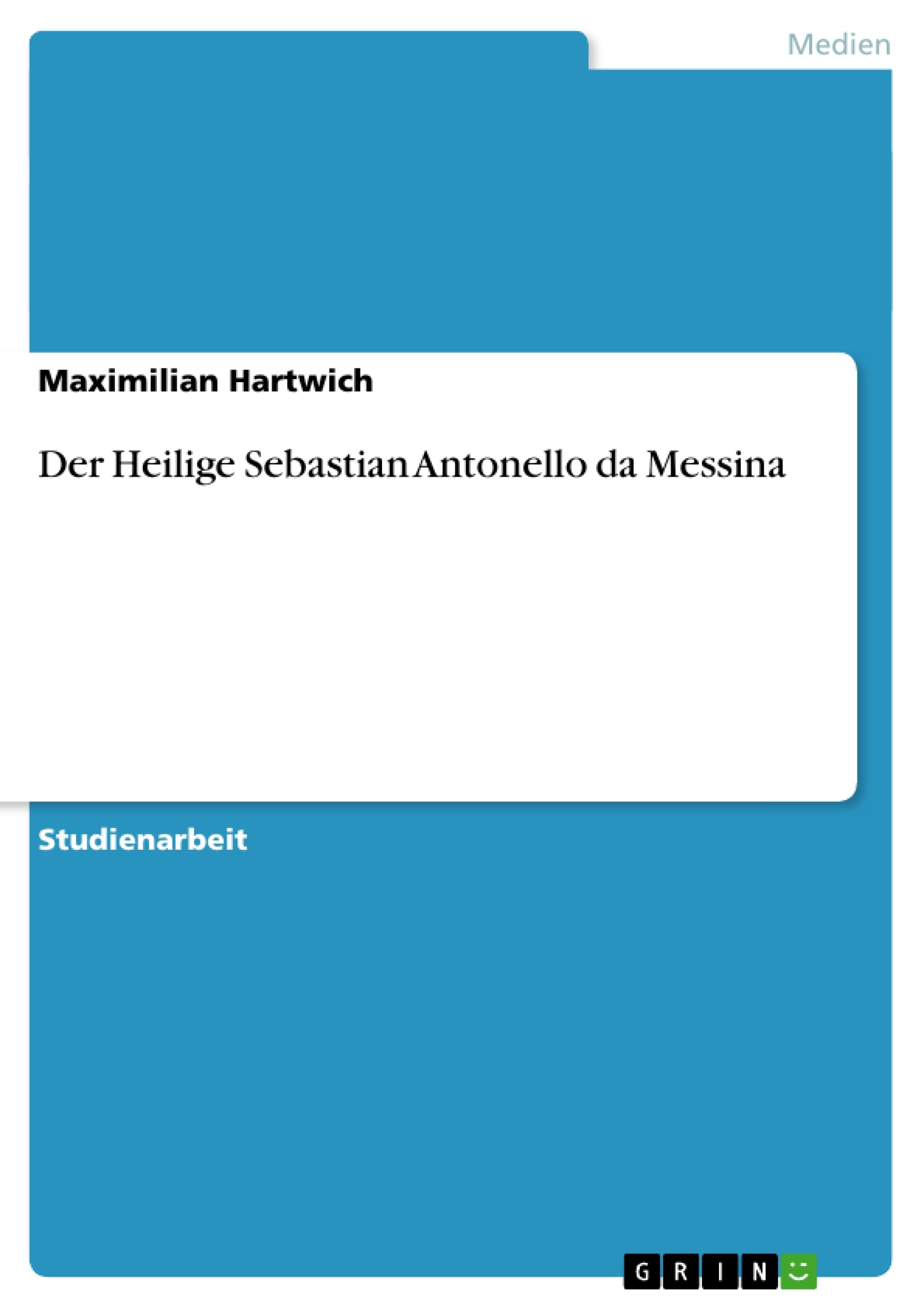schafft Antonello da Messina sowohl belebte Landschaften und Innenräume, als
auch strenge männliche Bildnisse“1
Antonello da Messina wurde 1430 in Messina auf Sizilien geboren und starb am
selben Ort 1479, er genoss eine malerische Ausbildung in Neapel. Zu Beginn der
1450er Jahre lernte er bei Pietro Summonte, dessen Malauffassung flämische
Einflüsse hatte, daher muß der nordalpine Einfluss im Ouevre Antonellos nicht
unbedingt auf Reisen beruhen.
Er war einer der wichtigsten Künstler der Frührenaissance, in der zweiten Hälfte
des Quattrocento war er vor allem auf Sizilien tätig, jedoch sind einige Reisen
z.B. nach Venedig, Norditalien und Neapel dokumentarisch belegt. Im Winter
1474/75 kam Antonello nach Venedig und blieb dort mindestens bis zum Herbst
1476. Er soll eine besondere Beziehung zu dem Patrizier Pietro Buon gehabt
haben, dieser war ein Auftraggeber einiger Bilder. Wahrscheinlich hat der wachsende
Ruhm des Künstlers als Bildnis- und Perspektivmaler seinen Venedig-
Aufenthalt zusätzlich begünstigt. Antonello besaß die besondere Fähigkeit auf
seinen Reisen alle künstlerischen Neuerungen aufzunehmen und sie zugleich
in eigenständige Lösungen umzusetzen, die für die örtlichen Malerschulen wie
innovative Schübe wirkten.
In den ersten Monaten seines Besuches in der Lagunenstadt könnte die »Engelspieta
« entstanden sein. Antonellos Schaffen war für eine Reihe von Künstlern
der letzten Generation im Quattrocento richtungsweisend, vor allem für Alvise
Vivarini, der den Stil des Messinesen auf eine individuelle Art umsetzte. [...]
„Aus einer Balance von flämischer Analyse und italienischer Monumentalität schafft Antonello da Messina sowohl belebte Landschaften und Innenräume, als auch strenge männliche Bildnisse“1
Antonello da Messina wurde 1430 in Messina auf Sizilien geboren und starb am selben Ort 1479, er genoss eine malerische Ausbildung in Neapel. Zu Beginn der 1450er Jahre lernte er bei Pietro Summonte, dessen Malauffassung flämische Einflüsse hatte, daher muß der nordalpine Einfluss im Ouevre Antonellos nicht unbedingt auf Reisen beruhen.
Er war einer der wichtigsten Künstler der Frührenaissance, in der zweiten Hälfte des Quattrocento war er vor allem auf Sizilien tätig, jedoch sind einige Reisen z.B. nach Venedig, Norditalien und Neapel dokumentarisch belegt. Im Winter 1474/75 kam Antonello nach Venedig und blieb dort mindestens bis zum Herbst 1476. Er soll eine besondere Beziehung zu dem Patrizier Pietro Buon gehabt haben, dieser war ein Auftraggeber einiger Bilder. Wahrscheinlich hat der wachsende Ruhm des Künstlers als Bildnis- und Perspektivmaler seinen VenedigAufenthalt zusätzlich begünstigt. Antonello besaß die besondere Fähigkeit auf seinen Reisen alle künstlerischen Neuerungen aufzunehmen und sie zugleich in eigenständige Lösungen umzusetzen, die für die örtlichen Malerschulen wie innovative Schübe wirkten.
In den ersten Monaten seines Besuches in der Lagunenstadt könnte die »Engelspieta« entstanden sein. Antonellos Schaffen war für eine Reihe von Künstlern der letzten Generation im Quattrocento richtungsweisend, vor allem für Alvise Vivarini, der den Stil des Messinesen auf eine individuelle Art umsetzte.
Berühmt geworden ist Antonello durch zahlreiche Porträts, seine präzise Malauffassung, die detailorientierte Malweise, die Verknüpfung der souveränen Nachahmung mit dem Gespür für Lichtsuggestion zeichnen ihn aus. Es existiert die legendäre Behauptung er habe die Ölmalerei eingeführt. Nach Vasari: hat Antonello ein in Öl gemaltes Bild von Rogier van der Weyden gesehen und war sofort fasziniert. Aufgrund dieser Faszination soll er ein Studium bei Jan van Eyck in Brügge aufgenommen und darauf die Maltechnik in Italien verbreitet haben, jedoch gibt es keine eindeutigen Beweise für diese Behauptung.
Im folgenden wird das zentrale Spätwerk Antonellos »Der Heilige Sebastian« Gegenstand der Arbeit sein, wobei das Augenmerk besonders auf der Frage liegen soll, ob das Sebastiansbildnis eher eine Verbildlichung der »Legenda aurea« oder der »Imitatio Christi« sein könnte. Bei diesem Werk beweist er sein besonderes Gefühl für Farbe und Licht und bereitete damit den Weg für Giovanni Bellini.
Stefano Zuffi, Jahrhunderte der Kunst, das 15. Jahrhundert, Mailand 2004, S. 222
Das Meisterwerk DER HEILIGE SEBASTIAN von Antonello da Messina hat die Maße 117 X 85,5 cm, ein relativ enges und untypisches Maß für diese Zeit. Über die genaue Entstehungszeit ist man sich nicht sicher. Einige Quellen sprechen von 1475/76, also während seines Aufenthaltes in Venedig, andere Quellen zeugen von einem Entstehungszeitpunkt im Sommer 1478, also nach der Venedigreise.
Dem Betrachter erscheint das späte Meisterwerk Antonellos heute in Öl auf Leinwand, jedoch konnte man nach der Restauration feststellen, dass das Werk um 1870, wahrscheinlich in Wien, von zwei Holztafeln auf eine Leinwand übertragen wurde. Im Zuge der Restauration (Günter Ohlhoff) wurden auch Tempera-Reste am Bildrand gefunden, wobei man aber davon ausgeht, das Messina Öl als Bindemittel benutzt haben mag, ansonsten wäre wahrscheinlich eine so diffizile und lebensechte Darstellung des Inkarnats gar nicht möglich gewesen. Das Bild ist seit 1873 im Besitz der Sächsischen Kunstsammlung Dresden und hängt heute in der Gemäldegalerie Alte Meister.
Antonello stellt bei dem Werk den Märtyrer Sebastian dar. Das Bild wurde von ihm für den Altar der Bruderschaft San Rocco in der Kirche San Giuliano in Venedig gefertigt, es ist eines der wenigen Werke Antonellos mit einer Figur großen Ausmaßes.
Es wird eindeutig das Martyrium des Heiligen Sebastian gezeigt. Richtet man das Augenmerk nicht primär auf den Protagonisten, so kommt man schnell zu der Annahme, es spiele sich hier eine banale, alltägliche Szene ab, jedoch hat sie eine gewisse lyrische Grundstimmung inne.
Er steht halbnackt an einen Baum gefesselt und von Pfeilen durchbohrt auf einer Piazza, die mit roten und marmorfarbenen Platten ausgelegt ist. Erträgt eine eng anliegende Unterhose, am Bund zugeschnürt und eine wohl möglich zeitgenössische Pagenkopf-Frisur. Der Märtyrer wurde von fünf Pfeilen getroffen, Blut tropft langsam aus den Wunden und perlt den Körper herab. Jedoch zeigt er keinerlei Anzeichen von Schmerzen in Mimik und Gestik. Im Gegenteil, er steht aufrecht und scheint gelassen jedoch andächtig Richtung Himmel zu schauen. Er wird als verklärter Märtyrer mit einem so lebendig wirkenden Inkarnat dargestellt. Auch durch die lockere Fußstellung wird seine Gelassenheit widergespiegelt. Es wird deutlich zwischen Stand- und Spielbein unterschieden, die Stellung scheint dennoch etwas unnatürlich. Jedoch hält sich Antonello hierbei an das Malereitraktat Albertis: „Der Abstand zwischen den beiden Füßen beträgt fast nie mehr als einen Fuß“[1]. Ziel dieser Theorie ist die Angemessenheit in der Darstellung von Körper und Bewegung, ohne Zweifel ist das von Antonello in der SebastiansDarstellung erreicht worden. Der gesamte Körper ist in einem leichten Schwung dargestellt, ähnlich einem gespiegelten C. Durch diese leichte Eindrehung des Körpers nach links können die Lichteffekte besonders hervorgehoben werden. Der Platz wird umringt von italienischer Renaissance-Architektur. Im Hintergrund zeichnen sich Wasserwege ab, leicht kommt man zu dem Schluss, diese Szene spiele sich in Venedig ab. Evident dafür sind auch die so typisch venezianischen Schornsteine und die Annahme, dass Antonello während seines Aufenthaltes in Venedig oder kurz danach das Werk angefertigt haben soll. Die Architektur der Stadt oder der Piazza ist streng perspektivisch dargestellt und somit ein treffendes Beispiel für „Das humanistische Thema der »idealen Stadt«“2.
Am linken Bildrand sieht man einen Soldaten schlafend, zu seiner Linken ein Speer, er ist völlig teilnahmslos am Geschehen auf der Piazza, Antonello verwendet hier „Eine Musterfigur aus dem Repertoire der Kunstgeschichte“3.
Hinter ihm, ebenso in der linken Bildhälfte, ist eine Frau, im Arme ihr Kind tragend, dargestellt. Sie scheint den Heiligen Sebastian anzuschauen und wohl möglich um ihn zu trauern. Ihr gegenüber gestellt, also am rechten Bildrand, sieht man zwei Soldaten, edel in ihrer Erscheinung, wobei der eine auf Sebastian deutet. Hinter ihnen sieht man zwei Edelmänner, in orientalische hellblaue und güldene, vielleicht byzantinische Kleider gehüllt, man vermag zu glauben, sie unterhalten sich über die Hinrichtung Sebastians. Im Hintergrund sieht man noch weitere Personen, sie scheinen spazieren zu gehen. Über der Piazza, auf einem mit Teppichen geschmückten Balkon sieht man drei Frauen und einen Knaben, die etwas betrübt auf das Schauspiel auf dem Platz schauen. Auffällig ist das strahlende Kolorit der über der Brüstung hängenden Teppiche. Aus einem Fenster, mit einem weißen Tuch verhangen, schaut eine Person auf den Platz hinab. Das Licht der Sonne dringt von links oben in den Schauplatz ein, eindeutig zu erkennen an der Richtung der Schattenbildung. Nach oben wird das Bild begrenzt durch das satte Blau des Himmels. Steht man vor dem Werk und fokussiert den Protagonisten, denkt man sofort an eine Monumentalplastik, obwohl man sich bewusst ist, dass es sich hierbei um Malerei handelt.
Man schaut als Betrachter aus einer starken Untersicht oder Froschperspektive auf das Bild, so erscheint der Heilige Sebastian mit einem übergroßen Antlitz und vermittelt somit einen andächtigen Charakter. Der Fluchtpunkt liegt etwa hinter dem Schienbein und der Wade seines linken Beines. Zur Linken des Heiligen, etwa auf Höhe seiner Füße, sieht man eine angeschnittene Säulentrommel. Zum einen dient sie der Demonstration Antonellos künstlerischen Geschicks mit dem Aspekt der Kenntnis über die Perspektive, da er sie leicht aus der Fluchtpunkt-Achse herausdreht. Zum anderen ist die Säule ja bekanntlich ein Relikt der antiken Kultur und wird somit als „Beliebtes Symbol für die Überwindung der heidnischen Antike durch das Christentum“4 verwendet. Im Gegensatz zu der Säulentrommel dienen der Körper und der Speer des schlafenden Soldaten (zur Rechten des Märtyrers) der perspektivischen Unterstützung, sie zeigen genau in die Richtung des Fluchtpunktes. Im Zuge der Restauration durch Günter Ohl- hoff wurden auch Röntgenaufnahmen durchgeführt, dabei wurde erkannt, dass Antonello da Messina Konstruktionslinien durch Ritzungen vorgegeben hat. Alle diese Konstruktionslinien der Architektur und der „Diagonal in die Tiefe fluchtenden Fliesenkanten“5 sind ein weiteres Indiz für die demonstrative Zurschaustellung seiner Kenntnis überdie extrem kunstvolle Gestaltung von Räumlichkeiten. Da der Fluchtpunkt von Antonello sehr tief angelegt wurde, kommt es folglich zu einer extrem verkürzten Architekturerscheinung, trotz dessen hat er die Architektur sehr detailreich ausgearbeitet und dadurch um ein Weiteres sein außergewöhnliches Können bewiesen. Es scheint, als habe er mit den Künstlern der Serenissima6 bewusst eine Paragone gesucht. Alle Errungenschaften seiner Epoche werden offensichtlich dargestellt: die Brillanz des Lichtes, das äußerst feine Modellieren des Inkarnats und der monumentale Charakter seiner HeiligenDarstellung.
Über die Martyriumsgeschichte des Heiligen Sebastian wird in der »Legenda au- rea« von dem Dominikanermönch Jacobus de Voragine berichtet. Der Legende nach war Sebastian ein ranghoher Offizier der Leibgarde des römischen Kaisers Diokletian (von 285 - 305). Sebastian war ein bekennender Christ geworden und fing an, Götzenbilder zu zerstören und zu missionieren. Daraufhin wurde er denunziert und von Diokletian zum Todes verurteilt. Der Legende nach wurde er auf einem Feld (»in medium campum«) festgebunden und von »numidischen Bogenschützen« hingerichtet. In dem Glauben, er sei tot, verließen sie das Feld. Doch Sebastian wurde nicht getötet, die Witwe des Märtyrers Castulus namens Irene nahm sich seiner an und pflegte ihn gesund. Als er wieder genesen war, trat er vor den Kaiser und beschuldigte ihn öffentlich der Christenverfolgung.
Darauf wurde er abermals von Diokletian zum Tode durch Peitschenhiebe verurteilt und in die »cloaca maxima«7 geworfen. Noch in der selben Nacht erschien Sebastian der Christin Lucia im Traum und wies ihr den Ort. Sie holte den Leichnam heraus und bestattete ihn an der Via Appia, den heutigen Katakomben des Heiligen Sebastian. Somit konnte sein Martyrium erst besiegelt werden. Im 4. Jahrhundert wurde über dem Grab eine Apostelkirche gebaut, seit dem 9. Jahrhundert heißt die Kirche »San Sebastiano fuori le mura« - der Heilige Sebastian vor den Mauern (Roms).
In dem Bild des Sebastian von Antonello wird seine Martyriumsgeschichte erzählt, aber woran erkennt der Betrachter, dass es sich hierbei um ein Martyrium handelt? Er wird nicht explizit als Heiliger dargestellt, es fehlt zum Beispiel ein Heiligenschein. Jedoch kann man nach längerer Betrachtung einen Zusammenhang herstellen. Eine Person, an einen Pfahl oder Baum gebunden, von Pfeilen getroffen, mit blutenden Wunden und den Blick Richtung Himmel gewendet, erinnert an die Leidensgeschichte Christi. Der andächtige Blick gen Himmel symbolisiert nicht nur die einfache Frömmigkeit, er suggeriert dem Betrachter weitaus mehr. Der sogenannte »Himmelnde Blick« steht für die Aufnahme in das Paradies - den Himmel. Das Sebastians-Martyrium wurde als „völlige Imitatio Christi“8 angesehen, sein Leiden mit der Passion Christi gleichgesetzt. Da das erste Martyrium nicht mit dem Tod endete und somit eigentlich gar nicht als richtiges Martyrium angesehen werden kann, könnte man es eher mit der Auferstehung Christi vergleichen. Verfolgt man weiter diesen Aspekt der Auferstehung, erklärt sich die tradierte Sebastians-Darstellung des Quattrocento, er wird oft schönlinig und als makelloser Jüngling gezeigt. Die Darstellung als Jüngling würde die These der Auferstehung unterstützen, jedoch die »Legenda aurea« negieren. Er war der Kommandant oder zumindest ein ranghoher Offzier der kaiserlichen Leibgarde, demnach müsste er etwas älter gewesen sein, um solch ein verantwortungsvolles Amt inne zu haben. Des weiteren kommt die Frage auf, warum der Heilige Sebastian im Quattrocento vermehrt als Akt dargestellt wurde. Der Legende nach ist kein Entkleiden des Märtyrers überliefert, eventuell kam es zu dieser konsequenten Formel nur aus dem banalen Grund zum Zweck der malerischen Demonstration des menschlichen Körpers, also nahe dem Ideal der antiken AktDarstellung. Man vermutet, Antonello habe die »Geißelung Christi« von Pietro della Francesca gesehen und die Körperdarstellung für den Heiligen Sebastian adaptiert.
Das wohl möglich bekannteste Attribut des Heiligen Sebastian ist die Darstellung in Zusammenhang mit Pfeilen. Aufgrund der biblischen Symbolik, in der Pfeile für plötzlich auftretende Krankheiten und Verderben stehen, wurde er zum Schutzheiligen vor der Pest. 1478 brach in Venedig ein besonders starke Pest aus, in
Reaktion auf dieses schreckliche Ereignis wurde die »Scuola di San Rocco« gegründet, daher machte es besonders Sinn für die Bruderschaft, das Bildnis eines Heiligen Sebastian in Auftrag zu geben, welcher dann von Antonello ausgeführt wurde.
Betrachtet man die Frau mit dem Kinde im Arm in der linken Bildhälfte, sich an einem Arkadenpfeiler befindend, sieht man die Trauer in ihrer Mimik. Den Quellen zufolge und aufgrund der Farbigkeiten, Blau und Rot oder das Weiß der Lilien, die auf dem Fenstervorsprung über ihr wachsen, kann man davon ausgehen, dass hier Maria mit dem Kinde dargestellt ist. Das Auftauchen der Maria-KindGruppe würde wiederum die These unterstützen, dass das Martyrium des Heiligen Sebastian hier eindeutig mit der Passion Christi gleichgesetzt wird (»imitatio christi«). Beruft man sich jedoch auf die »Legenda aurea«, könnte man meinen, die Frau mit dem Kinde im Hintergrund sei die Witwe Irene des Märtyrers Ca- stulus, welche den Sebastian gesund pflegte, nachdem er von den Pfeilen der »numidischen Bogenschützen« durchbohrt wurde, aber nicht starb.
Der Bildtypus dieses Sebastians-Bildnisses steht im völligen Gegensatz zum Werk Antonellos »Ecce Homo«, das den leidenden Christus zeigt. Zu diesem Aspekt gibt es eine Klassifizierung von Jacques Darriulat: hierbei verglich er zwei Sebastians-Darstellungen. Zum einen den Heiligen Sebastian von Andrea Mantegna (um 1460/heute in Wien), welchen er als »modele heroique« bezeichnet, zum anderen den Heiligen Sebastian von Antonello, der »modele sensua- liste« genannt wurde. Mantegna „visualisiert das Martyrium als Blutstaufe“9 und zeigt einen von Schmerzen gequälten Märtyrer, folglich ganz im Gegensatz zu Antonello, der die Betonung der göttlichen Errettung verbildlicht.
Fokussiert man die Soldaten des Bildes, in der linken Bildhälfte der schlafende Soldat mit seiner Lanze und in der rechten Bildhälfte die zwei ebenso bewaffneten Soldaten, könnte man sie als eine Sinneinheit sehen und sie somit als Personifikation der »numidischen Bogenschützen« betrachten. Sie wären somit ein Teil des Handlungsstranges der sebastianischen Martyriums-Legende. Auch könnte man meinen, der Schauplatz der von Antonello dargestellten Szene vermittle einen gewissen profanen Eindruck, da es sich hierbei um eine idealisierte Stadtlandschaft handelt, die einem Repräsentationsanspruch unterliegt.
Jedoch geht es hier um eine „Der innovativsten Bilderfindungen der venezianischen Malerei der 1470er Jahre“10
Man muss dabei auch den Aspekt betrachten, dass das Werk primär ein Andachtsbild ist. Somit wird der Pestheilige in einen besonderen Kontext mit der Stadt Venedig gesetzt, dazu kommt, dass den Leuten gesagt wurde, sie sollen sich bei den Gebeten die Passion Christi in den Orten ihrer Heimat vorstellen, um sich besser mit der Passion des Gottessohnes identifizieren zu können. Abschließend kann man sagen das dieses Spätwerk von Antonello da Messina für die Künstler des Quattrocento und weiterer Generationen richtungsweisend war. Auf die Frage ob Antonello die »Legenda aurea« oder »Imitatio Christi« verbildlichen wollte lässt sich keine genaue Antwort finden, jedoch kann man von einerVerknüpfung beider Aspekte ausgehen.
Quellenverzeichnis
Andreas Henning & Günter Ohlhof, Antonello da Messina - Der heilige Sebstian, Dresden 2005
art - Das Kunstmagazin, Nr. 2, Gisela Kleine, Hamburg 1993
Giovanni Scire Nepi, Augusto Gentili, Giandomenico Romanelli, Philip Rylands, Malerei in Venedig, München 2003
Günter Gurst, Siegfried Hoyer, Ernst Ullmann, Christa Zimmermann, Lexikon der Renaisance, Leipzig 1989
Karl M. Swoboda, Geschichte der bildenden Kunst in 8 Bänden, band 4, die Frührenaissance, Wien 1979
Stefano Zuffi, Jahrhunderte der Kunst, das 15. Jahrhundert, Mailand 2004, Mauro Lucco, Antonello da Messina - das Gesamtwerk, Mailand 2006
[...]
1 Alberti, 1435, Kap. 43, S. 277, Zum Konzept des Kontrapost, zitiert nach: Andreas Henning, Günter Ohlhoff, Antonello da Messina - Der heilige Sebastian,Dresden 2005, S. 14
2 Stefano Zuffi, Jahrhunderte der Kunst, das 15. Jahrhundert, Mailand 2004, S. 222
3 Mauro Lucco, Antonello da Messina - das Gesamtwerk, Mauro Lucco, Mailand 2006, S. 76
4 Mauro Lucco, Antonello da Messina - das Gesamtwerk, Mauro Lucco, Mailand 2006, S. 76
5 Mauro Lucco, Antonello da Messina - das Gesamtwerk, Mauro Lucco, Mailand 2006, S. 76
6 Venezianer
7 Großer Abwasserkanal in Rom der vom Palatin zum Tiber führte
8 Andreas Henning & Günter Ohlhof, Antonello da Messina - Der heilige Sebastian, Dresden 2005, S. 14
9 Mauro Lucco, Antonello da Messina - das Gesamtwerk, Mauro Lucco, Mailand 2006, S. 76
10 Andreas Henning & Günter Ohlhof, Antonello da Messina - Der heilige Sebastian, Dresden 2005, S. 14
- Quote paper
- Maximilian Hartwich (Author), 2009, Der Heilige Sebastian Antonello da Messina, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/140072