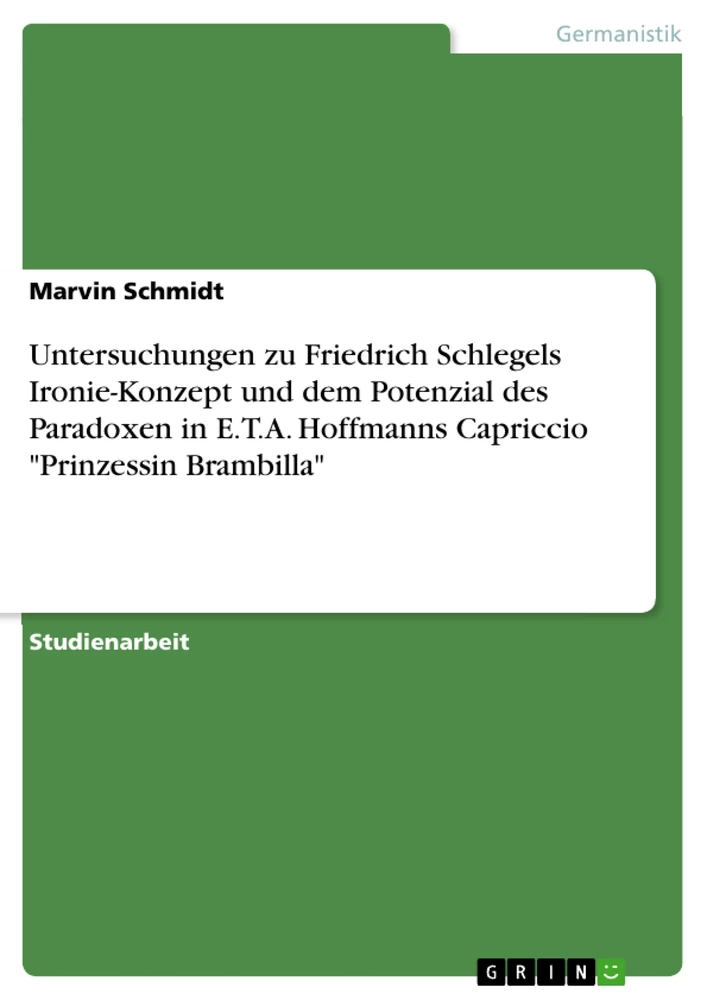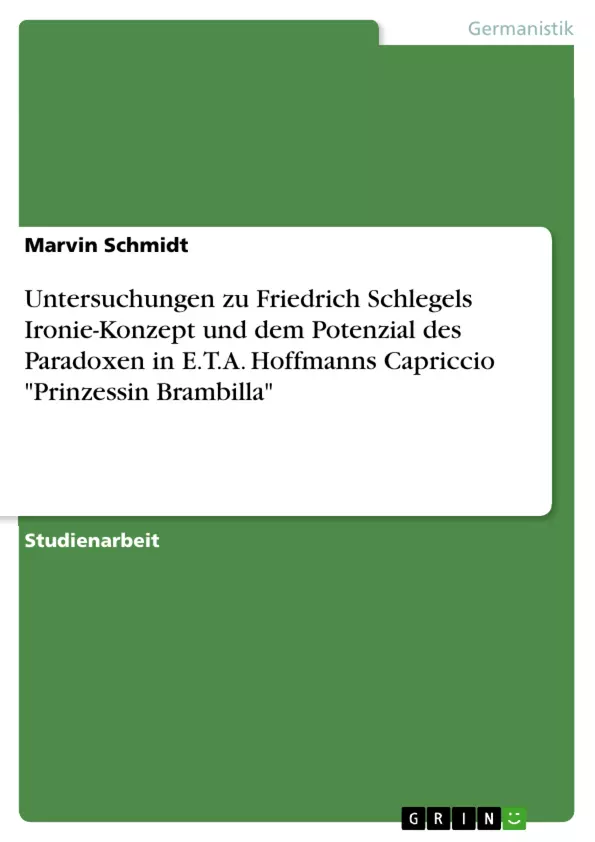E.T.A. Hoffmanns spätes Capriccio "Prinzessin Brambilla" zählt ob seiner undurchsichtigen Erzählung, Maskeraden, Traum- und Spiegelbildern sowie der Interferenz seiner Figuren zu den umstrittensten Werken des ohnehin schon kontroversen Künstlers. Die Zerrissenheit seiner Figuren und das komplexe Irrgeflecht von Perspektive und Identität in einer Kollision des Er- und Verkennens schüren eine rätselhafte und zuweilen inkohärent anmutende Dynamik, die es vom Rezipienten zu entwirren gilt.
Diese Arbeit erörtert dahingehend eine mögliche Herangehensweise und Lesart der Prinzessin Brambilla. Ausgehend von dem romantischen Ironiebegriff des Philosophen Friedrich Schlegels soll gezeigt werden, was der Komplex der Ironie programmatisch für die Epoche der Romantik insgesamt bedeutet und ob bzw. wie dieses Konzept als Schlüssel für die Exegese von Hoffmanns Prinzessin Brambilla anwenden lässt.
Diesbezüglich werden in dieser Arbeit nicht nur die Wesenheiten von Schlegels Theorie aufgeschlüsselt - von der Kollision des Ichs- und Nicht-Ichs bis zum Potenzial des Paradoxen - sondern auch essentielle Motive der Romantik wie der Doppelgänger analysiert, um zu einem tieferen Verständnis und dem nach Hoffmann "tiefen Grund" des Capriccios zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Von der Ironie als Implikatur zur romantischen Universalpoesie bei Schlegel
- 2.1 Potenzial des Paradoxen
- 2.2. Das Nicht-Ich und die Reflexivität der Ironie
- 3. Ironische Identitätsbildung in E.T.A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla
- 3.1 Die Identitäten-Krise von Giglio und Giacinta und die Grenzen des Ichs
- 3.2 Giglios Rollen, Maskeraden und (Ver-)Kleidung
- 3.3 Giglios Schwindel, Tanz und Tod
- 3.4 Der Spiegel des Ichs, die Urdarquelle und der Genius als ironische Identität
- 4. Conclusio
- 5. Didaktische Anlage - Skizzierung einer Unterrichtseinheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Ironie-Konzept von Friedrich Schlegel im Kontext von E.T.A. Hoffmanns „Prinzessin Brambilla“. Ziel ist es, die Anwendung dieses Konzepts auf Hoffmanns Werk zu beleuchten und zu analysieren, wie es die vielschichtigen Ebenen des Capriccios erschließt.
- Die Rolle von Ironie als Implikatur und ihre Entwicklung zur romantischen Universalpoesie bei Schlegel
- Das Potenzial des Paradoxen in Hoffmanns Werk
- Die Bedeutung von Ironie für die Identitätsbildung der Protagonisten
- Die Interaktion von Ironie und dem romantischen Motiv des Doppelgängers
- Die Katharsis und Auflösung des Verwirrspiels in „Prinzessin Brambilla“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Werk „Prinzessin Brambilla“ ein und beleuchtet die Komplexität der Geschichte durch ihre Vielschichtigkeit und das verworrene Gefüge der Figuren. Das zweite Kapitel befasst sich mit Schlegels Ironiebegriff und seiner Entwicklung. Es untersucht die Funktion von Ironie als Implikatur und die Ausweitung dieses Konzepts hin zur romantischen Universalpoesie. Im dritten Kapitel wird Schlegels Konzept auf „Prinzessin Brambilla“ angewandt und untersucht, wie es die Identitätsbildung der Protagonisten, insbesondere die von Giglio Fava, beleuchtet. Darüber hinaus werden die Rollen von Maskerade, (Ver-)Kleidung und dem Spiegel des Ichs im Kontext von Ironie analysiert. Das vierte Kapitel soll eine Conclusio beinhalten und die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die folgenden Schlüsselwörter und Themen: Ironie, romantische Universalpoesie, Friedrich Schlegel, E.T.A. Hoffmann, „Prinzessin Brambilla“, Identität, Doppelgänger, Maskerade, Spiegelung, Katharsis, Potenzial des Paradoxen.
- Quote paper
- Marvin Schmidt (Author), 2018, Untersuchungen zu Friedrich Schlegels Ironie-Konzept und dem Potenzial des Paradoxen in E.T.A. Hoffmanns Capriccio "Prinzessin Brambilla", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1399182