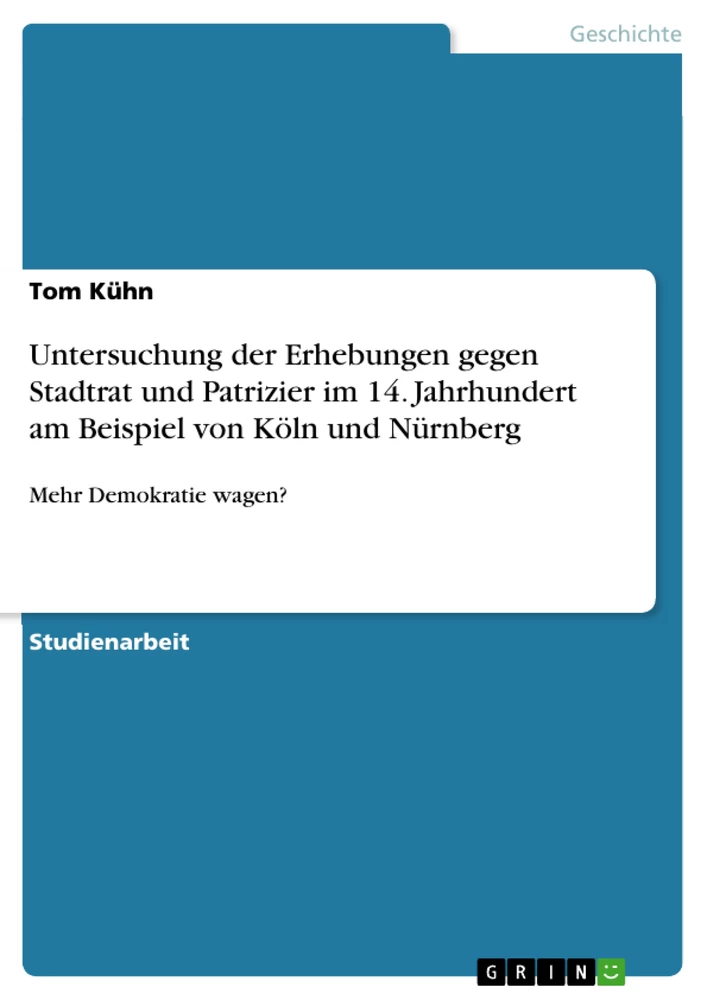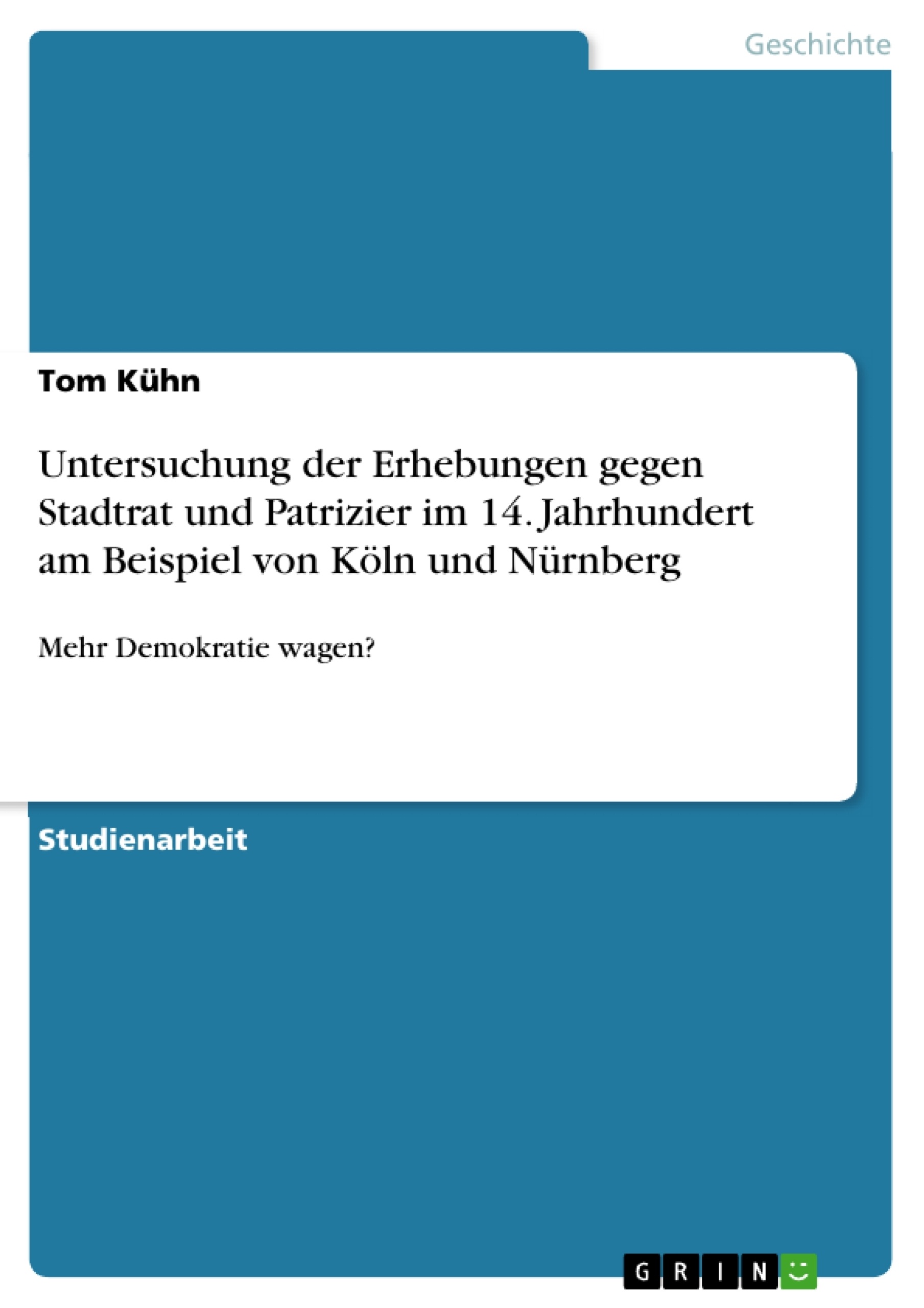Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Frage zu klären, ob die Aufstände des 14. Jahrhunderts für eine echte Machtverschiebung zugunsten der breiten Bevölkerung sorgten. Dafür werden die beiden Städte Köln und Nürnberg verglichen. In Köln scheint ein solcher Aufstand erfolgreich gewesen zu sein. Ob die durch den Aufstand entstandene Verfassung aber tatsächlich für demokratische Verhältnisse sorgte, wird in Kapitel 3 untersucht. Die Quelle “Kölner Verbundbrief über die Gaffelverfassung von 1396“ wurde von Bernd-Ulrich Hergemöller im 34sten Band der Freiherr-vom-Stein Gedächtnisausgabe übersetzt. Kapitel 2 stellt die beiden entscheidenden gesellschaftlichen Gruppen bei der Betrachtung des Stadtrates vor: die Patrizier und die Zünfte. In Artikel 3 und 4 werden die unterschiedlichen Entwicklungen in Köln und Nürnberg miteinander verglichen. Während in Köln mit dem Verbundbrief 1396 eine Stadtverfassung mit neu geordneten Machtverhältnissen entstand, blieben in Nürnberg nach dem Aufstand von 1348/49 die Patrizier an der Macht. Kapitel 3.1 thematisiert die Situation Kölns vor dem Verbundbrief, die durch die Herrschaft der Richerzeche geprägt war. Kapitel 3.2 analysiert den Verbundbrief auf die Frage, inwieweit hier eine neue Verfassung geschaffen wurde, die einer breiteren Bevölkerungsschicht die politische Teilhabe ermöglichte. Kapitel 4.1 beleuchtet die Machtverteilung in Nürnberg vor 1348 und Kapitel 4.2 beschreibt den Verlauf und die Folgen des Aufstands. Kapitel 4.3 untersucht und interpretiert die Quelle “Gnadenakt für die Aufsässigen der Stadt Nürnberg“, die in den Kontext des sogenannten Handwerkaufstandes fällt.
Im 14. Jahrhundert war die breite Bevölkerung in vielen Städten mit den herrschenden Patriziern unzufrieden und Zünfte sowie Kaufleute strebten nach Beteiligung am Stadtregime. Der Stadtrat war das entscheidende Gremium, mit dem die Familien der Elite die Stadt beherrschten. Solange sie den Rat kontrollierten, kontrollierten sie die Stadt. Vielerorts kam es im 14. Jahrhundert zu Unruhen und Aufständen gegen den Stadtrat, die zum Ziel hatten, die Macht der im Stadtrat vertretenen Familien zu stürzen. Bei diesen Aufständen waren nicht nur Zünfte, sondern auch reich gewordene Kaufleute vertreten, denen bisher der Zugang zum Rat verwehrt blieb. Doch war das Ziel der Erhebungen wirklich mehr Demokratie zu wagen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gesellschaftliche Gruppen
- 2.1 Die Patrizier
- 2.2 Die Zünfte
- 3. Der Kölner Stadtrat im 14. Jahrhundert
- 3.1 Der Kölner Stadtrat vor 1396: Herrschaft der Richerzeche
- 3.2 Quelle: Der Verbundbrief von 1396
- 4. Der Nürnberger Stadtrat im 14. Jahrhundert
- 4.1 Der Nürnberger Stadtrat vor 1348
- 4.2 Der Aufstand von 1348/1349
- 4.3 Quelle: Gnadenakt für die Aufsässigen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erhebungen gegen Stadtrat und Patrizier im 14. Jahrhundert in Köln und Nürnberg. Das Hauptziel ist die Klärung der Frage, ob diese Aufstände zu einer echten Machtverschiebung zugunsten der breiten Bevölkerung führten und ob das Streben nach „mehr Demokratie“ tatsächlich im Vordergrund stand. Der Vergleich beider Städte soll zeigen, ob und inwiefern sich die Ergebnisse der Aufstände unterschieden.
- Analyse der gesellschaftlichen Gruppen (Patrizier und Zünfte) im Kontext der Stadträte.
- Vergleich der Machtstrukturen und Entwicklungen in Köln und Nürnberg im 14. Jahrhundert.
- Untersuchung der Ursachen und des Verlaufs der Aufstände.
- Auswertung relevanter Quellen (Verbundbrief von 1396 in Köln, Gnadenakt für die Aufsässigen in Nürnberg).
- Bewertung des Ausmaßes der demokratischen Veränderungen nach den Aufständen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Aufstände gegen Stadträte und Patrizier im 14. Jahrhundert ein. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Ausmaß der demokratischen Veränderungen in Folge dieser Aufstände und kündigt den Vergleich der Städte Köln und Nürnberg an. Ein zentrales Zitat verdeutlicht den Kontext: die Absetzung des patrizierischen Regimes in Köln 1396 durch ein Bündnis von Webern, Handwerkern und neuen Kaufmannsfamilien. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die verwendeten Quellen, darunter der Kölner Verbundbrief von 1396 und der Nürnberger Gnadenakt für die Aufsässigen.
2. Gesellschaftliche Gruppen: Dieses Kapitel analysiert die beiden wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen im Kontext der städtischen Machtverhältnisse des 14. Jahrhunderts: die Patrizier und die Zünfte. Es definiert die Patrizier als städtische Führungsschicht, oft ministerial-niederadeliger Herkunft, die die ersten Stadträte bildeten. Ihre Rolle im Handel und Fernhandel, ihre Kontrolle über den Stadtrat und somit die Stadt, wird hervorgehoben. Das Kapitel thematisiert auch die soziale Mobilität innerhalb des Patriziates und die Begriffe "Honoratioren" und "Ehrbare" für neu reich gewordene Familien. Die Zünfte werden als Gegenspieler zum Patriziat eingeführt, wobei ihre Bedeutung für die Aufstände im folgenden Kontext ausführlicher beleuchtet werden wird.
3. Der Kölner Stadtrat im 14. Jahrhundert: Das Kapitel behandelt die Entwicklung des Kölner Stadtrates im 14. Jahrhundert, beginnend mit der Herrschaft der Richerzeche. Es analysiert den Verbundbrief von 1396 als Schlüsselquelle, um die Frage zu beantworten, ob dieser eine neue, demokratischere Verfassung einführte. Der Fokus liegt auf der Analyse der Machtverschiebung und der Beteiligung breiterer Bevölkerungsschichten an der politischen Teilhabe nach dem Aufstand.
4. Der Nürnberger Stadtrat im 14. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt die Machtverhältnisse im Nürnberger Stadtrat vor dem Aufstand von 1348/49 und analysiert den Verlauf und die Folgen dieses Aufstands. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung des Gnadenakts für die Aufsässigen, der Aufschlüsse über den Kontext und die Auswirkungen des sogenannten Handwerkaufstands gibt. Im Gegensatz zu Köln wird hier die Frage untersucht, inwieweit die Patrizier ihre Macht trotz des Aufstandes behaupten konnten.
Schlüsselwörter
Stadtrat, Patrizier, Zünfte, Aufstände, 14. Jahrhundert, Köln, Nürnberg, Machtverhältnisse, Demokratie, Verbundbrief 1396, Gnadenakt, soziale Mobilität, Stadtverfassung, politische Teilhabe, Quellenanalyse, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen zu: Aufstände gegen Stadtrat und Patrizier im 14. Jahrhundert in Köln und Nürnberg
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Aufstände gegen den Stadtrat und die Patrizier im 14. Jahrhundert in Köln und Nürnberg. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob diese Aufstände zu einer echten Machtverschiebung zugunsten der breiten Bevölkerung führten und ob das Streben nach „mehr Demokratie“ tatsächlich im Vordergrund stand. Ein Vergleich der beiden Städte soll die Unterschiede der Ergebnisse der Aufstände aufzeigen.
Welche gesellschaftlichen Gruppen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Patrizier als städtische Führungsschicht und die Zünfte als ihre Gegenspieler. Es wird die Rolle beider Gruppen im Kontext der städtischen Machtverhältnisse des 14. Jahrhunderts untersucht, inklusive der sozialen Mobilität innerhalb des Patriziates und der Bedeutung der Zünfte für die Aufstände.
Welche Städte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Entwicklungen in Köln und Nürnberg im 14. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf den jeweiligen Stadträten, den Ursachen und dem Verlauf der Aufstände sowie den daraus resultierenden Veränderungen der Machtverhältnisse.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse relevanter Quellen, insbesondere des Verbundbriefs von 1396 in Köln und des Gnadenakts für die Aufsässigen in Nürnberg. Diese Quellen liefern wichtige Informationen über den Kontext und die Auswirkungen der Aufstände.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit die Aufstände in Köln und Nürnberg zu einer demokratischen Veränderung führten. Es wird untersucht, ob und in welchem Ausmaß die Macht tatsächlich zugunsten der breiten Bevölkerung verschoben wurde.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Gesellschaftliche Gruppen (Patrizier und Zünfte), Der Kölner Stadtrat im 14. Jahrhundert, Der Nürnberger Stadtrat im 14. Jahrhundert und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Thematik, wobei die Kapitel 3 und 4 einen detaillierten Vergleich der beiden Städte bieten.
Was wird im Kapitel über den Kölner Stadtrat behandelt?
Das Kapitel über den Kölner Stadtrat analysiert die Entwicklung des Stadtrates im 14. Jahrhundert, beginnend mit der Herrschaft der Richerzeche. Der Verbundbrief von 1396 wird als Schlüsselquelle zur Analyse der Machtverschiebung und der Beteiligung breiterer Bevölkerungsschichten an der politischen Teilhabe nach dem Aufstand verwendet.
Was wird im Kapitel über den Nürnberger Stadtrat behandelt?
Das Kapitel über den Nürnberger Stadtrat beschreibt die Machtverhältnisse vor dem Aufstand von 1348/49 und analysiert den Verlauf und die Folgen dieses Aufstands. Der Gnadenakt für die Aufsässigen steht im Mittelpunkt der Analyse und es wird untersucht, inwieweit die Patrizier ihre Macht trotz des Aufstands behaupten konnten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stadtrat, Patrizier, Zünfte, Aufstände, 14. Jahrhundert, Köln, Nürnberg, Machtverhältnisse, Demokratie, Verbundbrief 1396, Gnadenakt, soziale Mobilität, Stadtverfassung, politische Teilhabe, Quellenanalyse, Vergleichende Analyse.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit folgt einem klaren Aufbau: Sie beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik einführt und die Forschungsfrage formuliert. Es folgen Kapitel zur Analyse der gesellschaftlichen Gruppen, zu den Stadträten in Köln und Nürnberg und schließlich ein Fazit. Der Vergleich zwischen Köln und Nürnberg ist ein zentraler Aspekt der Arbeit.
- Quote paper
- Tom Kühn (Author), 2020, Untersuchung der Erhebungen gegen Stadtrat und Patrizier im 14. Jahrhundert am Beispiel von Köln und Nürnberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1398459