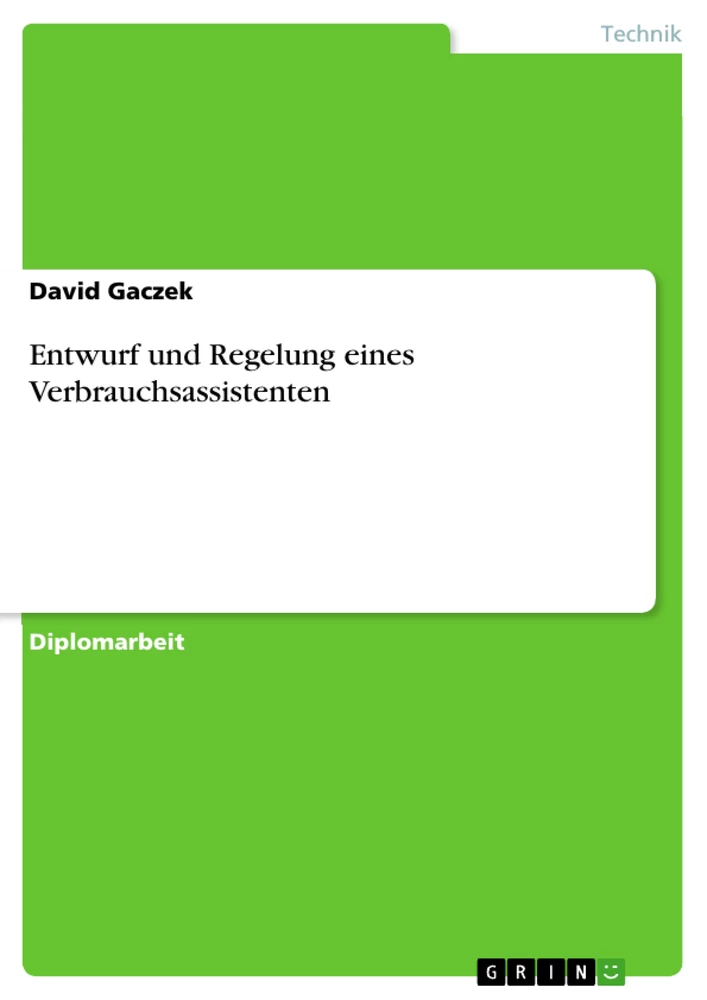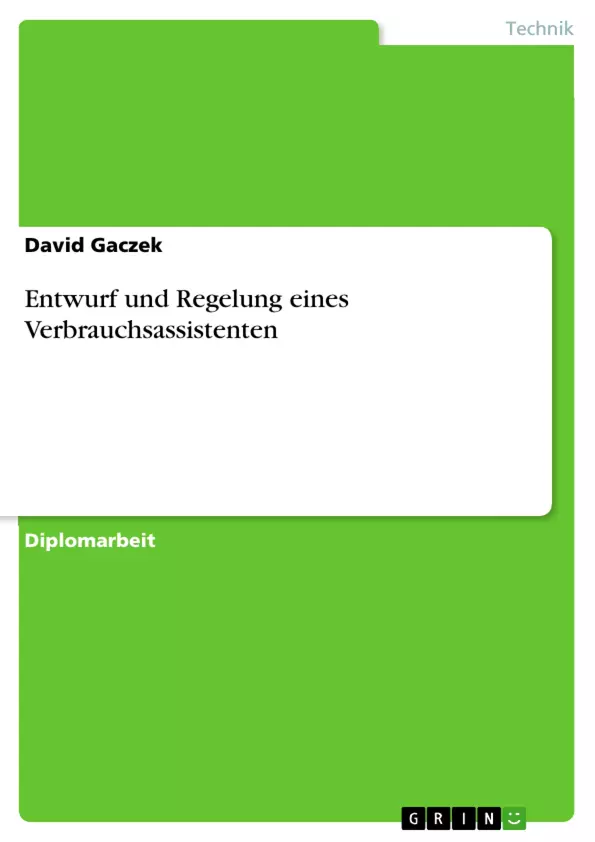Welcher Autofahrer kennt es in der heutigen Zeit nicht, den Anblick der an Straßenrändern emporragenden Preistafeln von Tankstellen, die uns nahezu Tag täglich neue Spitzenrekorde aufzeigen? Auf dem Weg unaufhörlich steigender Kraftstoffpreise befinden wir uns in einer Zeit, in der es gerade in Deutschland bereits vielen aus finanzieller Sicht schwer fällt, ihr Fahrzeug zu benutzen bzw. zu bewegen, und doch werden sie sich auch in Zukunft nicht ohne weiteres von der Abhängigkeit dessen befreien können.
Nicht nur aus diesem Grund, sondern auch aus umweltrelevanter Dringlichkeit ist die Automobilindustrie bemüht und dazu verpflichtet, durch Innovationen im Bereich der Motor- sowie Fahrzeugtechnik die Wirtschaftlichkeit von Fahrzeugen durch Lösungen
zur Verbrauchsreduzierung zu verbessern. Aus vielen Quellen erfährt man aber auch, dass der Fahrer selbst durch entsprechendes Verhalten und seine Fahrweise entscheidend zur Verbrauchssenkung seines Fahrzeugs beitragen kann.
Da die Wirtschaftlichkeit von Fahrzeugen unter anderem durch die in den letzten Jahren erfahrene Zunahme und Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen (FAS) profitiert, wird in dieser Arbeit ein Verbrauchsassistent (VA) entworfen / entwickelt, der den Fahrer dabei unterstützen soll, sein Fahrzeug verbrauchsoptimal zu führen.
Einführend wird hierzu der dringende Handlungsbedarf hinsichtlich der Verbrauchsreduzierung verdeutlicht. Eingriffsmöglichkeiten werden anhand motorischer sowie fahrzeugdynamischer Grundlagen bezüglich des Kraftstoffverbrauchs von Fahrzeugen erläutert. Nach dem umrissenen
Stand der Technik zu Verbrauchsassistenten wird dargestellt, welche Arten der Realisierung eines Verbrauchsassistenten als FAS prinzipiell möglich sind.
Anhand der Diskussion von Verhaltenstypologien im Straßenverkehr wird der Entwurf des Verbrauchsassistenten konzeptioniert.
Dessen Funktionen bzw. Funktionsweisen sowie mögliche konstruktive Umsetzungen in einem Fahrzeug werden konkretisiert und erläutert.
Im Kapitel 7 wird ein als Bezugsfahrzeug gewählter BMW 528 i in seinen technischen Daten vorgestellt, für den die verbrauchsoptimalen Betriebszustände nach eigenen Ansätzen hergeleitet und für die Modellierung des Verbrauchsassistenten (MatLab) als Grundlage verwendet werden. Der Effizienznachweis des VA wird schließlich an Simulationsergebnissen gezeigt und diskutiert.
Zukünftige Verbesserungen, Erweiterungen sowie Ausblicke schließen die Ausarbeitung ab.
INHALTSVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Verwendete Formelzeichen
Abkürzungen und Indizes
VA - Modellsignale und Bezeichnungen
Einleitende Worte
1 Einführung
1.1 Die Mobilität
1.2 Negative Auswirkungen des Verkehrs
1.3 Die Vorteile eines niedrigen Kraftstoffverbrauchs
1.3.1 Zusammenhang zwischen Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemission
1.3.2 Zusammenhang zwischen Kraftstoffverbrauch und CO2 - Emission
1.3.3 Kraftstoffverbrauch als bedeutender Kostenfaktor
1.4 Maßnehmen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
1.5 Motivation für einen Verbrauchsassistenten als Fahrerassistenzsystem
2 Motorische Grundlagen des Kraftstoffverbrauchs
2.1 Motorische Grundlagen und effektive Motorbetriebsdaten
2.1.1 Das Prinzip eines Hubkolben - Verbrennungsmotors
2.1.2 Verluste und Wirkungsgrade
2.1.3 Der indizierte Mitteldruck und effektive Mitteldruck
2.1.4 Die effektive Leistung und das Drehmoment
2.1.5 Der spezifische Kraftstoffverbrauch
2.1.6 Zusammenfassung der effektiven Motorbetriebsdaten
2.2 Das Betriebsverhalten eines Motors
2.2.1 Einfluss der Motordrehzahl und der Motorlast auf die Wirkungsgrade
2.2.2 Einfluss der Motorlast auf den spezifischen Kraftstoffverbrauch
2.2.3 Einfluss der Motordrehzahl auf den spezifischen Kraftstoffverbrauch
2.2.4 Einfluss der Motordrehzahl auf das Drehmoment und die Nutzleistung
2.2.5 Das Verbrauchskennfeld
2.3 Einfluss des Fahrerverhaltens auf den Kraftstoffverbrauch
2.4 Verbrauchsoptimales Fahrerverhalten anhand motorischer Grundlagen
3 Fahrzeugdynamische Grundlagen des Kraftstoffverbrauchs
3.1 Die Fahrzeuglängsdynamik
3.2 Die Zugkraft in Abhängigkeit der Getriebeübersetzung und der effektiven Motorkenngrößen
3.3 Zugkrafthyperbeln und Fahrzustandsschaubilder
3.4 Interpretation des Zugkrafteinflusses auf den Kraftstoffverbrauch
3.5 Optimierbarkeit der Zugkraftanteile über die Fahrweise
3.6 Zusammenfassung zu Regeln für eine verbrauchsgünstige Fahrweise
4 Ein Verbrauchsassistent als Fahrerassistenzsystem
4.1 Formulierung allgemeiner Aufgaben eines Verbrauchsassistenten
4.2 Stand der Technik in Bezug auf Verbrauchsassistenten
4.3 Allgemeines zu Fahrerassistenzsystemen
4.3.1 Einteilung der Fahrerassistenzsysteme
4.3.2 Das System Fahrer - Fahrzeug - Umwelt und mögliche Ausführungen von Fahrerassistenzsystemen
4.3.3 Informationsdarstellung
4.4 Diskussion sinnvoller Ausführungen des Verbrauchsassistenten
4.4.1 Elementare Aufgaben und Belastungen des Fahrers im täglichen Straßenverkehr
4.4.2 Sinnvolle Realisierung
4.4.3 Sinnvolle Informationsdarstellung
5 Verhaltenstypologien im Straßenverkehr
5.1 Unterscheidung von Fahrertypen
5.2 Elementare Fahrzustände
5.3 Beschreibung typischer Verkehrssituationen und Verkehrszustände
5.3.1 Der Bremsvorgang als Verkehrssituation
5.3.2 Das Halten als Verkehrssituation
5.3.3 Der Abbiegevorgang als Verkehrssituation
5.3.4 Der Überholvorgang als Verkehrssituation
5.3.5 Die Kurvenfahrt als Verkehrssituation
5.3.6 Innerortsverkehr als Verkehrszustand (stabil)
5.3.7 Überlandverkehr als Verkehrszustand (stabil)
5.3.8 Autobahnverkehr als Verkehrszustand (stabil)
5.3.9 Stop & Go als Verkehrszustand (instabil)
5.4 Resultierende sinnvolle Einschränkungen und Berücksichtigungen des Verbrauchsassistenten
6 Funktionsweise des Verbrauchsassistenten und Möglichkeiten der konstruktiven Umsetzung
6.1 Das Konzept zur Funktionsweise des Verbrauchsassistenten
6.1.1 Die Beschleunigungsfunktion (BFKT)
6.1.2 Die Konstantfahrtfunktion (KFFKT)
6.1.3 Ergänzende allgemeine Funktionen des Verbrauchsassistenten
6.2 Möglichkeiten der konstruktiven Umsetzung
6.2.1 Integrationsmöglichkeiten visueller Komponenten
6.2.2 Konstruktive Möglichkeiten eines aktiven Fahrpedals
7 Versuchsträger als Bezugsfahrzeug
7.1 Fahrzeugdimensionen
7.2 Getriebe
7.3 Motor
7.3.1 Motorkennfelder
7.3.2 Linien minimalen Verbrauchs (Ansätze und Ermittlung)
7.3.2.1 Ansatz für „MinLinie 1“
7.3.2.2 Ansatz für „MinLinie 2“
7.3.2.3 Ansatz für „MinLinie 3“
7.3.2.4 Ansatz für „MinLinie 4“
7.3.3 Prüfung und Glättung der Linien minimalen Verbrauchs
8 Modellierung und Regelung des Verbrauchsassistenten
8.1 Allgemeines zum Modell
8.2 Vorbereitung und Anpassung des Fahrzeugmodells
8.3 Das Modell des Verbrauchsassistenten
8.3.1 Grundaufbau und Struktur
8.3.2 Verbrauchsberechnung
8.3.3 Beschleunigungsfunktion
8.3.4 Konstantfahrtfunktion
8.3.5 VA - Control (VAC)
8.3.6 Die Regelung und das Subsystem „Regelung“
8.3.7 Visualisierung
9 Simulationsergebnisse
9.1 Allgemeines zur Durchführung
9.2 Beschleunigungsvorgänge und Linien minimalen Verbrauchs
9.3 Simulationsergebnisse der Referenzfahrten mit und ohne VA
9.3.1 Ungedrosselte Basisreferenzfahrt auf ebener Fahrbahn
9.3.2 Gedrosselte Basisreferenzfahrt auf ebener Fahrbahn
9.3.3 Ungedrosselte Referenzfahrt bei Steigung pF =0,035
9.3.4 Gegenüberstellung der sportlichen und normalen Fahrweise
9.4 Diskussion der Simulationsergebnisse
10 Ausblicke, Zusammenfassung und Schlussfolgerung
10.1 Der Verbrauchsassistent in einem Fahrzeug
10.2 Verbesserungen und Ausblicke
10.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerung
ANHANG
A-1 Fußraumeinschränkungen bei oben auf das Fahrpedal angreifenden Feder
A-2 Linien minimalen Verbrauchs MinLinie 1 - MinLinie 4
A-3 Modelldokumentation
A-3.1 Grundaufbau und Struktur
A-3.2 Subsystem „Verbrauchsberechnung“
A-3.3 Beschleunigungsfunktion (BFKT)
A-3.4 Konstantfahrtfunktion
A-3.5 VA - Control (VAC)
A-3.6 Die Regelung und das Subsystem „Regelung“
A-3.7 Visualisierung
A-4 Beschleunigungs - Testreihen zur Effizienzbestimmung der Linien minimalen Verbrauchs MinLinie 1 - MinLinie 4
A-4.1 Beschleunigungstests in der Ebene
A-4.2 Beschleunigungstests bei 10 %-iger Fahrbahnsteigung (pF =0,1)
A-5 Vereinfachte Herleitung des Bezugs zwischen der Fußkraft des Fahrers, der Drosselklappen- und der Fahrpedalstellung
A-6 Die SSS - Funktion (speicherbare Standardstrecken)
LITERATURHINWEISE
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
TABELLENVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
VERWENDETE FORMELZEICHEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ABKÜRZUNGEN UND INDIZES
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
VA – MODELLSIGNALE UND BEZEICHNUNGEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einleitende Worte
Welcher Autofahrer kennt es in der heutigen Zeit nicht, den Anblick der an Straßenrändern emporragenden Preistafeln von Tankstellen, die uns nahezu Tag täglich neue Spitzenrekorde aufzeigen? Auf dem Weg unaufhörlich steigender Kraftstoffpreise befinden wir uns in einer Zeit, in der es gerade in Deutschland bereits vielen aus finanzieller Sicht schwer fällt, ihr Fahrzeug zu benutzen bzw. zu bewegen, und doch werden sie sich auch in Zukunft nicht ohne weiteres von der Abhängigkeit dessen befreien können.
Nicht nur aus diesem Grund, sondern auch aus umweltrelevanter Dringlichkeit ist die Automobilindustrie bemüht und dazu verpflichtet, durch Innovationen im Bereich der Motor- sowie Fahrzeugtechnik die Wirtschaftlichkeit von Fahrzeugen durch Lösungen zur Verbrauchsreduzierung zu verbessern. Aus vielen Quellen erfährt man aber auch, dass der Fahrer selbst durch entsprechendes Verhalten und seine Fahrweise entscheidend zur Verbrauchssenkung seines Fahrzeugs beitragen kann.
Da die Wirtschaftlichkeit von Fahrzeugen unter anderem durch die in den letzten Jahren erfahrene Zunahme und Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen (FAS) profitiert, wird in dieser Arbeit ein Verbrauchsassistent (VA) entworfen, der den Fahrer dabei unterstützen soll, sein Fahrzeug verbrauchsoptimal zu führen.
Einführend wird hierzu in Kapitel 1 der dringende Handlungsbedarf hinsichtlich der Verbrauchsreduzierung verdeutlicht. Die Kapitel 2 und 3 werden anschließend die Eingriffsmöglichkeiten anhand motorischer sowie fahrzeugdynamischer Grundlagen bezüglich des Kraftstoffverbrauchs von Fahrzeugen erläutern. Nach dem umrissenen Stand der Technik zu Verbrauchsassistenten wird Kapitel 4 darstellen, welche Arten der Realisierung eines Verbrauchsassistenten als FAS prinzipiell möglich sind. Anhand der Diskussion von Verhaltenstypologien im Straßenverkehr wird Kapitel 5 mit einem Konzept für den Entwurf des Verbrauchsassistenten abschließen, dessen Funktionen bzw. Funktionsweisen sowie mögliche konstruktive Umsetzungen in einem Fahrzeug in Kapitel 6 konkretisiert und erläutert werden. Im anschließenden Kapitel 7 wird ein als Bezugsfahrzeug gewählter BMW 528 i in seinen technischen Daten vorgestellt, für den die verbrauchsoptimalen Betriebszustände nach eigenen Ansätzen hergeleitet und für die Modellierung des Verbrauchsassistenten in Kapitel 8 als Grundlage verwendet werden. Der Effizienznachweis des entworfenen Systems erfolgt schließlich in Kapitel 9, in dem Simulationsergebnisse dargelegt und diskutiert werden. Das letzte Kapitel 10 stellt zukünftige Verbesserungen, Erweiterungen sowie Ausblicke vor und schließt mit einer schlussfolgernden Zusammenfassung ab.
1 Einführung
1.1 Die Mobilität
Die Mobilität hat sich über die Jahre zum wichtigsten, selbstverständlichen und unverzichtbaren Luxus der Menschheit entwickelt. Tag täglich ist die Gesellschaft auf die Mobilität angewiesen und von ihr abhängig, bedenkt man zum Beispiel nur den Transport von Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern. Daneben spielt aber die Mobilität der einzelnen Menschen (motorisierter Individualverkehr) mittlerweile eine übergeordnete Rolle, sei es beim Erreichen von Arbeits- und Freizeitstätten oder beim Einkaufen, Reisen oder Besuchen entfernt wohnender Familienangehörigen.
Einen Überblick über die Entwicklung der Mobilität von 1950 - 2003 in Deutschland zeigt das Diagramm in Bild 1.1.1. Die Aufteilung des deutschen Personenverkehrs im Jahr 2002 geht aus der Darstellung in Bild 1.1.2 hervor. In den Diagrammen sichtbar ist der mit Abstand am stärksten vertretene Verkehrszweig des motorisierten Individualverkehrs.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.1.1.: Mobilitätsentwicklung 1950 - 2003 anhand zulassungspflichtiger Fahrzeuge in Deutschland nach [4, 5]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.1.2.: Deutschlands Personenverkehr im Jahr 2002 (au ß er Luftverkehr), nach [4]
Für das Verkehrswachstum sind unter anderem verantwortlich [6] :
- die EU - Osterweiterung
- Produktionsstrukturen, Unternehmensstrukturen
- der Trend zur Individualisierung
- die Zunahme des Freizeitverkehrs
- wachsende Distanzen (Aktionsradien)
- die Funktionstrennung von Wohnen, Freizeit, Einkauf
- das Wirtschaftswachstum
1.2 Negative Auswirkungen des Verkehrs
Neben gesellschaftlichen und infrastrukturellen Vorteilen zeigt der Verkehr nennenswerte negative Auswirkungen auf die Umwelt, die hauptsächlich durch die Abgasemission konventionell angetriebener Kraftfahrzeuge mittels Otto- und Dieselmotoren verursacht werden. Im Vordergrund der Betrachtungen stehen hier hauptsächlich die gesetzlich limitierten Abgasschadstoffe Kohlenstoffmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffe (HC), Stickoxide (NOX) und Ruß sowie die klimarelevante Emission von Kohlenstoffdioxid (CO2 ). Verstärkt durch den Verkehrswachstum sind diese für die unaufhörlich steigende Umweltbelastung und Klimaerwärmung mitverantwortlich [7, 8].
Die kritische Entwicklung der globalen Umweltsituation erfordert daher nicht nur aus aktuellen Anlässen wie z. B. den Klimakatastrophen in den USA einerseits immer strenger werdende gesetzliche Abgasverordnungen. Neben den Bemühungen zur Schadstoffabsenkung schenkt man in den letzten Jahren andererseits der Limitierung des CO2 - Ausstoßes vermehrte Aufmerksamkeit. So unterzeichneten bisher mehr als 180 Länder bzw. Staaten das 1997 verabschiedete und 2005 in Kraft getretene Abkommen zur Verminderung von Treibhausgasen auf der Weltklimakonferenz in Kyoto (Kyoto - Protokoll) [10]. Vor allem der Anteil des Kohlendioxids von etwa 84 % an den durch menschliche Aktivitäten verursachten Treibhausgasen ist dabei vordergründig zu behandeln. So hat sich beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland dazu verpflichtet bzw. zum Ziel gesetzt, die CO2 - Emission um 21 % gegenüber dem Niveau von 1990 zu senken [10]. Aufgrund der Tatsache, dass ein relevanter Anteil der CO2 - Emission durch den Bereich „Verkehr“ verursacht wird, verpflichten sich unter anderem europäische Automobilhersteller zu einer deutlichen Absenkung des Kohlendioxidausstoßes [11].
Zur Verdeutlichung der immer strenger werdenden Abgasvorschriften für PKWs mit Otto- und Dieselmotoren in Europa dienen die Diagramme in Bild 1.2.1 und Bild 1.2.2. Die Verteilung der CO2 - Emission Deutschlands im Jahre 2002 zeigt das Diagramm in Bild 1.2.3.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.2.1. : EURO - Abgasnormen für PKW mit Dieselmotor nach [12, 13]
Bild 1.2.2. : EURO - Abgasnormen für PKW mit Ottomotor nach [12, 13]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.2.3.: Verteilung der CO2 - Emission in Deutschland 2002, nach [11]
1.3 Die Vorteile eines niedrigen Kraftstoffverbrauchs
Zur Erfüllung der Abgasvorschriften wurden in den letzten Jahren verschiedene Maßnahmen entwickelt, die sich prinzipiell unterschiedlich orientieren und grob unterteilt werden können in
a. Maßnahmen zur Verbesserung der Abgasqualität
- motorische Maßnahmen (z.B. AGR)
- katalytische Abgasnachbehandlung (3-Wege-Kat, NOX - Speicherkat, PM - Filter)
b. Maßnahmen zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs
Aus Relevanzgründen wird an dieser Stelle lediglich auf die den Kraftstoffverbrauch senkenden Maßnahmen eingegangen, die einerseits zur Absenkung der Schadstoffemission beitragen und ohne die andererseits eine Reduktion des CO2 - Ausstoßes überhaupt nicht möglich wäre.
1.3.1 Zusammenhang zwischen Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemission
Der Zusammenhang zwischen dem Kraftstoffverbrauch und der Schadstoffemission eines Fahrzeugs wird am Beispiel des Ottomotors verdeutlicht. In Bild 1.3.1.1 ist hierzu die typische Aufteilung der Abgaskomponenten eines Ottomotors dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.3.1.1.: Typische Rohabgaszusammensetzung eines Ottomotors (λ = 1), nach [8]
Betrachtet man die relativen Angaben der Schadstoffanteile im Motorabgas [%] und die absoluten Angaben der vorgeschriebenen Schadstoffgrenzwerte [g/km] (Bild 1.2.2 und Bild 1.3.1.1), so kann ein allgemeiner Zusammenhang zwischen dem Kraftstoffverbrauch und der Schadstoffemission eines Fahrzeugs formuliert werden :
Je geringer der Kraftstoffverbrauch, umso kleiner die emittierte Schadstoffmasse (1)
1.3.2 Zusammenhang zwischen Kraftstoffverbrauch und CO2 - Emission
Während die Schadstoffemission durch weitere Maßnahmen (wie z.B. AGR oder katalytische Abgasnachbehandlung) zusätzlich reduziert werden kann, verhält es sich beim CO2 anders. Kohlendioxid entsteht bei vollständiger Verbrennung durch den im Kraftstoff enthaltenen chemisch gebundenen Kohlenstoff. Dabei ist die Menge des freigesetzten Kohlendioxids direkt proportional zum Kraftstoffverbrauch und kann daher lediglich über diesen reduziert werden [8].
Zwischen dem Kraftstoffverbrauch und der Kohlenstoffdioxidemission besteht somit der Zusammenhang :
Je geringer der Kraftstoffverbrauch, umso kleiner die emittierte CO2 - Menge (2)
1.3.3 Der Kraftstoffverbrauch als bedeutender Kostenfaktor
Eine weitere überaus wichtige Bedeutung des Kraftstoffverbrauchs kann aus der Entwicklung der Kraftstoff- bzw. Rohölpreise der letzten Jahre interpretiert werden. Hierzu sind in Bild 1.3.3.1 und Bild 1.3.3.2 die Entwicklungen der Rohölpreise sowie der Kraftstoff - Endverbraucherpreise in Deutschland jeweils für den Zeitraum von 2001 bis 2005 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.3.3.1.: Rohölpreise Jan2001 - Sep2005, nach [14]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.3.3.2.: Kraftstoff - Endverbraucherpreise in Deutschland Jan2001 - Sep2005, nach [14]
Die in den Diagrammen dargestellte Entwicklung verdeutlicht die ansteigende finanzielle Belastung der Konsumenten. Zu beobachten ist außerdem die in den letzten zwei Jahren kleiner werdende Preislücke zwischen dem Diesel- und dem Ottokraftstoff.
Maßnahmen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs können somit einerseits den Effekt der ansteigenden Kraftstoffpreise dämpfen oder gar kompensieren und vermindern andererseits in jedem Fall, d.h. kraftstoffpreisunabhängig die finanzielle Beanspruchung der Endverbraucher. Damit ergibt sich eine weitere Bedeutung des Kraftstoffverbrauchs durch den Zusammenhang :
Je geringer der Kraftstoffverbrauch, umso kostengünstiger die Fahrzeugfahrt bzw. (3)
Eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs dämpft die Kraftstoffpreisanstiege
1.4 Maßnahmen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
Bezüglich der erwähnten Umwelt- und Marktsituation verdeutlichen die genannten Gründe (1) - (3) aus Abschnitt 1.3 die Notwendigkeit der Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung.
Bei Betrachtung der verschiedenen Einflussfaktoren auf den Kraftstoffverbrauch im folgenden Bild 1.4.1 wird ersichtlich, dass prinzipiell verschiedene Ansatzpunkte zu dessen Absenkung möglich sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.4.1.: Die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kraftstoffverbrauch
Die meisten entwickelten Maßnahmen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs konzentrieren sich überwiegend auf die Ansatzpunkte der Fahrzeug- und Motortechnik (links in Bild 1.4.1). So sind dies zum Beispiel Leichtbau, Verbesserung der Aerodynamik, innovative Reifentechnologie, AGR, Nockenwellenverstellung, variable Ventilsteuerung, Ottodirekteinspritzung und andere.
Einen weiteren, sehr großen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch hat das Verhalten des Fahrers. An verschiedenen Literaturstellen [8, 15] wird hierzu betont, durch angepasstes Fahrerverhalten den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20 % und mehr senken zu können. Durch gezielte Fahrerschulungen (z.B. Eco-Training) sind in Einzelfällen Kraftstoffersparnisse von bis zu 42 % erzielbar [15].
Der hauptsächliche Grund hierfür ist, dass der Fahrer die physikalischen und technischen Gegebenheiten sowie die unterschiedlichen Betriebszustände des Fahrzeugs während einer Fahrt nicht ohne weiteres überblicken kann und sein Fahrzeug daher kaum oder gar nicht wirkungsgradoptimal nutzt. In den meisten Fällen bedient er sein Fahrzeug intuitiv und schöpft dessen Potential entsprechend seiner Wünsche bzw. Anforderungen nicht aus.
1.5 Motivation für einen Verbrauchsassistenten als Fahrerassistenzsystem
In der Wertschöpfung des Automobils nimmt der Anteil an Fahrerassistenzsystemen (FAS) in den letzten Jahren deutlich zu, die unter anderem die Wirtschaftlichkeit von Fahrzeugen unterstützen. Durch sowohl aktive als auch passive Beeinflussung des Fahrzeugs oder des Fahrers tragen einige FAS (z.B. Gangassistenten, AGS etc.) bereits direkt oder auch indirekt zur Verbrauchsreduzierung bei [1]. Dennoch besteht großer Handlungsbedarf am Ansatzpunkt „Fahrerverhalten“, da dieser in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch bisher nur wenig und nur indirekt bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen behandelt und berücksichtigt wurde.
Diese Lücke und Problematik motiviert zu dem Thema dieser Diplomarbeit, in der ein Konzept zum Entwurf und zur Regelung eines Verbrauchsassistenten erarbeitet und diskutiert wird.
Als geeignete Schnittstelle soll der Verbrauchsassistent das Ziel verfolgen, dem Fahrer entsprechend seiner Wünsche bzw. Anforderungen durch geeignete Rückmeldung die verbrauchsoptimale Gaspedalstellung zu signalisieren sowie ggf. Schaltvorgänge oder sonstiges verbrauchsoptimales Verhalten zu empfehlen.
Bevor jedoch die Aufgaben und Funktionen des Verbrauchsassistenten formuliert werden, ist es sinnvoll, in den folgenden Kapiteln die wichtigen Zusammenhänge des Kraftstoffverbrauchs anhand motorischer sowie fahrzeugdynamischer Grundlagen zu behandeln.
2 Motorische Grundlagen des Kraftstoffverbrauchs
Die für einen Verbrauchsassistenten wichtigen Zusammenhänge zwischen dem Fahrerverhalten und dem Kraftstoffverbrauch bzw. Einflüsse des Fahrerverhaltens auf den Kraftstoffverbrauch können zu einem großen Teil auf motorische Grundlagen zurückgeführt werden, die in diesem Kapitel behandelt werden. Dabei werden nur die relevanten Begriffe und Zusammenhänge aufgezeigt und erläutert.
2.1 Motorische Grundlagen und effektive Motorbetriebsdaten
2.1.1 Das Prinzip eines Hubkolben - Verbrennungsmotors
Hubkolben - Verbrennungsmotoren haben das Ziel, die mit dem Kraftstoff zugeführte chemische Energie in Rotationsenergie umzusetzen. Das Prinzip eines Motors ist im folgenden Bild 2.1.1.1 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 2.1.1.1.: Prinzip eines Hubkolben - Verbrennungsmotors
Hierbei wird der durch das Zünden der angesaugten und verdichteten Zylinderladung (Kraftstoff - Luft - Gemisch) verursachte auf den Kolben wirkende Druck über das Pleuel auf die Kurbelwelle übertragen und steht dort als Rotationsenergie in Form des Motordrehmoments und der Motordrehzahl zur Verfügung.
2.1.2 Verluste und Wirkungsgrade
Die Umsetzung der Kraftstoffenergie in Bewegungsenergie im motorischen Prozess ist stets mit erheblichen Verlusten behaftet, so dass lediglich ein kleiner Teil der zugeführten chemischen Energie in nutzbare Energie umgewandelt werden kann [8].
Zu Beurteilung der Effizienz eines Motors werden Wirkungsgrade herangezogen, die allgemein das Verhältnis aus nutzbarer (Output) und zugeführter (Input) Energie oder Leistung darstellen und somit eine Aussage über die entstehenden Verluste machen. Bei Behandlung von Verbrennungsmotoren werden die Verlustarten in jeweils unterschiedlichen Wirkungsgraden ausgedrückt.
Die thermodynamischen und prozessbedingten Verluste werden im Wirkungsgrad des vollkommenen Motors [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] berücksichtigt [17].
Wärmeverluste im Zylinder durch die nicht ideale Verbrennung, Verluste durch λ = 1 (Otto) sowie Ladungswechsel- und Strömungsverluste werden im so genannten Gütegrad betrachtet, der sich aus den einzelnen Gütegraden der Verbrennung, des Brennverlaufs, des Heizverlaufs und des Ladungswechsels zusammensetzt und definiert ist als [17] :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zusammengesetzt aus dem Wirkungsgrad des vollkommenen Motors und dem Gütegrad wird der innere Wirkungsgrad eines Motors, der beim Ottomotor zusätzlich durch den Wirkungsgrad der Kraftstoffzufuhr ergänzt wird, in dem das Entweichen der Frischgase in den Auspuff während des Ladungswechsels beachtet wird [17].
Es ist
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mechanische Verluste werden schließlich auf den inneren Wirkungsgrad bezogen und im mechanischen Wirkungsgrad [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] zusammengefasst [17].
Das Zusammenfassen der einzelnen Wirkungs- und Gütegrade ergibt den effektiven Wirkungsgrad (Nutzwirkungsgrad) eines Motors [20].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Grunde genommen entspricht [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] somit dem Verhältnis aus nutzbarer Leistung (am Schwungrad der Kurbelwelle) und der dem Motor mit dem Kraftstoff zugeführter chemischer Leistung. Da in ihm alle motorseitig entstehenden Verluste berücksichtigt werden, stellt der effektive Wirkungsgrad eine wichtige Kenngröße der effektiven Motorbetriebsdaten dar und ist daher für die Betrachtungen des Kraftstoffverbrauchs ausschlaggebend.
2.1.3 Der indizierte Mitteldruck und effektive Mitteldruck
Betrachtet man den (Zylinder-) Druckverlauf eines motorischen Prozesses über dem Hubvolumen, so erkennt man, dass die Drücke über der Zeit bzw. über der Volumenänderung nicht konstant sind. In der Motorentechnik ist daher die Definition von Mitteldrücken gebräuchlich, die in Bild 2.1.3.1 erläutert ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 2.1.3.1.: Definition des mittleren Drucks, aus [17]
Der Mitteldruck ist jener konstante Überdruck pm, der mit dem Hubvolumen im p - V - Diagramm eine rechteckige Fläche bildet, die der Arbeit des motorischen Prozesses entspricht. Der Mitteldruck entspricht somit der hubraumspezifischen Nutzarbeit [17].
Entscheidend bei der Untersuchung motorischer Prozesse sind die Definitionen
- des indizierten Mitteldrucks pi (oder auch pmi)
- des effektiven Mitteldrucks pe (oder auch pme).
Der indizierte Mitteldruck pi ist jener Mitteldruck, der aus der Druckindizierung eines Zylinders gewonnen wird, d.h. es ist der im Zylinder gemessene Mitteldruck, der entsprechend Bild 2.1.1.1 während des motorischen Prozesses auf den Kolben wirkt und über das Pleuel auf die Kurbelwelle übertragen wird [20].
Der indizierte Mitteldruck ist abhängig vom Gemischheizwert des Kraftstoffs Hu g, vom Liefergrad λL sowie vom inneren Wirkungsgrad η i und wird definiert durch :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die durch den indizierten Mitteldruck pi erzeugte Arbeit bzw. das erzeugte Drehmoment kann an der Kurbelwelle allerdings wegen der entstehenden mechanischen Verluste (s.o.) nicht vollständig abgegriffen werden, was zu der Definition des effektiven Mitteldrucks pe führt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die durch den effektiven Mitteldruck erzeugte Arbeit ist dann jene Arbeit, die an der Kurbelwelle für den Antrieb des Fahrzeugs effektiv genutzt werden kann.
Als nutzbarer Mitteldruck stellt pe neben dem effektiven Wirkungsgrad eine weitere wichtige Kenngröße der effektiven Motorbetriebsdaten dar und spielt daher für die Betrachtungen und Untersuchungen des Kraftstoffverbrauchs in motorischer Hinsicht eine bedeutende Rolle.
2.1.4 Die effektive Leistung und das Drehmoment
Neben dem effektiven Wirkungsgrad ηeff und dem effektiven Mitteldruck pe gehören das Drehmoment und die effektive Leistung zu den effektiven Motorbetriebsdaten.
Die effektive Leistung eines Motors ist definiert durch
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
und kann damit aus dem effektiven Mitteldruck pe, dem Zylinderhubvolumen VH, der Zylinderzahl z, der Motordrehzahl nM sowie der Kurbelwellenumdrehungen pro Arbeitsspiel [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] bestimmt werden.
Das (effektiv) nutzbare Drehmoment als wichtigste Anforderung des Fahrers folgt schließlich aus dem Zusammenhang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.1.5 Der spezifische Kraftstoffverbrauch
Der Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs oder Motors kann allgemein sowohl auf die Zeit als auch auf die Fahrstrecke bezogen werden. Üblich sind hierbei die Angaben des stündlichen Verbrauchs in g/h sowie des Streckenverbrauchs in kg/km. Um Verwechslungen zwischen den verschieden bezogenen Angaben zu vermeiden, sei an dieser Stelle definiert :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Automobilhersteller geben den Kraftstoffverbrauch in der Regel als Durchschnittswert in der Dimension l/100km an, der zusammen mit der Kraftstoffdichte aus dem Streckenverbrauch berechnet werden kann zu
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der Motorentechnik ist die Angabe des spezifischen Kraftstoffverbrauchs gebräuchlich, der als wichtige Kenngröße zu den effektiven Motorbetriebsdaten gehört und aus dem sich die Angaben des Verbrauchs aus Gl. 2.8 a - Gl. 2.8 c ableiten lassen.
Der effektive spezifische Kraftstoffverbrauch be ist definiert als das Verhältnis des stündlichen Verbrauchs zur effektiven Motorleistung :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zwischen dem spezifischen Kraftstoffverbrauch und dem effektiven Wirkungsgrad gilt außerdem der Zusammenhang :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hieran sieht man, dass bei konstantem Kraftstoffheizwert Hu durch die Erhöhung des effektiven Wirkungsgrades der spezifische Kraftstoffverbrauch gesenkt werden kann.
2.1.6 Zusammenfassung der effektiven Motorbetriebsdaten
Zum Überblick seien die für die Untersuchung des Kraftstoffverbrauchs bedeutenden effektiven Motorbetriebsdaten zusammengefasst :
- effektiver Mitteldruck pe (Gl. 2.5)
- effektive Leistung Peff (Gl. 2.6)
- Motor - Drehmoment M (Gl. 2.7)
- effektiver spezifischer Kraftstoffverbrauch be (Gl. 2.9, Gl. 2.10)
- effektiver Wirkungsgrad η eff (Gl. 2.3)
Bevor im weiteren Verlauf die Einflüsse des Fahrerverhaltens auf den Kraftstoffverbrauch untersucht und Ansätze für einen Verbrauchsassistenten hergeleitet werden können, muss noch das Betriebsverhalten eines Motors diskutiert werden, da die entstehenden Verluste und damit auch die effektiven Motorbetriebsdaten vom Betriebspunkt des Motors abhängen.
2.2 Das Betriebsverhalten eines Motors (Kennlinien und Kennfelder)
Das Betriebsverhalten von Motoren wird anhand von Kennlinien und Kennfeldern beschrieben.
An einem Motorleistungsprüfstand werden hierzu das Drehmoment MM,eff , die Motordrehzahl nM, die Abgastemperatur TA , die Abgasbestandteile und der zeitbezogene Kraftstoffverbrauch Bh gemessen, aus denen anschließend die effektive Leistung PM,eff, der effektive Mitteldruck pe sowie der effektive spezifische Kraftstoffverbrauch be errechnet wird [20].
Eine Motorkennlinie ist das graphische Darstellen einer gemessenen bzw. errechneten Kenngröße in Abhängigkeit von der Motordrehzahl nM bzw. dem effektiven Mitteldruck pe.
Ein Kennfeld ist das graphische Darstellen von mindestens einer dritten Größe im Diagramm einer Kennlinie. Die dritte und ggf. die weiteren Größen werden hierbei in Abhängigkeit der beiden Größen der Abszisse und Ordinate derart dargestellt, dass zugehörige Isolinien entstehen.
Die folgende Tabelle 2.2.1 fasst die in der Motorentechnik üblichen Kennlinien und Kennfelder zusammen, von denen im Folgenden nur die hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs relevanten betrachtet werden, die in der Tabelle farblich hervorgehoben sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2.2.1.: Übliche Darstellungsarten des Motor - Betriebsverhaltens [17, 20]
2.2.1 Einfluss der Motordrehzahl und der Motorlast auf die Wirkungsgrade
Im folgenden Bild 2.2.1.1 sind die Verläufe der Wirkungsgrade bei Volllast in Abhängigkeit der Motordrehzahl dargestellt. Die Diagramme in Bild 2.2.1.2 zeigen die Wirkungsgradverläufe (Otto- und Dieselmotor) bei Laständerung, mit der stets eine Änderung des effektiven Mitteldrucks pe verbunden ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 2.2.1.1.: Volllast - Wirkungsgrade bei Drehzahländerung, aus [17]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 2.2.1.2.: Wirkungsgrade bei Laständerung (links Ottomotor, rechts Dieselmotor), aus [17]
Aus den erkennbaren Einflüssen der Motordrehzahl (Bild 2.2.1.1) sowie der Motorlast (Bild 2.2.1.2) und dem Zusammenhang aus Gl. 2.10 kann ein entsprechender Einfluss dieser Betriebsparameter auf den spezifischen Kraftstoffverbrauch gefolgert werden.
2.2.2 Einfluss der Motorlast auf den spezifischen Kraftstoffverbrauch
Das Verhalten des spezifischen Kraftstoffverbrauchs eines Diesel- und eines Ottomotors bei Variation der Motorlast bzw. des effektiven Mitteldrucks pe bei konstanter Drehzahl nM ist im folgenden Bild 2.2.2.1 qualitativ dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 2.2.2.1.: Qualitativer Verlauf des spezifischen Kraftstoffverbrauchs in Abhängigkeit vom effektiven Mitteldruck bei konstanter Drehzahl (Otto- und Dieselmotor), aus [20]
Bemerkbar beim Verlauf be(pe) ist in beiden Fällen (Otto und Diesel) ein vorhandenes Minimum, so dass sich die Verläufe in jeweils zwei Bereiche aufteilen lassen.
Links vom be(pe) - Minimum nimmt der Gesamtwirkungsgrad mit fallendem Mitteldruck ab und damit verbunden der spezifische Kraftstoffverbrauch zu, da der Gütegrad sowie der mechanische Wirkungsgrad durch die geringer werdende Motorlast abnehmen. Aufgrund der Tatsache, dass beim Ottomotor hinzukommende Drosselverluste und damit erhöhte Ladungswechselarbeiten entstehen, fällt der Gütegrad stärker ab als beim Dieselmotor. Beim Dieselmotor erhöht sich außerdem unterstützend der Wirkungsgrad des vollkommenen Motors wegen des größer werdenden Luftverhältnisses [20], woraus insgesamt der deutliche größere Gradient des Ottomotors in diesem Bereich (links vom Optimum) im Vergleich zum Dieselmotor resultiert.
[...]
- Quote paper
- David Gaczek (Author), 2006, Entwurf und Regelung eines Verbrauchsassistenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/139650