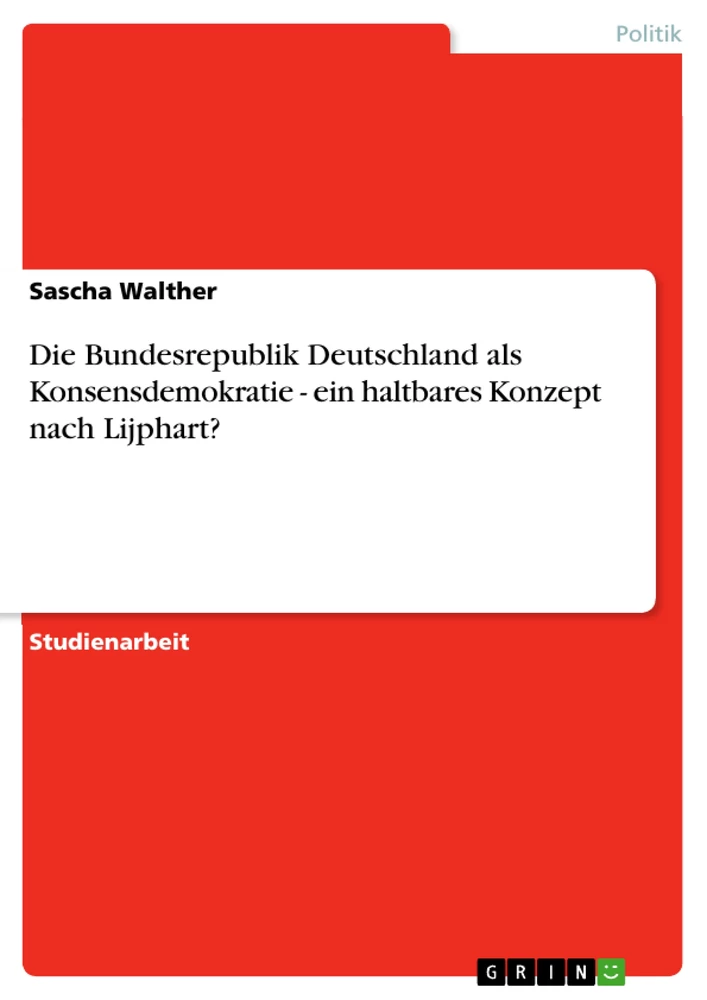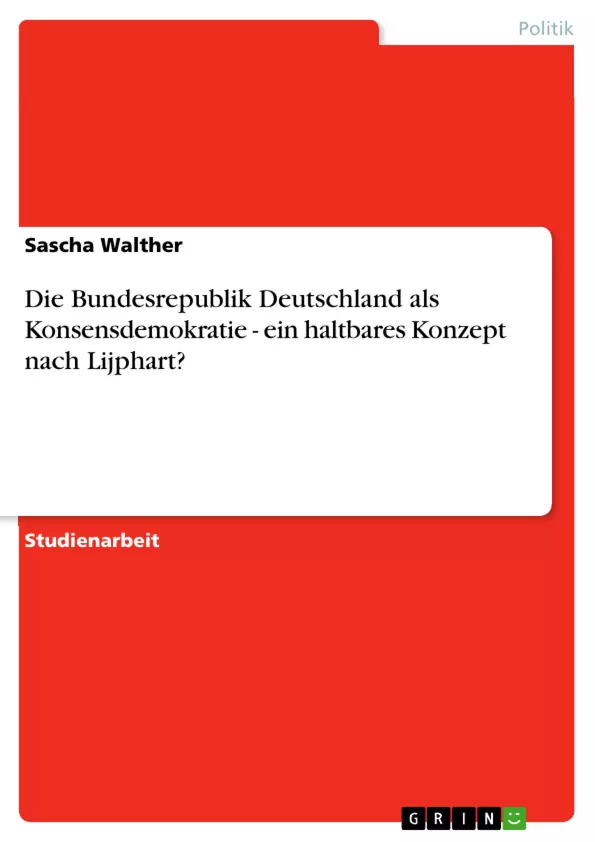Die begriffliche Prägung der Demokratie durch Abraham Lincoln als „government of the people, by the people, for the people“1 besitzt in der Gegenwart wie bereits während des amerikanischen Bürgerkrieges 1861 ihre volle Gültigkeit. Mit Ende des Kalten Krieges, so scheint es, hat sich die Herrschaft der Mehrheit gegenüber anderen Herrschaftsformen als klar überlegen erwiesen. Wenn selbst Diktaturen ihren angeblich demokratischen Nimbus hervorkehren, dann scheint sich der althergebrachte Konflikt zwischen konkurrierenden Legitimitätsideen heute eher um eine Auseinandersetzung um den einzig legitimen Demokratiebegriff zu drehen.2
In diesem Kontext zeigt sich eine breite Vielfalt an Demokratietypologien. Idealtypische Formen der Volksherrschaft bewegen sich zwischen Gesellschaftskonzeptionen (identitäre vs. pluralistische Demokratie), Partizipationsmöglichkeiten der Bürger (plebiszitäre vs. repräsentative Demokratie), relativer Stärke und Häufigkeit der Partizipation (starke vs. schwache Demokratie) und nach Entscheidungsmustern (Mehrheits- vs. Konsensusdemokratie).3
Eine besondere Bedeutung kommt der letztgenannten Variante zu, in welcher eine Einordnung der Demokratien nach der Art ihrer Konfliktregelung vorgenommen wird. Im Mittelpunkt dieser neoinstitutionalistischen Betrachtung steht die Frage, ob die Durchsetzung des Mehrheitswillens in einem demokratisch verfassten System durch institutionelle Entscheidungsstrukturen gehemmt oder gefördert wird.4
Als Pionier und herausragender Vertreter des Neo-Institutionalismus zählt der Holländer Arend Lijphart. Zu seinen überragenden Leistungen gehört der anspruchsvolle Versuch, die Demokratiestruktur westlicher Gesellschaften zu vergleichen und zu typologisieren. Das Ergebnis seiner einflussreichen Studien ist die Differenzierung von 36 stabilen und verfassungsstaatlichen Demokratien in zwei idealtypische Demokratietypen: die Mehrheits- und Konsensusdemokratie. Während in einer Mehrheits- bzw. Westminsterdemokratie politische Entscheidungen über das Mehrheitsprinzip erfolgen, setzt im Gegensatz dazu die Konsensusdemokratie auf Verhandlung, Kompromiss und Inklusion aller soziopolitischen Kräfte in den politischen Willensbildungsprozess. Zweifelsohne wird Lijpharts Studie in der Wissenschaft hoch gelobt. Eine Theorie, die versucht Tatbestände zu erklären und Erkenntnisse zu liefern, muss sich aber ebenso einer kritischen Auseinandersetzung öffnen.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konsensusdemokratie nach Lijpharts „Patterns of Democracy“
- Kritik von Lane/Ersson an Lijpharts Konsensusdemokratie
- Die Bundesrepublik als Konsensusdemokratie nach Lijphart
- Einordnung der Bundesrepublik in Lijpharts Demokratietypologie
- Widerlegung der Kritik von Lane/Ersson am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland
- Vielparteienregierungen und Mehrparteiensystem
- Verhältniswahlrecht
- Föderaler Staatsaufbau und zweite Kammer
- Geschriebene Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit
- Fazit: Bestätigung der Bundesrepublik als Konsensusdemokratie nach Lijphart
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Eignung des lijphartschen Konzepts der Konsensusdemokratie zur Beschreibung der Bundesrepublik Deutschland. Dabei werden die Kritikpunkte von Lane/Ersson an Lijpharts Typologie aufgegriffen und am Beispiel Deutschlands widerlegt.
- Die Merkmale der Konsensusdemokratie nach Lijphart
- Kritik an Lijpharts Typologie von Lane/Ersson
- Die Eignung des Konsensusdemokratie-Konzepts für Deutschland
- Widerlegung der Kritik von Lane/Ersson anhand deutscher Beispiele
- Bewertung der Bundesrepublik Deutschland als Konsensusdemokratie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit legt den Fokus auf die Konsensusdemokratie und die Kritik von Lane/Ersson an Lijpharts Typologie, die anhand der Bundesrepublik Deutschland untersucht werden soll.
- Konsensusdemokratie nach Lijpharts „Patterns of Democracy“: Dieses Kapitel stellt die Merkmale der Konsensusdemokratie nach Lijphart vor und beschreibt sein Konzept zur Einordnung von Demokratien.
- Kritik von Lane/Ersson an Lijpharts Konsensusdemokratie: In diesem Kapitel wird die Kritik von Lane/Ersson an Lijpharts Typologie dargelegt, die die Existenz von reinen Mehrheits- oder Konsensusdemokratien in Frage stellt.
- Die Bundesrepublik als Konsensusdemokratie nach Lijphart: Dieses Kapitel beleuchtet die Einordnung der Bundesrepublik in Lijpharts Demokratietypologie und widerlegt die Kritik von Lane/Ersson anhand deutscher Beispiele.
Schlüsselwörter
Konsensusdemokratie, Mehrheitsdemokratie, Lijphart, Lane/Ersson, Bundesrepublik Deutschland, Demokratie, Institution, politische Struktur, Konfliktregelung, Verhandlung, Kompromiss, Inklusion.
- Arbeit zitieren
- Sascha Walther (Autor:in), 2003, Die Bundesrepublik Deutschland als Konsensdemokratie - ein haltbares Konzept nach Lijphart?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/13944