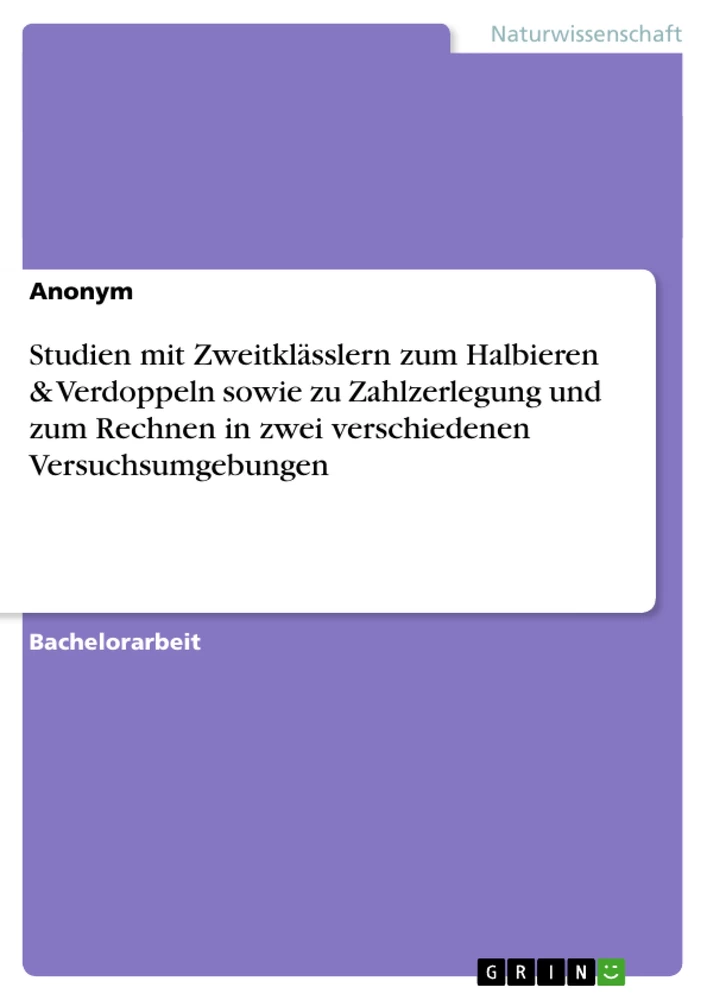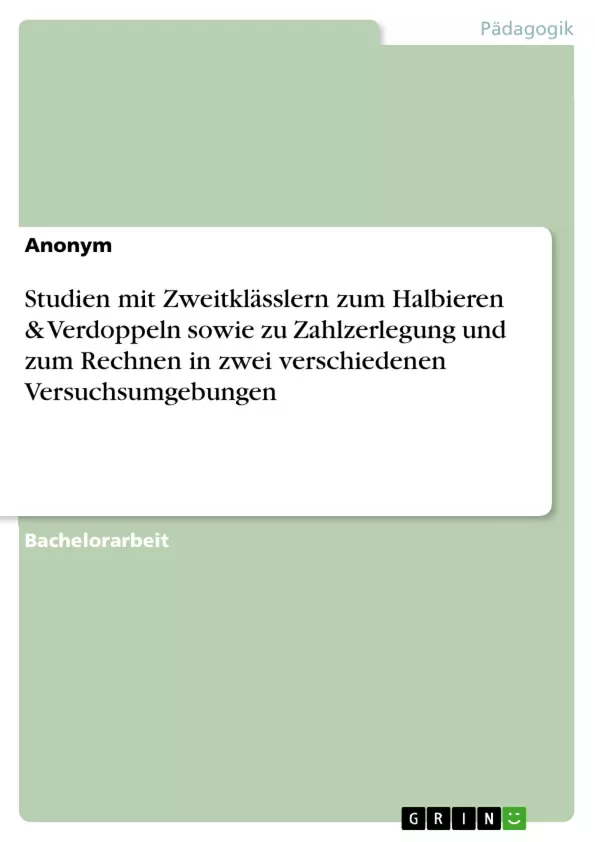Immer häufiger werden Aussagen dieser Art gemacht und es wird immer mehr von
Rechenschwäche, Rechenstörung oder auch Dyskalkulie gesprochen. Mit der Literatur zu
diesen Themen muss sehr behutsam umgegangen werden. Es gibt viele unseriöse Artikel, die
im Internet oder anderen Medien veröffentlicht werden. Immer wieder wird von „Ursachen“
für Rechenstörung gesprochen. Mit dem Begriff „Ursachen“ sollte man jedoch vorsichtig
umgehen und besonders mit den teilweise abstrusen „Ursachen“. Wenn auf einer zuerst seriös
erscheinenden Internetseite steht, dass eine Rechenstörung von Geburt an vorherbestimmt ist,
müssen wir uns über Aussagen, wie sie die oben zitierte Schülerin macht, nicht wundern. Eine
Vielzahl von Beiträgen zeugt davon, dass die Gesellschaft ein allgemeines Interesse an dem
Thema hat. Die häufig falsche Aufklärung und Beratung vermittelt größtenteils das Bild einer
„Krankheit“, wie bei der oben zitierten Schülerin. Es gibt viele unerforschte Bereiche auf
diesem Gebiet, die mit Sicherheit nicht aufgeklärt werden können. Jedoch ist die Forschung
bereits soweit fortgeschritten, dass Kinder in der Grundschule mit Hilfe von Testverfahren auf
Rechenstörung untersucht werden können. Die Förderung kann somit frühzeitig beginnen.
Hierzu gibt es verschiedene Arten und Formen von Tests. Einer dieser Tests wurde an der
Universität Bielefeld entwickelt: Der Bielefelder Rechentest „BIRTE“. Mit BIRTE sollen
Kinder mit Rechenstörungen frühzeitig erkannt werden, um eine entsprechende Förderung zu
erhalten. BIRTE beinhaltet verschiedene Module zu unterschiedlichen Aufgabentypen, die für
Schüler 1 Mitte des zweiten Schuljahres zu lösen seien sollten. Es handelt sich dabei um
produkt- und prozessorientierte Aufgaben. Im Unterschied zu anderen Testverfahren ermittelt
BIRTE keine leistungsstarken Schüler, sondern gibt nur Aufschluss darüber, welche Kinder
rechenschwach sein könnten. Zurzeit wird der Mathetest BIRTE evaluiert. Der Test, der von
Fachpersonal persönlich an der Universität Bielefeld (Erstüberprüfung) durchgeführt wird,
soll in der Zukunft am Computer erfolgen. Dabei sind die Aufgaben sehr ähnlich. BIRTE soll
sehr viel von der erfolgreichen prozessorientierte Erstüberprüfung übernehmen. Der
Unterschied besteht darin, dass die Kinder vor einem Computer sitzen und die Arbeitsaufträge
per Computerstimme übermittelt bekommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kompetenzen von Kindern im zweiten Schuljahr
- 2.1 Kompetenzen zum Halbieren und Verdoppeln
- 2.2 Kompetenzen zu Zahlzerlegungen
- 2.3 Kompetenzen zu Rechenstrategien
- 3. Diagnostische Möglichkeiten beim Verdacht auf Rechenstörung
- 3.1 Begriffsklärung
- 3.2 Typen diagnostischer Verfahren
- 3.2.1 Etikettierungstest am Beispiel des Zareki
- 3.2.2 Klassifizierungstest am Beispiel von OTZ und DEMAT
- 3.2.3 Prozessorientierte Diagnostik am Beispiel der Erstüberprüfung
- 3.2.4 Der Bielefelder Rechentest (BIRTE)
- 3.3 Diagnostik der Kompetenzen „Halbieren und Verdoppeln“, „Zahlzerlegungen“ und „Rechenstrategien“
- 3.3.1 Diagnose der Kompetenz „Halbieren und Verdoppeln“
- 3.3.2 Diagnose der Kompetenz „Zahlzerlegungen“
- 3.3.3 Diagnose der Kompetenz „Rechenstrategien“
- 4. Fragen und Design der Studie
- 4.1 Forschungsfrage
- 4.2 Forschungsdesign
- 5. Darstellung der Befunde
- 5.1 Vergleich der Ergebnisse
- 5.1.1 Vergleich der gesamten Testergebnisse von BIRTE und Erstüberprüfung
- 5.1.2 Vergleich der Testergebnisse von BIRTE und Erstüberprüfung beim Halbieren und Verdoppeln
- 5.1.3 Vergleich der Testergebnisse von BIRTE und Erstüberprüfung bei den Zahlzerlegungen
- 5.1.4 Vergleich der Testergebnisse von BIRTE und Erstüberprüfung bei den Rechenstrategien
- 5.2 Fallanalysen
- 5.2.1 Max beim Halbieren und Verdoppeln
- 5.2.2 Lea bei den Zahlzerlegungen
- 5.2.3 Tabea bei den Rechenstrategien
- 5.3 Ergebniszusammenfassung
- 6. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Kompetenzen von Zweitklässlern in den Bereichen Halbieren & Verdoppeln, Zahlzerlegung und Rechenstrategien. Sie vergleicht die Ergebnisse zweier Testverfahren: den Bielefelder Rechentest (BIRTE) und eine prozessorientierte Erstüberprüfung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Übereinstimmung der Ergebnisse beider Verfahren zu analysieren und die Eignung des computergestützten BIRTE als Diagnostikinstrument zu evaluieren.
- Vergleich der Ergebnisse von BIRTE und einer prozessorientierten Erstüberprüfung bei Zweitklässlern.
- Analyse der Kompetenzen von Zweitklässlern in den Bereichen Halbieren & Verdoppeln, Zahlzerlegung und Rechenstrategien.
- Evaluierung des computergestützten BIRTE als Diagnostikinstrument für Rechenstörungen.
- Untersuchung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Testverfahren.
- Beschreibung der Anwendung der Testverfahren in der Praxis.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Rechenstörungen bei Kindern ein und erläutert die Notwendigkeit frühzeitiger Diagnose und Förderung. Sie stellt den Bielefelder Rechentest (BIRTE) vor, ein computergestütztes Testverfahren zur Erkennung von Rechenstörungen, und beschreibt den Forschungsansatz der vorliegenden Bachelorarbeit, der den Vergleich von BIRTE mit einer persönlichen Erstüberprüfung zum Ziel hat.
2. Kompetenzen von Kindern im zweiten Schuljahr: Dieses Kapitel beschreibt die mathematischen Kompetenzen von Kindern im zweiten Schuljahr in den Bereichen Halbieren und Verdoppeln, Zahlzerlegungen und Rechenstrategien. Es legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Auswertung der Testergebnisse.
3. Diagnostische Möglichkeiten beim Verdacht auf Rechenstörung: Kapitel 3 befasst sich mit der Definition von Rechenschwäche, Rechenstörung und Dyskalkulie. Es erläutert verschiedene Typen diagnostischer Verfahren, wie Etikettierungstests, Klassifizierungstests und prozessorientierte Diagnostik, und beschreibt detailliert den Bielefelder Rechentest (BIRTE) im Vergleich zu anderen Tests wie DEMAT, OTZ und der Erstüberprüfung. Der Fokus liegt auf der Diagnostik der im vorherigen Kapitel beschriebenen Kompetenzen.
4. Fragen und Design der Studie: Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign und die Forschungsfrage der Studie. Es erläutert die Methodik, die in der Untersuchung eingesetzt wurde. Die Auswahl der Teilnehmer und die Durchführung der Tests werden hier detailliert dargelegt.
5. Darstellung der Befunde: Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es werden die Ergebnisse beider Testverfahren (BIRTE und Erstüberprüfung) verglichen und detailliert analysiert. Fallstudien illustrieren die Ergebnisse. Die Zusammenfassung der Ergebnisse im letzten Abschnitt des Kapitels bereitet den Weg für die Schlussfolgerungen der Arbeit.
Schlüsselwörter
Rechenstörung, Dyskalkulie, Rechenschwäche, Diagnostik, Bielefelder Rechentest (BIRTE), Erstüberprüfung, Halbieren, Verdoppeln, Zahlzerlegung, Rechenstrategien, Zweitklässler, empirische Studie, prozessorientierte Diagnostik, computergestützte Diagnostik.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Diagnostik von Rechenkompetenzen bei Zweitklässlern
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Rechenkompetenzen von Zweitklässlern in den Bereichen Halbieren und Verdoppeln, Zahlzerlegung und Rechenstrategien. Im Mittelpunkt steht der Vergleich der Ergebnisse zweier Testverfahren: des Bielefelder Rechentests (BIRTE) und einer prozessorientierten Erstüberprüfung.
Welche Testverfahren werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den computergestützten Bielefelder Rechentest (BIRTE) mit einer prozessorientierten Erstüberprüfung. Der Vergleich soll die Übereinstimmung der Ergebnisse beider Verfahren analysieren und die Eignung des BIRTE als Diagnostikinstrument evaluieren.
Welche Kompetenzen werden bei den Zweitklässlern untersucht?
Die Arbeit untersucht die Kompetenzen der Zweitklässler in den Bereichen Halbieren und Verdoppeln, Zahlzerlegung und Rechenstrategien. Diese Bereiche bilden wichtige Grundlagen für das mathematische Verständnis und die Rechenfähigkeit.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Übereinstimmung der Ergebnisse von BIRTE und der Erstüberprüfung. Es wird analysiert, wie gut beide Verfahren die Kompetenzen der Kinder in den genannten Bereichen erfassen und ob der BIRTE als geeignetes Diagnostikinstrument für Rechenstörungen bei Zweitklässlern geeignet ist.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Kompetenzen von Zweitklässlern, Diagnostische Möglichkeiten, Forschungsdesign, Darstellung der Befunde und Schlussbemerkung. Die Kapitel beschreiben den theoretischen Hintergrund, die Methodik, die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen der Studie.
Welche diagnostischen Verfahren werden neben BIRTE und der Erstüberprüfung genannt?
Neben BIRTE und der Erstüberprüfung werden weitere diagnostische Verfahren erwähnt, darunter Etikettierungstests (am Beispiel des Zareki), Klassifizierungstests (am Beispiel von OTZ und DEMAT) und prozessorientierte Diagnostik. Diese dienen der Einordnung und Veranschaulichung verschiedener diagnostischer Ansätze.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert einen Vergleich der Ergebnisse von BIRTE und der Erstüberprüfung. Es werden sowohl die Gesamt- als auch die Teilergebnisse in den Bereichen Halbieren und Verdoppeln, Zahlzerlegungen und Rechenstrategien verglichen. Zusätzlich werden Fallanalysen einzelner Schüler vorgestellt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung der Arbeit bewertet die Eignung des BIRTE im Vergleich zur Erstüberprüfung und gibt Aufschluss über Stärken und Schwächen beider Verfahren bei der Diagnostik von Rechenkompetenzen bei Zweitklässlern. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis der Diagnostik von Rechenstörungen bei.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrkräfte, Schulpsychologen, Sonderpädagogen und alle, die sich mit der Diagnostik und Förderung von Rechenstörungen bei Kindern im Grundschulalter befassen. Sie bietet Einblicke in verschiedene Testverfahren und deren Anwendung in der Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Rechenstörung, Dyskalkulie, Rechenschwäche, Diagnostik, Bielefelder Rechentest (BIRTE), Erstüberprüfung, Halbieren, Verdoppeln, Zahlzerlegung, Rechenstrategien, Zweitklässler, empirische Studie, prozessorientierte Diagnostik, computergestützte Diagnostik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2008, Studien mit Zweitklässlern zum Halbieren & Verdoppeln sowie zu Zahlzerlegung und zum Rechnen in zwei verschiedenen Versuchsumgebungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/139302