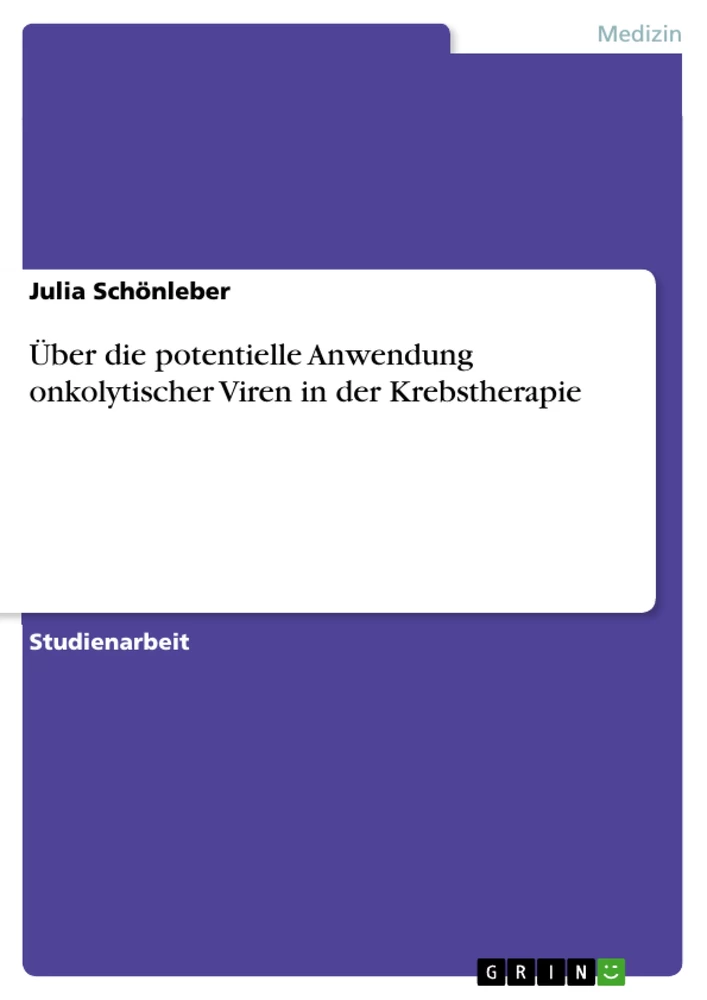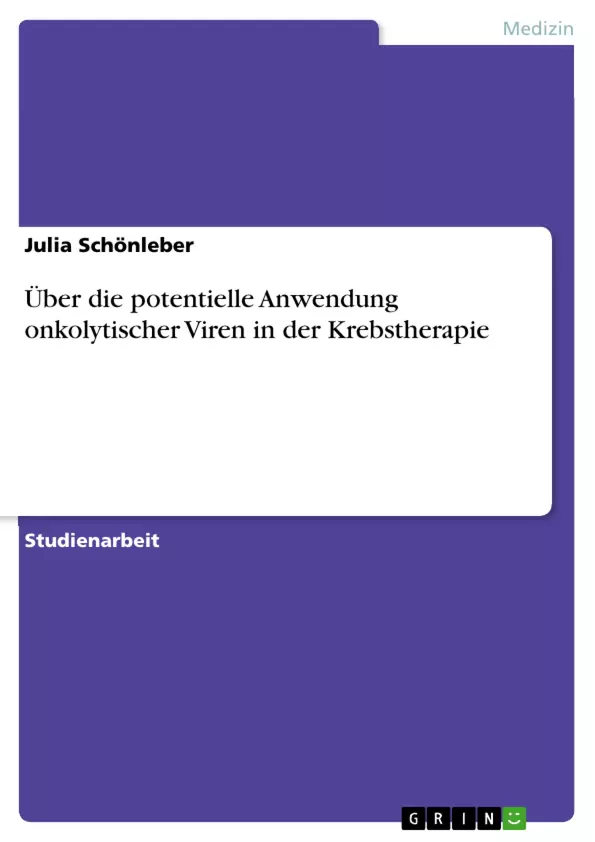Oncolytische Viren stellen eine vielversprechende, besonders innovative Form der Gentherapie dar, um Krebs zu bekämpfen. Sie replizieren sich selektiv in Tumorgewebe und zerstören es, ohne normales Gewebe anzugreifen. Diese Spezifität ist die Voraussetzung für einen möglichen Einsatz bei krebskranken Menschen und wird durch eine Reihe von Virus-verändernden Strategien erreicht, die auf modernen molekularbiologischen Methoden beruhen. Eine besondere Herausforderung stellt die möglicherweise vorbestehende Immunität von Patienten gegen onkolytische Viren dar, die jedoch durch immunevasive Strategien und der Anwendung von immunsuppressiven Medikamenten umgangen werden könnte. Durch den Einbau von bestimmten Markergenen in die viralen Vektoren kann der Weg der Viren im Organsimsus über nichtinvasive Methoden im Rahmen eines Monitoring verfolgt werden. Auf dem Weg in Klinik müssen jedoch noch wesentliche Probleme, die insbesondere die Spezifität und die Sicherheit der onkolytischen Viren betreffen, gelöst werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
l.l Geschichtlicher Hintergrund
l.2 Viren
l.2.l Aufbau und Vermehrung
l.2.2 Taxonomie
l.3 Onkolytische Viren
l.3.l Charakteristika onkolytischer Viren
l.3.2 Vertreter onkolytischer Viren
l.4 Erhöhung der Sicherheit und Effizienz onkolytischer Viren
l.4.l Erhöhung der Sicherheit
l.4.2 Erhöhung der Effizienz
l.5 Zielsetzung
2. Methodik
2.l Ein- und Ausschlusskriterien
2.2 Suchstrategie
3. Ergebnisse
3.l Suchergebnisse
3.2 Studiencharakteristika
3.3 Effizienz der Therapie
3.4 Sicherheit und Verträglichkeit der Therapie
4. Diskussion
4.l Hauptergebnisse
4.2 Stärken und Schwächen der Arbeit
4.3 Offene Fragen und zukünftige Forschungsbereiche
5. Zusammenfassung
6.Literaturverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Geschichtlicher Hintergrund
Die Idee Viren zur Krebstherapie zu nutzen ist nicht neu. Bereits l9l2 beobachtete der italienische Physiker De Pace Tumorregressionen bei Patienten nach einer Tollwutimpfung (l). Ungefähr zur selben Zeit führte eine Infektion mit Hühnerpocken zum Rückgang einer lymphatischen Leukämie bei einem vierjährigen Jungen. Innerhalb weniger Tage verkleinerten sich Milz und Leber des Jungen und seine Lymphozytenzahl fiel von 2OO/µl auf 4/µl. Unglücklicherweise war die Remission nicht stabil und der Junge verstarb (2).
Zwischen l95O und l96O wurden unterschiedlichste Studien veröffentlicht, welche sich mit der onkolytischen Potenz von u.a. Adenoviren, Newcastle-Disease-Virus und dem Herpes- Simplex-Virus bei Mensch und Tier beschäftigten. Eine große Studie des National Cancer Institutes von l956 zeigte die Wirksamkeit von Wildtyp Adenoviren unterschiedlicher Serotypen in einer Blindstudie von 3O Patienten mit Zervixkarzinom. Den Patientinnen wurden die Viren intratumoral (i.t.) oder intraarteriell (i.a.) verabreicht (l). Während es initial zu einer Tumorregression kam, zeigte sich im Folgenden jedoch eine Tumorprogression bei allen Patienten (l). Diese Ineffizienz der Virustherapie spiegelte sich auch in anderen zeitgleichen Versuchen wider und trug neben starken Nebenwirkungen dazu bei, dass die Behandlungen eingestellt und das Behandlungskonzept verworfen wurde (3). Dank der fast unbegrenzten Möglichkeiten in Bezug auf gentechnische Methoden, ist man hingegen heute in der Lage, die Effizienz onkolytischer Viren zu erhöhen.
1.2 Viren*
1.2.1 Aufbau und Vermehrung
Aufbau: Viren sind im Vergleich zu Viroiden und Virusoiden größere und komplexere pathogene Agenzien. Sie bestehen aus Nukleinsäure und Protein, besitzen aber keine zelluläre Struktur und keinen Stoffwechsel. Dementsprechend sind sie obligat parasitär und können sich nur in Wirtszellen vermehren. Neben dem intrazellulären Lebenszyklus kann ein Virus auch extrazellulär, als Virion (reifes Viruspartikel) vorliegen. Dieses besteht beim "nackten" Virion aus zwei, beim "behüllten" Virion aus drei Komponenten l. Kapsid-Protein: Es besteht aus einer Proteinstruktur, die das Genom kapselartig umgibt und selbst wiederum aus regelmäßig angeordneten Polypeptidstrukturen, den so genannten - weiterführende Informationen siehe ausführliche Lehrbücher der Mikrobiologie Kapsomeren, besteht. Das Kapsid schützt das Virus vor Degradation. Zudem ist es bei dem "nackten" Virion für den Andockvorgang an die Wirtzelle obligat und determiniert seine Antigenität. Durch die Kapsomerzusammenlagerung kann das Virion eine kubische, helicale oder komplexe Symmetrie aufweisen.
2. Nukleinsäure: Man unterscheidet zwischen DNA und RNA, die einzelsträngig (single stranded-ss-) oder doppelsträngig (double stranded-ds-), zirkulär oder linear vorliegen kann. Die meisten DNA-Viren sind doppelsträngig, die meisten RNA-Viren hingegen einsträngig. Bei den ssRNA-Viren muss zwischen einem (+) und einem (-) Strang unterschieden werden, der entweder direkt als mRNA dient (+) oder erst nach Transkription in einen Komplementärstrang (-) in Protein translatiert werden kann.
3. Hülle bei "behüllten" Viren: Die Aussenhülle, das so genannte Envelope, entspricht einer Lipidmembran und entstammt der Wirtzelle. Ihr sind viruskodierende Proteine als so genannte Spikes eingelagert. Diese dienen oft als Adhäsionsmoleküle und sind starke Antigene.
Vermehrung: Der bestimmende Interaktionsschritt eines Virus mit seinem Wirt ist die spezifische Bindung eines virusständigen Liganden an einen Wirtzellrezeptor, der in der Regel andere physiologische Aufgaben erfüllt. (Adsorption) Die so genannte Penetration, d.h. das Eindringen des Virus in das Zellinnere, kann sich durch rezeptorvermittelte Endozytose oder durch Verschmelzen mit der Plasmamembran (durch ein Fusionsprotein vermittelt) vollziehen. Die Freisetzung der Nukleinsäure findet im Zellplasma oder nukleär statt und ist in der Regel durch ein Enzym vermittelt. (Uncoating) Die Virusreplikation umfasst die virale Genexpression und - vermehrung, die je nach Genomkonfiguration des Ursprungsvirus unterschiedlich verlaufen. Die virale Proteinsynthese sowie die posttranslationalen Modifikationen werden durch die Translationsmechanismen der Wirtzelle geleistet. Diesem Schritt folgt die Virusmorphogenese, der die Ausschleusung durch Knospung (Budding), bei der die Wirtzelle in der Regel nicht zerstört wird, oder die Ausschleusung durch Zelllyse folgt.
1.2.2 Taxonomie
Viren werden nach verschiedenen Kriterien klassifiziert. Man unterscheidet u.a. nach den Folgenden
Tabelle 1 Taxonomie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an die unterschiedlichen Replikationsstrategien der Viren und ihrem Genom wurde die Baltimore-Klassifikation nach dem Nobelpreisträger David Baltimore entwickelt. Sie unterteilt die bekannten Virusarten in sieben Gruppen.
Tabelle 2 Baltimore Taxonomie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.3 Onkolytische Viren
1.3.1 Charakteristika onkolytischer Viren
Generell eignen sich fast alle Viren mit einem zytolytischen Zellzyklus in humanen Zellen als potentielle onkolytische Viren (l). Im Hinblick auf die Anwendung onkolytischer Viren zur Therapie von malignen Neubildungen im Menschen, sollten gewisse Sicherheitsaspekte beachtet werden. Die verwendeten onkolytischen Viren sollten nicht mutagen, kanzerogen oder teratogen sein. Eine geringe oder fehlende Humanpathogenität ist wünschenswert. Nach Möglichkeit sollten antivirale Medikationen etabliert sein um die Vermehrung und Ausbreitung des Virus im Notfall effizient stoppen zu können. Nicht integrative Viren sind zu präferieren. Bezüglich der onkolytischen Potenz der Viren lässt sich festhalten, dass kurze Lebenszyklen, hohe physikalische Stabilität und eine ausgeprägte interzelluläre Ausbreitung der Viren ihre onkolytischen Fähigkeiten erhöhen. Eine fehlende vorbestehende Immunität ist wünschenswert, da das Vorhandensein eines immunologischen Gedächtnis die systemische Viruselimination beschleunigt und somit weniger Viren zum Wirkort gelangen (l).
Die wichtigste Eigenschaft onkolytischer Viren ist jedoch ihre Spezifität gegenüber malignen Zellen. Nur wenn sich die Viren vorzugsweise oder ausschließlich in malignen Zellen vermehren ist die nötige Sicherheit gegeben, die vorhanden sein muss, damit sie bei der Therapie am Menschen eingesetzt werden können. An einigen Viren lässt sich beobachten, dass Krebszellen von Viren gegenüber normalen Zellen präferiert werden. Krebszellen haben während ihres Wachstums eine Entwicklung durchgemacht, die Punktmutationen und Chromosomenshifts beinhaltete und die Zellen mit Wachstumsvorteilen gegenüber normalen Zellen ausstattete. Gleichzeitig führte sie jedoch zum Verlust wichtiger Komponenten zellulärer Verteidigungsmechanismen, welche sie für viele Viren zu einem vorteilhaften Wirt machte (4). Auf diese Besonderheiten soll im Nachfolgenden näher eingegangen werden.
1.3.2 Vertreter onkolytischer Viren
Häufig gestellte Fragen
Was ist der geschichtliche Hintergrund der Nutzung von Viren zur Krebstherapie?
Die Idee, Viren zur Krebstherapie zu nutzen, ist nicht neu. Bereits 1912 beobachtete der italienische Physiker De Pace Tumorregressionen bei Patienten nach einer Tollwutimpfung. Ungefähr zur selben Zeit führte eine Infektion mit Hühnerpocken zum Rückgang einer lymphatischen Leukämie bei einem vierjährigen Jungen. Zwischen 1950 und 1960 wurden diverse Studien zur onkolytischen Potenz von Viren wie Adenoviren, Newcastle-Disease-Virus und Herpes-Simplex-Virus veröffentlicht. Eine große Studie des National Cancer Institutes von 1956 zeigte die Wirksamkeit von Wildtyp Adenoviren bei Zervixkarzinom-Patienten, obwohl es später zu Tumorprogression kam.
Wie sind Viren aufgebaut und wie vermehren sie sich?
Viren bestehen aus Nukleinsäure und Protein, aber haben keine zelluläre Struktur und keinen Stoffwechsel. Sie sind obligat parasitär und vermehren sich nur in Wirtszellen. Ein Virus kann extrazellulär als Virion vorliegen. Das Virion besteht aus Kapsid-Protein (schützt das Genom), Nukleinsäure (DNA oder RNA) und bei behüllten Viren aus einer Hülle (Lipidmembran von der Wirtzelle). Die Vermehrung umfasst Adsorption (Bindung an Wirtzellrezeptor), Penetration (Eindringen in die Zelle), Uncoating (Freisetzung der Nukleinsäure), Virusreplikation (Genexpression und -vermehrung) und Virusmorphogenese (Ausschleusung durch Knospung oder Zelllyse).
Wie werden Viren taxonomisch klassifiziert?
Viren werden nach verschiedenen Kriterien klassifiziert, darunter die Art der Nukleinsäure (DNA oder RNA), die Struktur des Kapsids, das Vorhandensein einer Hülle und die Replikationsstrategie. Die Baltimore-Klassifikation unterteilt die bekannten Virusarten in sieben Gruppen basierend auf ihren unterschiedlichen Replikationsstrategien und ihrem Genom.
Was sind onkolytische Viren und welche Eigenschaften sollten sie aufweisen?
Onkolytische Viren sind Viren, die Krebszellen infizieren und zerstören. Sie sollten nicht mutagen, kanzerogen oder teratogen sein, eine geringe oder fehlende Humanpathogenität aufweisen und idealerweise mit antiviralen Medikamenten behandelbar sein. Wünschenswert sind kurze Lebenszyklen, hohe physikalische Stabilität, ausgeprägte interzelluläre Ausbreitung und fehlende vorbestehende Immunität. Ihre wichtigste Eigenschaft ist die Spezifität gegenüber malignen Zellen.
Welche Viren sind Beispiele für onkolytische Viren?
Reovirus, Vesicular-Stomatitis-Virus (VSV) und das Newcastle-Disease-Virus (NDV) sind Viren mit einer natürlichen onkolytischen Potenz. Adenoviren und das Humane-Herpes-Simplex-Virus (HSV-1) können nach gentechnischen Modifikationen zur Onkolyse eingesetzt werden. Weitere sind das Masernvirus und das Vaccinia Virus.
Welche Ein- und Ausschlusskriterien wurden für die Methodik verwendet?
Die Ein- und Ausschlusskriterien sowie die Suchstrategie der Methodik werden in Kapitel 2 aufgeführt. Die genauen Details sind im Originaltext zu finden.
Wo finde ich die Suchergebnisse und Studiencharakteristika?
Die Suchergebnisse und Studiencharakteristika sind in Kapitel 3, Abschnitt 3.1 und 3.2 zu finden. Die Details sind im Originaltext aufgeführt.
Wo finde ich Angaben zur Effizienz, Sicherheit und Verträglichkeit der Therapie?
Angaben zur Effizienz, Sicherheit und Verträglichkeit der Therapie sind in Kapitel 3, Abschnitt 3.3 und 3.4 zu finden. Die Details sind im Originaltext aufgeführt.
Was sind die Hauptergebnisse und was sind die Stärken und Schwächen der Arbeit?
Die Hauptergebnisse und die Stärken und Schwächen der Arbeit werden in Kapitel 4, Abschnitt 4.1 und 4.2 diskutiert. Die Details sind im Originaltext aufgeführt.
Welche offenen Fragen gibt es und welche zukünftigen Forschungsbereiche werden genannt?
Offene Fragen und zukünftige Forschungsbereiche werden in Kapitel 4, Abschnitt 4.3 angesprochen. Die Details sind im Originaltext aufgeführt.
- Quote paper
- Julia Schönleber (Author), 2007, Über die potentielle Anwendung onkolytischer Viren in der Krebstherapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/139004