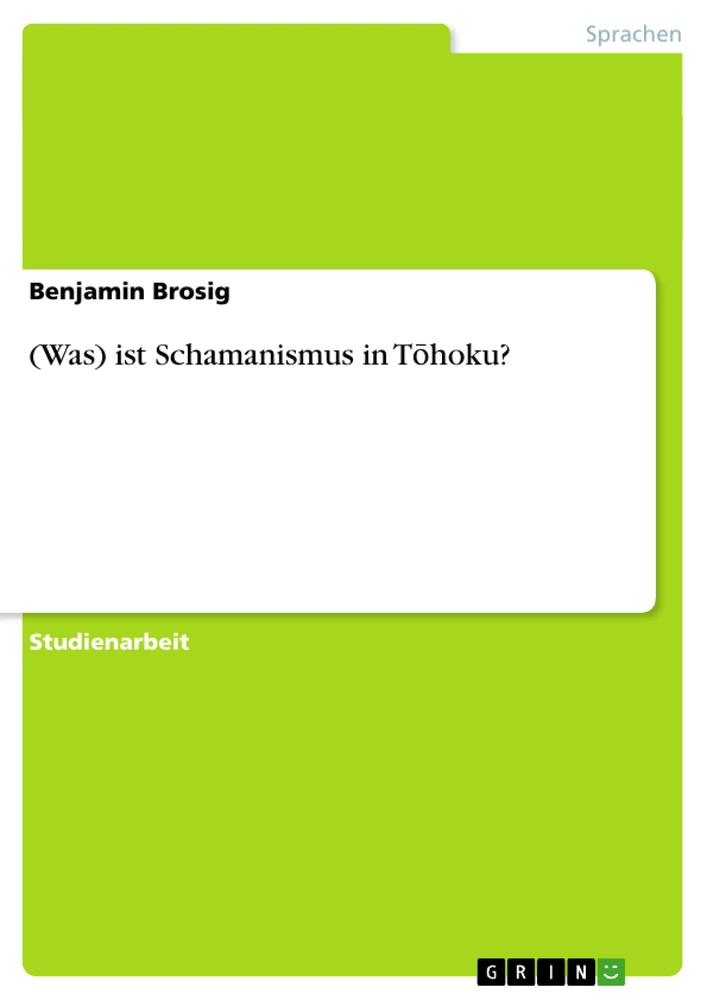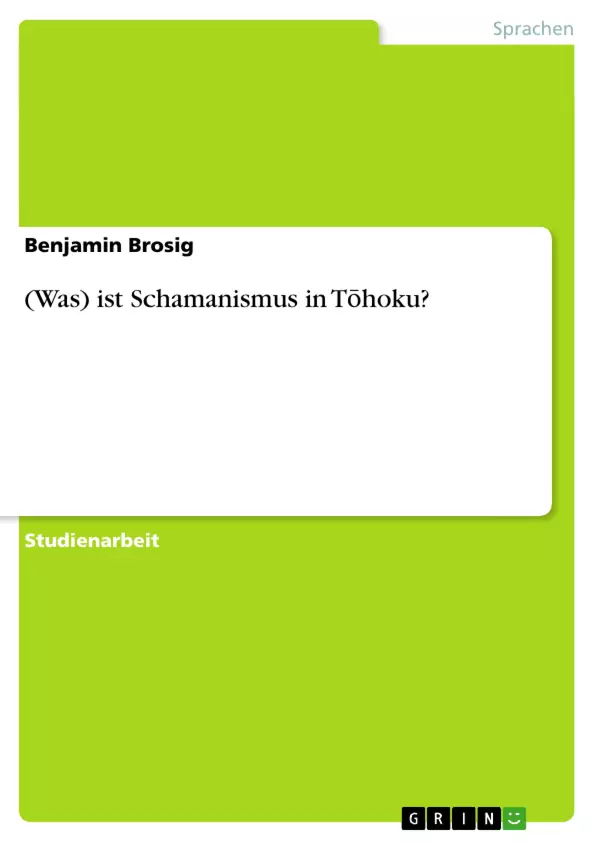Die Arbeit ist eine kurze Darstellung einiger Forschungsarbeiten zu itako, kamisama und miko in Nordjapan. Es wird die Frage gestellt und im Wesentlichen verneinend beantwortet, ob diese magisch-religiösen Praktikerinnen unter dem Begriff "Schamanismus" (in einem soziologisch-typologischen Sinne) eingeordnet werden sollten oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Schamanismus und Trance
2.1 itako und kamisama
2.2 miko und simpang
2.3 itako auf osorezan
3. Schamanismuskonzeptualisierung in die japanische Geschichte xxxxxxxxxx
4. Die Kategorie „Schamanismus“
5. Schlusswort
6. Anhang: Kanjiliste
7. Literaturverzeichnis
1. Vorwort
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der Konzeptionalisierung von „Schamanismus“ in Religionsstudien mit Tōhokubezug eine Position zu dem Problem zu erreichen, inwiefern und ob der Begriff „Schamanismus“ von einer funktionalisierbar erscheinenden ethnologischen Methodologie aus betrachtet auf die Verhältnisse in Tōhoku sinnvoll angewendet werden kann. Eine Operationalisierung dieses Begriffs für die japanische Gesellschaft müsste also zumindest gewährleisten, dass er sowohl einer interkulturellen wissenschaftlichen Vergleichbarmachung als auch der Wirklichkeit entspricht und drittens zu den Wahrnehmungen der lokalen Bevölkerung in einer Korrelation steht, sodass neben einer rein faktischen auch die gesellschaftliche Realität greifbar gemacht werden kann. Um dies zu überprüfen, werden zuerst von einer allgemein üblichen Schamanismusdefinition ausgehend drei Gruppen von potentiellen Schamaninnen in Tōhoku hinsichtlich Vorliegen und Anwendbarkeit der Kriterien dieser Definition betrachtet. Danach erfolgt ein Blick in die japanische Vergangenheit, schließlich eine kurze Besprechung von alternativen Ansätzen für ein Verständnis von Schamanismus und schließlich eine tentative Reklassifizierung der drei Gruppen.
2. Schamanismus und Trance
Zuerst soll hier die Konzeption von Schamanismus in der traditionellen Ethnologie betrachtet werden (Systematisierung der Positionen nach Kim 1993: 27-38):
Rituelle Ekstase, Schamaneninitiation, Berufung (durch nicht tierförmige Geister), Hilfsgeister in Tierform, Kosmologie, Schamanenkampf, Schamanenausrüstung (nach L. Vajra)
Schamanenekstase, Verbindung mit dem Jenseits [oder weniger christlich: einer konkreten, durch verschiedene Kausalitäten mit unserer Welt verbundenen Anderen Welt], Formgebundenheit, Gesellschaftsbezogenheit oder eine altruistisch-soziale Zielsetzung (nach D. Schröder)
Der Begriff „Formgebundenheit“ bezieht sich hier auf die Ritualisierung der Handlungen des Schamanen bzw. auf das Muster, was ihnen trotz spezifischer Ausgestaltung im Einzelfall gemein ist. Von ersterer Konzeption ausgehend ergibt sich ein eng definiertes, regionales Phänomen ohne den Anspruch auf zulässige Generalisierungen z.B. über Sibirien, die Umgebung des Nordpols und Nordamerika (Kehoe 2000: 47-56) hinaus. Dieses Phänomen wäre dann auch historisch auf eine Zeitphase beschränkt und nicht a priori in allen Gesellschaften eines bestimmten Entwicklungsstandes vorhanden. Während zweitere Definition das Gegenteil zwar nicht explizit äußert, wird es doch von ihren Vertretern angenommen: Schamanismus als ein historisch realisiertes, aber per se ahistorisches Phänomen. Es wird auch noch von Relevanz sein, dass die zweite Definition durch „Verbindung mit dem Jenseits“ über die erste hinausgeht; in allen weitergehenden Definitionen (z.B. Eliade 1956, Hultkrantz 1999) findet sich hierüber Konsens mit der Ekstase als Mittel. Man beachte, dass eine solche Sicht jemanden wie unwahrscheinlichen wie Meister Eckart zum potenziellen Schamanen macht, der Begriff also vorm Mystiker (vgl. Passie 2005), vorm Priester, vorm Medium nicht Halt macht, auch insofern ein Lehrgebäude nicht per se ausgeschlossen wird. Selbst bei einer Betrachtungsweise, die eher von einem Prototyp als von extensiven Merkmalen ausgeht, lässt sich am Ende doch bei Ergebnissen ankommen, die überraschend wirken dürften. Hierzu soll eine Konzipierung von koreanischem Schamanismus betrachtet werden:
Nach einer Schamanenkrankheit, die durch die in der Besitzergreifung begriffene Gottheit verursacht wird, findet die Besessene irgendwann über ihren tatsächlichen Zustand heraus, lernt von anderen Schamanen und wird initiiert. Zeremonien dienen dem Schutz von Familie und Dorf, der Verhinderung zukünftigen Unheils, der guten Ernte, zur Heilung von Krankheiten und Vertreibung böser Geister sowie der Geleitung von toten Seelen an die ihnen zukommenden Orte (Han 1991: 60-69). Die Zahl der Gottheiten wird als ziemlich groß, z.B. über 18.000, jedenfalls aber innerhalb einer offenen Klasse angesehen. Die Gottheiten leben an ihren Wirkungsplätzen und müssen um ihres Wohlwollens willen gut behandelt werden. Sie treten in übermenschlicher, menschlicher, tierischer und natürlicher Form auf; Ahnengötter sind auch vertreten (Choi 2005: 11-14). Früher gab es für ihre Verehrung eigene Tempel, deren Bestehen im Laufe der jüngeren Geschichte allerdings weitgehend unmöglich gemacht worden ist. Nach einer Reinigungszeremonie werden in einzelnen Teilen eines großen Rituals, das von einer leitenden Schamanin unter Assistenz anderer Schamaninnen und musikalischer Begleitung von zumindest einer von diesen vollzogen wird, verschiedene Götter herbeigerufen und um ihren jeweiligen Beistand gebeten, wobei sie auch kodierte Aussagen über die Realität verlauten lassen. Den eingeladenen Göttern werden Speisen dargereicht. Die Ziele des Kults liegen im Diesseits, eine distinktive positive Ethik oder Lehre geht mit ihnen kaum einher (Han 1991: 70-71, 84-85).
Es fällt nicht schwer, von hier aus Parallelen zum Shintō zu ziehen. Die amoralische Konzeption der Realität, die Gottesvorstellungen und große Teile der Zielsetzungen von Ritualen gleichen sich. Die Auswahl der Priester und die Art der Zeremonie unterscheiden sich, obwohl das Reinigungselement auch im Shintō auftritt. Fiele also die Besessenheit als definitorisches Kriterium, so müsste man nach der obigen breiteren Definition davon ausgehen, dass sich zwischen Shintō und Schamanismus außer der Auswahl der Priester kein fundamentaler Unterschied finden ließe. Dieser zweite Unterschied gehört aber nicht zur definitorischen Abgrenzung von Schamanismus, insofern in erbliches und nicht erbliches Schamanentum (z.B. Eliade 1956: 24-33) unterschieden werden kann, was auch auf Japan angewandt worden ist (in Harada 1975: 48).
2.1 itako und kamisama
Nun ist aber Ekstase als definitorisches Kriterium für Schamanismus in einigen Forschungsaufsätzen infrage gestellt worden. Kawamura (2003) unterscheidet in einer Studie über Schamaninnen in Tōhoku itako ≈ ogamisama ≈ waka einerseits und kamisama andererseits:
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Arbeit über Schamanismus in Tōhoku?
Das Ziel ist es, anhand der Konzeptionalisierung von „Schamanismus“ in Religionsstudien mit Tōhokubezug eine Position zu dem Problem zu erreichen, inwiefern der Begriff „Schamanismus“ auf die Verhältnisse in Tōhoku sinnvoll angewendet werden kann. Die Arbeit untersucht, ob eine Operationalisierung dieses Begriffs für die japanische Gesellschaft sowohl einer interkulturellen Vergleichbarmachung als auch der Wirklichkeit entspricht und drittens zu den Wahrnehmungen der lokalen Bevölkerung in einer Korrelation steht.
Welche Definitionen von Schamanismus werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet traditionelle ethnologische Konzeptionen von Schamanismus, systematisiert nach Kim (1993), die rituelle Ekstase, Schamaneninitiation, Hilfsgeister, Kosmologie, Schamanenkampf und Schamanenausrüstung beinhalten. Weiterhin wird eine Definition nach D. Schröder betrachtet, die Schamanenekstase, Verbindung mit dem Jenseits, Formgebundenheit und Gesellschaftsbezogenheit/altruistisch-soziale Zielsetzung umfasst.
Welche Gruppen von potentiellen Schamaninnen werden in Tōhoku untersucht?
Drei Gruppen werden betrachtet: itako, ogamisama und waka, sowie kamisama.
Was sind itako?
Itako sind eine im Verschwinden begriffene Gruppe von oft blinden oder sehbehinderten Frauen, die von ihren Eltern in jungen Jahren zur Ausbildung einer anderen itako anvertraut wurden. Nach einer Ausbildungsphase durchlaufen sie ein Initiationsritual, meist kamitsuke, in dem sie von einer Gottheit ergriffen werden.
Welche Rolle spielt Ekstase in der Definition von Schamanismus?
Die Arbeit diskutiert, ob Ekstase ein notwendiges Kriterium für die Definition von Schamanismus ist. Kawamura (2003) unterscheidet zwischen Gruppen von Schamaninnen, bei denen Ekstase eine unterschiedliche Rolle spielt.
Gibt es Parallelen zwischen Schamanismus und Shintō?
Die Arbeit stellt Parallelen zwischen koreanischem Schamanismus und Shintō fest, insbesondere in Bezug auf die amoralische Konzeption der Realität, die Gottesvorstellungen und die Zielsetzungen von Ritualen.
Was beinhaltet das Initiationsritual einer itako (kamitsuke)?
Das Initiationsritual beinhaltet eine hunderttägige Meditation, spezielle Diät, rituelle Reinigungen und das Durchleben von Gesängen begleitet von Glockenschellen und anderen Instrumenten, bis die zu Initiierende von einer Gottheit ergriffen wird und kollabiert.
Welche Rolle spielen Gottheiten bei den itako?
Die Gottheit, die die itako bei der Initiation ergreift, dient eher als Patron. Die itako stützt sich auf die Kraft von regionalen oder Hausgottheiten, wenn sie Rituale für das Wohlergehen von Menschen vornimmt oder die Zukunft erkundet.
Was tun itako, wenn sie als Medium für Tote oder Götter dienen?
Wenn itako als Medium dienen, sind sie sich dessen, was sie sprechen, nicht bewusst und erleben auch sonst keine besonderen psychosomatischen Empfindungen durch das körperliche Besessenwerden.
- Quote paper
- Benjamin Brosig (Author), 2008, (Was) ist Schamanismus in Tōhoku?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/138625