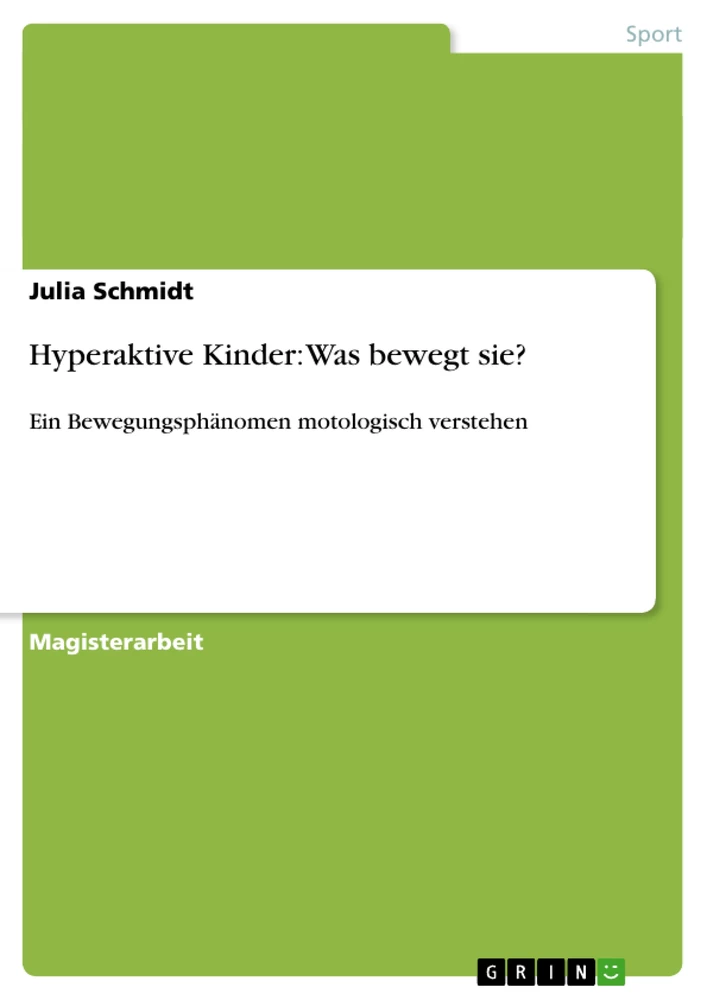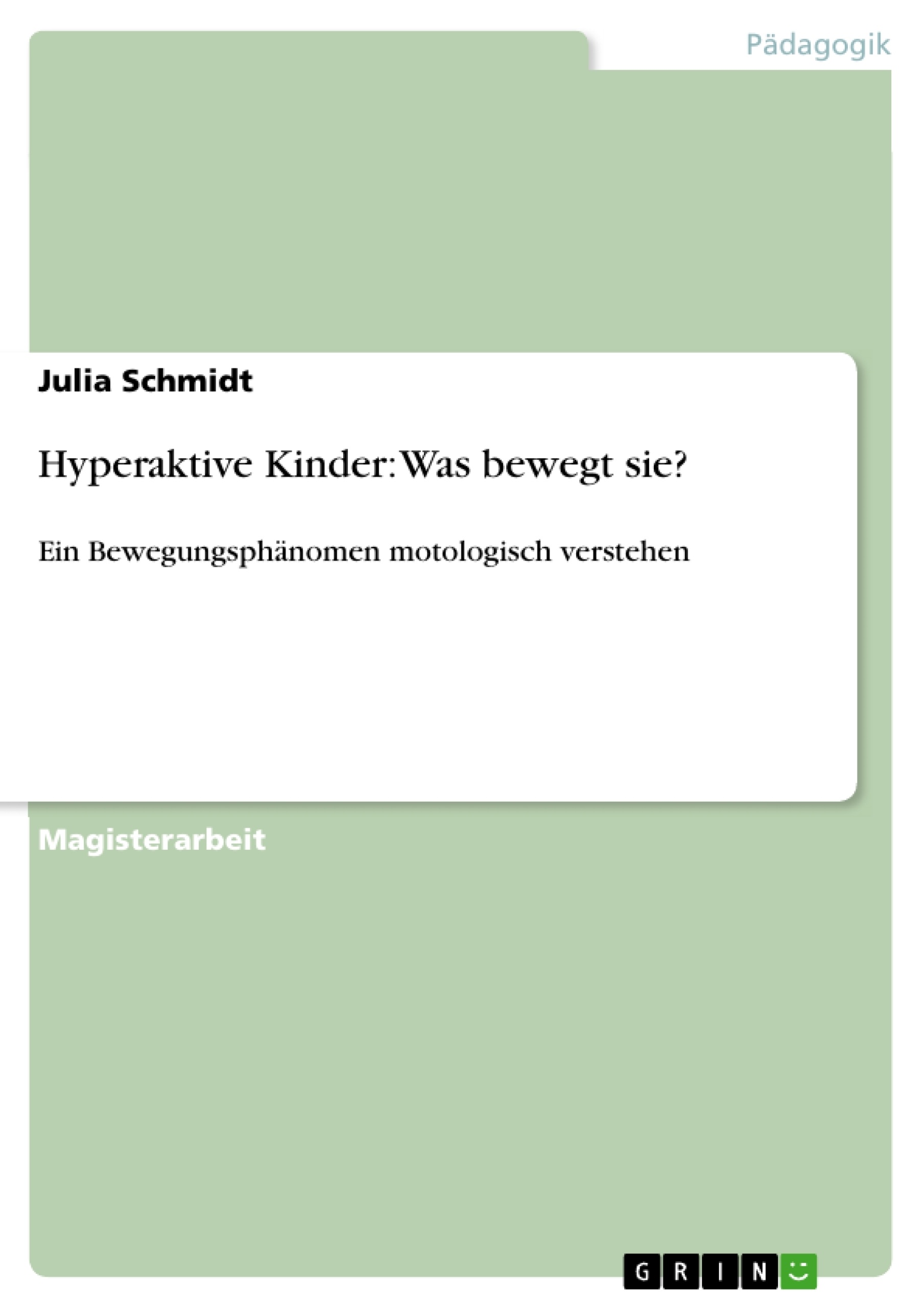Hyperaktive Kinder fallen auf: sie sind ständig in Bewegung, sie passen
sich nicht an, sie werfen um, werden beobachtet, gedeutet und von
ihrer Umgebung als störend identifiziert. Nicht selten lösen sie
Hilflosigkeit bei den Betroffenen aus. Die einschlägige Diagnose dazu
lautet dann meist „ADHS“ (Aufmerksamkeitsdefizit-
/Hyperaktivitätssyndrom) oder „HKS“ (Hyperkinetisches Syndrom). Mit
dieser Stigmatisierung werden die Kinder oft in eine therapeutische
„Norm-Schublade“ gesteckt, um sie (und das Problem) dann vielleicht
besser handhaben zu können (vgl. Passolt 2003, S. 7).
HKS und ADHS sind nur zwei der zahlreichen Begrifflichkeiten, die zur
Beschreibung dieser Verhaltensweisen verwendet werden. Betrachtet
man sich weitere Begriffe, die in diesem Zusammenhang bereits
Verwendung fanden, wie ADS , ADHD, MCD, POS, leichte frühkindliche Hirnschädigung, Teilleistungsschwäche
bzw. -störung oder neurogene Lernschwäche wird deutlich, dass mit
manchen Bezeichnungen mehr auf eine organische Ursache, mit
anderen eher auf eine psychische Verursachung hingewiesen wird.
Während die Medizin entsprechend ihrem Verständnis von Verhaltensauffälligkeiten
als Krankheiten nach organischen Ursachen sucht,
richten Psychologie und Pädagogik ihr Augenmerk auf äußere Einflüsse
in der Umwelt und innere Erlebens- und Beziehungsstrukturen des
Kindes, die es möglicherweise unruhig werden lassen.
Inwieweit eine Sichtweise, die weniger die Auffälligkeiten, als vielmehr
das Kind in seiner gesamten Entwicklung in den Mittelpunkt der
Betrachtung stellt, zu einer kindgerechteren und `effektiveren´
Entwicklungsbegleitung führen kann, soll in dieser Arbeit diskutiert
werden. In Anlehnung an Seewalds „Verstehenden Ansatz in der
Psychomotorik/Motologie“ (2007) sollen Beweg-Gründe von
hyperaktiven Kindern abseits des medizinischen `Mainstreams´
aufgezeigt und vor allem eine Grundlage geschaffen werden, diese zu
verstehen. Zudem werden daraus mögliche therapeutische/praktische
Konsequenzen für das motologisch-verstehende Arbeiten abgeleitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ADHS: aktueller Stand der Forschung - Terminologie und Symptomatik
- Begriffsdefinition von ADHS
- Symptomatik und klinisches Bild des ADHS
- Symptomatik
- Diagnostik und Klassifizierungssysteme
- Differenzialdiagnostik
- Prävalenz
- Verlauf
- Ätiologie - Pathogenese (Ursachenhypothesen)
- Biomedizinische Faktoren
- Psychodynamische Faktoren
- Kulturelle Faktoren
- Therapeutische Interventionen
- Zum biologisch-medizinischen Verständnis von Verhaltensstörungen/-auffälligkeiten am Beispiel ADHS aus psychosozialer Sicht
- Zum Problem der biologisch-medizinischen Ursachenklärung
- Kritik am biologisch-medizinischen Modell
- Problematik der Diagnostik
- Problematik der Behandlung
- Kritik am biologisch-medizinischen Modell
- Biologistisch konstituierte Normalität
- Normalitätsbegriff
- Bewegungs❝störung“ als Beobachtungs-konstruktion
- Zum Problem der biologisch-medizinischen Ursachenklärung
- ADHS vor dem Hintergrund des Verstehenden Ansatzes in der Psychomotorik/ Motologie
- Psychomotorik/Motologie als Schnittstelle
- Der Verstehende Ansatz in der Psychomotorik/Motologie
- Zur Vorgeschichte und Entwicklung
- Anthropologische Grundlagen
- Grundlagen des Verstehens
- Die Bedeutung des Verstehens für ADHS
- Praktische/therapeutische Konsequenzen vor dem Hintergrund des Verstehenden Ansatzes in der Psychomotorik/Motologie
- Die Bedeutung des Verstehens für die Praxis
- Orientierungen für die praktische Arbeit mit hyperaktiven Kindern
- Grenzen der praktischen Arbeit
- Zusammenfassende Überlegungen/ Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen hyperaktiver Kinder, insbesondere unter dem Aspekt von Bewegung. Ziel ist es, ein motologisches Verständnis für die Bewegungsmuster dieser Kinder zu entwickeln und gängige biologisch-medizinische Erklärungsansätze kritisch zu hinterfragen. Der Fokus liegt auf der Anwendung des verstehenden Ansatzes in der Psychomotorik/Motologie.
- Kritische Auseinandersetzung mit dem biologisch-medizinischen Modell von ADHS
- Einführung und Erläuterung des verstehenden Ansatzes in der Psychomotorik/Motologie
- Analyse der Bedeutung von Bewegung im Kontext von ADHS
- Entwicklung eines motologischen Verständnisses für die Bewegungsmuster hyperaktiver Kinder
- Ableitung praktischer Konsequenzen für die therapeutische Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und skizziert die Forschungsfrage nach einem motologischen Verständnis von Bewegung bei hyperaktiven Kindern. Sie begründet die Wahl des verstehenden Ansatzes und die kritische Auseinandersetzung mit dem biologisch-medizinischen Modell von ADHS.
ADHS: aktueller Stand der Forschung - Terminologie und Symptomatik: Dieses Kapitel beschreibt den aktuellen Forschungsstand zu ADHS, beginnend mit der Begriffsdefinition und der historischen Entwicklung des Konstrukts. Es werden die Symptomatik, diagnostische Kriterien und Klassifizierungssysteme detailliert dargestellt. Die Ätiologie wird unter Berücksichtigung biomedizinischer, psychodynamischer und kultureller Faktoren beleuchtet, gefolgt von einer Übersicht über gängige therapeutische Interventionen. Die Komplexität der ADHS-Diagnostik und -Therapie wird hervorgehoben.
Zum biologisch-medizinischen Verständnis von Verhaltensstörungen/-auffälligkeiten am Beispiel ADHS aus psychosozialer Sicht: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit dem rein biologisch-medizinischen Erklärungsmodell von ADHS. Es werden die Problematiken der Diagnostik und der Behandlung aus einer psychosozialen Perspektive herausgearbeitet. Der Begriff der „Normalität“ wird im Kontext eines biologistisch konstituierten Normalitätsverständnisses kritisch hinterfragt. Die Betrachtung von „Bewegungsstörungen“ als Beobachtungs-Konstruktion steht im Zentrum.
ADHS vor dem Hintergrund des Verstehenden Ansatzes in der Psychomotorik/ Motologie: Dieses Kapitel stellt den verstehenden Ansatz in der Psychomotorik/Motologie als Alternative zum biologisch-medizinischen Modell vor. Es beleuchtet die Geschichte und Entwicklung der Psychomotorik, differenziert verschiedene Ansätze und beschreibt ausführlich den verstehenden Ansatz mit seinen anthropologischen Grundlagen (Menschenbilder, Körper- und Bewegungsmodelle) und den verschiedenen Verstehensformen (hermeneutisch, phänomenologisch, tiefenhermeneutisch/psychoanalytisch). Der evolutionäre und gesellschaftliche Kontext des Verstehens wird ebenfalls thematisiert.
Praktische/therapeutische Konsequenzen vor dem Hintergrund des Verstehenden Ansatzes in der Psychomotorik/Motologie: Dieses Kapitel überträgt die theoretischen Überlegungen des verstehenden Ansatzes in die Praxis der Arbeit mit hyperaktiven Kindern. Es werden konkrete Orientierungen und methodische Vorgehensweisen entwickelt, zugleich aber auch die Grenzen und Herausforderungen der praktischen Anwendung diskutiert. Der Fokus liegt auf einem ganzheitlichen und individualisierten Umgang mit hyperaktiven Kindern.
Schlüsselwörter
ADHS, Hyperaktivität, Bewegung, Motologie, Psychomotorik, Verstehender Ansatz, Biologisches Modell, Psychosoziale Perspektive, Diagnostik, Therapie, Normalität, Kindzentrierung, Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zu: ADHS - Ein motologisches Verständnis von Bewegung bei hyperaktiven Kindern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen hyperaktiver Kinder, insbesondere im Hinblick auf ihre Bewegungsmuster. Sie hinterfragt kritisch biologisch-medizinische Erklärungsansätze von ADHS und entwickelt ein motologisches Verständnis, basierend auf dem verstehenden Ansatz in der Psychomotorik/Motologie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Symptomatik von ADHS, die kritische Auseinandersetzung mit dem biologisch-medizinischen Modell (inklusive Diagnostik und Therapie), die Einführung und Erläuterung des verstehenden Ansatzes in der Psychomotorik/Motologie, die Analyse der Bedeutung von Bewegung im Kontext von ADHS und die Ableitung praktischer Konsequenzen für die therapeutische Arbeit. Es werden anthropologische Grundlagen, verschiedene Verstehensformen und der evolutionäre Kontext berücksichtigt.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Entwicklung eines motologischen Verständnisses für die Bewegungsmuster hyperaktiver Kinder. Dies geschieht durch die kritische Auseinandersetzung mit etablierten Erklärungsansätzen und die Anwendung des verstehenden Ansatzes in der Psychomotorik/Motologie.
Warum wird der "verstehende Ansatz" verwendet?
Der "verstehende Ansatz" in der Psychomotorik/Motologie wird als Alternative zum rein biologisch-medizinischen Modell gewählt, um ein ganzheitlicheres und individualisierteres Verständnis von den Bewegungsmustern hyperaktiver Kinder zu ermöglichen. Er erlaubt die Berücksichtigung des individuellen Kontextes und der subjektiven Erfahrung.
Welche Kritik wird am biologisch-medizinischen Modell geübt?
Das biologisch-medizinische Modell von ADHS wird kritisch hinterfragt hinsichtlich der Problematik der Diagnostik (z.B. die Schwierigkeit, ADHS eindeutig von anderen Störungen zu unterscheiden) und der Behandlung (z.B. die Nebenwirkungen von Medikamenten). Der Normalitätsbegriff im Kontext dieses Modells wird ebenfalls hinterfragt.
Welche praktischen Konsequenzen werden abgeleitet?
Die Arbeit leitet konkrete Orientierungen und methodische Vorgehensweisen für die therapeutische Arbeit mit hyperaktiven Kindern ab, die auf dem verstehenden Ansatz beruhen. Es wird jedoch auch auf die Grenzen und Herausforderungen der praktischen Anwendung hingewiesen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum aktuellen Forschungsstand von ADHS, ein Kapitel zur kritischen Auseinandersetzung mit dem biologisch-medizinischen Modell, ein Kapitel zum verstehenden Ansatz in der Psychomotorik/Motologie, ein Kapitel zu den praktischen Konsequenzen und abschließende Überlegungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: ADHS, Hyperaktivität, Bewegung, Motologie, Psychomotorik, Verstehender Ansatz, Biologisches Modell, Psychosoziale Perspektive, Diagnostik, Therapie, Normalität, Kindzentrierung, Entwicklung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, Therapeuten, Pädagogen, und alle, die sich mit dem Thema ADHS und der Bedeutung von Bewegung auseinandersetzen.
- Quote paper
- Julia Schmidt (Author), 2009, Hyperaktive Kinder: Was bewegt sie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/138491