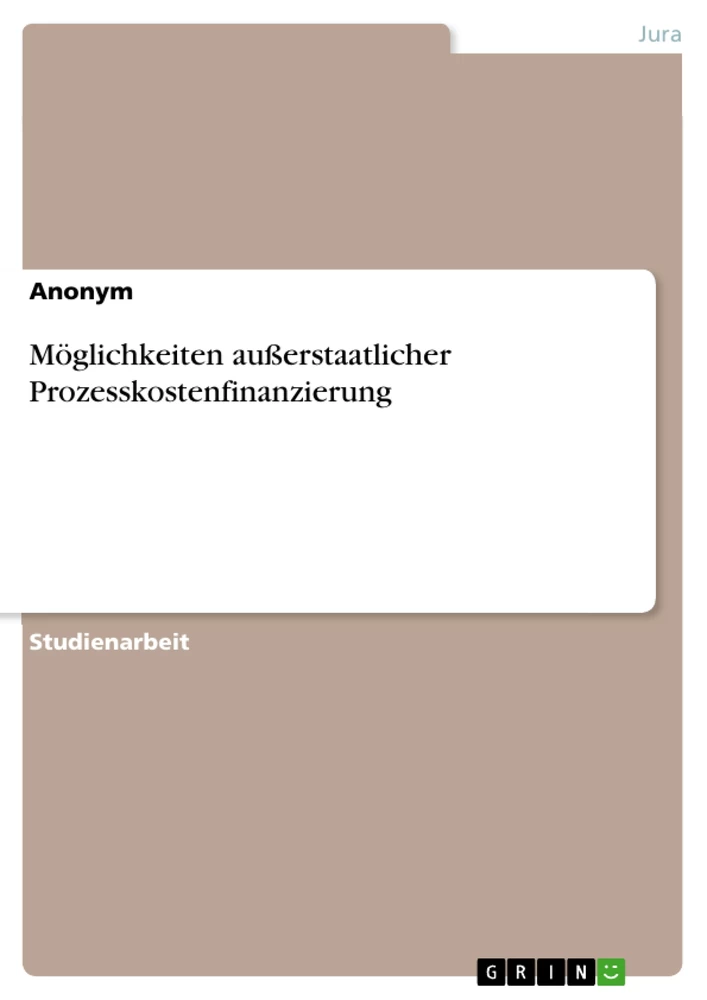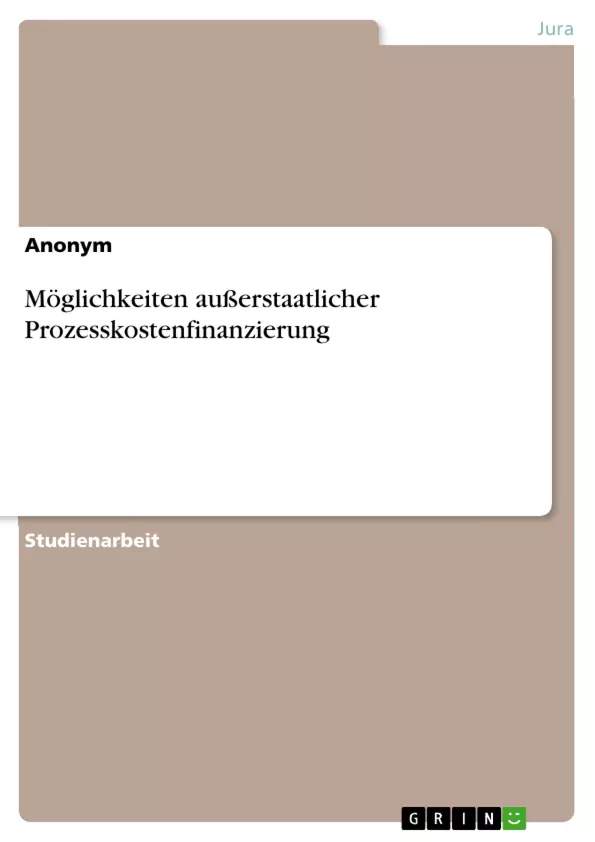Um einen Gerichtsprozess führen zu können, benötigt der Anspruchsinhaber die entsprechenden finanziellen Mittel, um diese Kosten decken zu können. Dies hat vor einigen Jahren viele natürliche und juristische Personen darin gehindert, für dessen Recht einstehen zu können. Es fallen nicht nur die Gerichts- und Anwaltskosten an, sondern zusätzlich im Falle des Unterliegens die Prozesskosten der anderen Partei zu erstatten. Demnach besteht ein gewisses Risiko für den Anspruchsinhaber, wenn ein Rechtsstreit angegangen wird. Zumal das Prozessieren seit dem Jahr 2004 in vielen Fällen teurer wurde. Hintergrund hierzu sind das neue Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und die Neuregelung gem. § 3 GKG der Gerichtskosten, welche deutlich höher ausfallen. Somit rückte die Prozesskostenfinanzierung in den Vordergrund. Zusätzlich gewann die außerstaatliche Prozesskostenfinanzierung noch in diesem Jahr an Aufmerksamkeit. Die Aktionäre, welche im Betrugsfall Wirecard ihr Geld verloren haben, können sich an der Schadensersatzklage gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst and Young beteiligen, ohne ein Kostenrisiko eingehen zu müssen. Dies wurde mithilfe der Prozesskostenfinanzierung gegen ein Erfolgshonorar einer Kanzlei ermöglicht. Hier würde den Aktionären bei Gelingen der Schadensersatz abzüglich der 20 % des Erfolgshonorars an die Prozesskostenfinanzierer, zu Gute geschrieben werden. Gelingt dies nicht, haben die Anleger keine Kosten zu tragen.
Das Prinzip der außerstaatlichen Prozesskostenfinanzierung kann als eine juristische Finanzdienstleistung betrachtet werden, welche im Jahr 1998 von der FORIS AG erstmals in Deutschland vorgestellt wurde und mittlerweile von entscheidenden Unternehmen durchgeführt wird. Die Prozesskostenfinanzierung hat sich seither zu einer etablierten Institution im Rechtsmarkt realisiert und wird zunehmend in Anspruch genommen. In diesem Sinne verpflichtet sich der Prozessfinanzierer Kosten des Anspruchsinhabers zu übernehmen. Hierbei kann es sich um die Vorfinanzierung der Gerichts- und Anwaltskosten handeln oder im Falle des Unterliegens des Mandanten die gesamten Kosten des Rechtsstreits zu finanzieren. Die Prozesskosten können vom Finanzierer jedoch auch nur teilweise übernommen werden. Dies ist abhängig von der zuvor festgelegten Vereinbarung. Hingegen verpflichtet sich der Anspruchsinhaber eine Gegenleistung in Form einer vorher fest-gelegten Erfolgsbeteiligung oder monatlichen Beiträgen zu zahlen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemdarstellung und Zielsetzung
- II. Gang der Arbeit
- B. Definitorische Grundlage der Prozesskostenfinanzierung
- I. Allgemeines zur Prozesskostenfinanzierung
- II. Inhalt eines Finanzierungsvertrages
- 1. Die Entstehung eines Prozessfinanzierungsvertrages
- 2. Rechte und Pflichten des Prozessfinanzierers
- 3. Rechte und Pflichten des Anspruchsinhabers
- C. Finanzierungsformen
- I. Die Finanzierung durch ein Prozessfinanzierungsunternehmen
- 1. Vorgang einer Finanzierungsanfrage
- 2. Risikoausschlüsse
- II. Finanzierung durch Kreditinstitute
- 1. Voraussetzungen der Prozesskostenfinanzierung
- III. Finanzierung durch die (Rechtsschutz-)Versicherung
- 1. Rechtsgrundlage der Rechtsschutzversicherung
- 2. Leistungskatalog
- IV. Finanzierung durch Rechtsanwälte gegen eine Erfolgsbeteiligung
- 1. Allgemeines zur Finanzierung durch Rechtsanwälte gegen Erfolgsbeteiligung
- 2. Das Verbot der quota litis
- 3. Tätigkeit auf ,,pro bono“-Basis
- V. Finanzierung durch den Forderungskauf und das Factoring
- D. Verhältnis der auẞerstaatlichen Prozesskostenfinanzierung zur staatlichen Prozesskostenhilfe
- I. Die staatliche Prozesskostenhilfe
- II. Die staatliche Prozesskostenhilfe und ausserstaatliche Prozessfinanzierungsmöglichkeiten im Vergleich
- E. Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit den Möglichkeiten außerstaatlicher Prozesskostenfinanzierung. Ziel ist es, die verschiedenen Finanzierungsformen und ihre Funktionsweise zu erläutern und deren Verhältnis zur staatlichen Prozesskostenhilfe darzustellen.
- Definitorische Grundlagen der Prozesskostenfinanzierung
- Verschiedene Finanzierungsformen
- Vergleich von staatlicher und außerstaatlicher Prozesskostenfinanzierung
- Risiken und Chancen der Prozesskostenfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Prozesskostenfinanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Finanzierung von Prozesskosten dar und erläutert die Zielsetzung und den Gang der Arbeit.
- Definitorische Grundlage der Prozesskostenfinanzierung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition der Prozesskostenfinanzierung, den Inhalten eines Finanzierungsvertrages und den Rechten und Pflichten der beteiligten Parteien.
- Finanzierungsformen: Dieses Kapitel stellt verschiedene Finanzierungsformen vor, wie z. B. die Finanzierung durch Prozessfinanzierungsunternehmen, Kreditinstitute, Rechtsschutzversicherungen, Rechtsanwälte gegen Erfolgsbeteiligung und durch Forderungskauf/Factoring.
- Verhältnis der außerstaatlichen Prozesskostenfinanzierung zur staatlichen Prozesskostenhilfe: Dieses Kapitel vergleicht die staatliche Prozesskostenhilfe mit den verschiedenen Möglichkeiten der außerstaatlichen Prozesskostenfinanzierung.
Schlüsselwörter
Prozesskostenfinanzierung, außerstaatliche Finanzierung, staatliche Prozesskostenhilfe, Prozessfinanzierungsunternehmen, Kreditinstitute, Rechtsschutzversicherung, Erfolgsbeteiligung, Forderungskauf, Factoring.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Möglichkeiten außerstaatlicher Prozesskostenfinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1381877