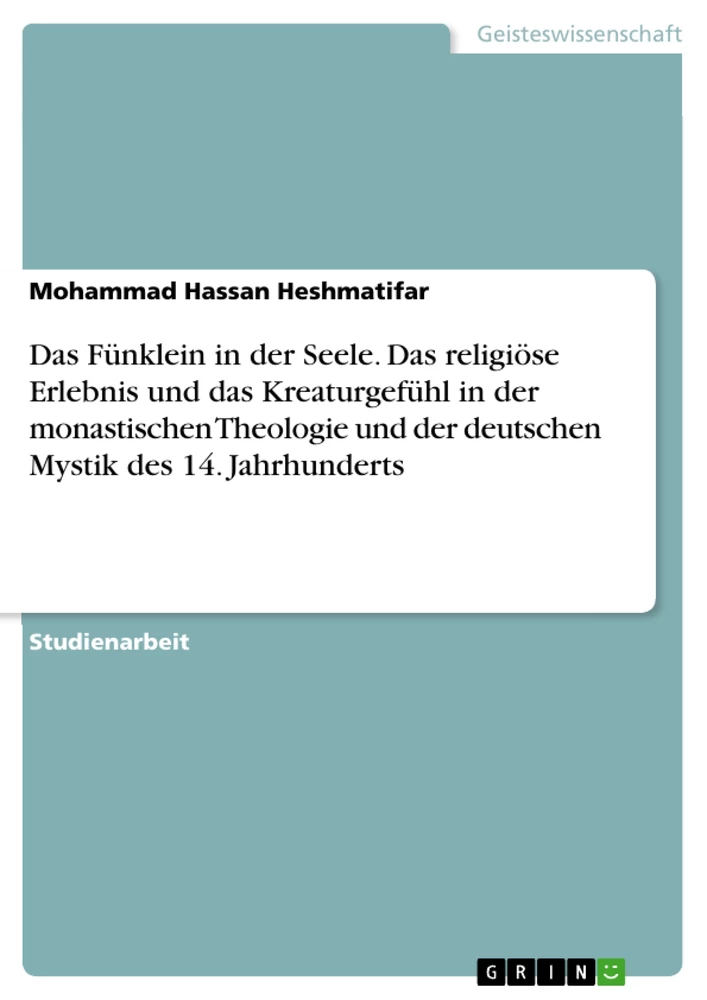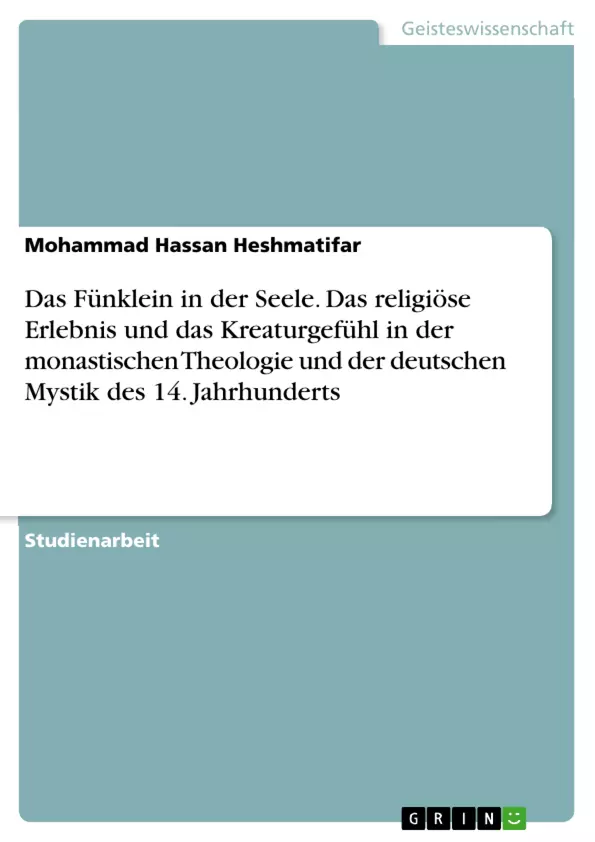Diese Arbeit zielt darauf ab, die Verbindungen und Einflüsse zwischen monastischer Theologie, den Wüstenvätern und zwei deutschen Mystikern des 14. Jahrhunderts, Heinrich Seuse und Johannes Tauler, zu untersuchen und zu erklären. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf das Kreaturgefühl und seine Rolle als Verbindungspunkt zwischen diesen spirituellen Strömungen gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Glaube ohne rationale Rechtfertigung
- Die monastische Theologie
- Heinrich Seuse und modus spiritualis
- Das Kreaturgefühl und Das Fünklein in der Seele
- Das Kreaturgefühl
- Das Fünklein in der Seele
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert das Traktat "Das Fünklein in der Seele" aus der "Gottesfreundliteratur" der Straßburger Johanniterkomturei 'Zum Grünen Wörth'. Er untersucht das Werk im Kontext der monastischen Theologie und beleuchtet die Verbindung zwischen den Wüstenvätern, der monastischen Theologie und der deutschen Mystik des 14. Jahrhunderts. Insbesondere werden Heinrich Seuses "modus spiritualis" und Johannes Taulers "Seelengrundlehre" im Zusammenhang mit dem Kreaturgefühl betrachtet.
- Das religiöse Erlebnis und das Kreaturgefühl
- Die monastische Theologie und ihre Ausprägungen
- Die Rolle des "modus spiritualis" und der Seelengrundlehre
- Der Einfluss der Wüstenväter auf die deutsche Mystik
- Das Verhältnis von Glaube, Vernunft und Offenbarung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt einen grundlegenden Unterschied zwischen "Körper" und "Leib" im Deutschen heraus. Sie erklärt, wie sich "Leib" aus dem Nicht-Lebendigen zum Lebendigen entwickelt und wie der Mensch durch seine Selbstbewusstheit Zugang zum schöpferischen Ursprung hat. Darauf aufbauend wird zwischen Erfahrung und Erlebnis unterschieden, wobei das Erlebnis als ein unmittelbarerer Zugang zu einer Entität verstanden wird. Die Einleitung erläutert zwei Auffassungen der Offenbarung Gottes: die Inspirationstheorie und die Selbstoffenbarung.
Der Glaube ohne rationale Rechtfertigung
Dieses Kapitel befasst sich mit einer Konzeption des religiösen Glaubens, der seiner Natur nach rationaler Begründung unzugänglich ist. Es wird die Offenbarung als eigenständige Erkenntnisquelle neben der Vernunft eingeführt und die Bedeutung des Bibelkanons im Christentum als Offenbarungsgrundlage beleuchtet. Es werden zwei Offenbarungsbegriffe vorgestellt: die Inspirationstheorie und die Selbstoffenbarung, wobei die Selbstoffenbarung als eine nicht-propositionale, persönliche Erfahrung verstanden wird.
Das Kreaturgefühl und Das Fünklein in der Seele
Dieser Teil beleuchtet die Bedeutung des Kreaturgefühls und seine Verbindung zur "Gottesfreundliteratur". Es wird erläutert, wie das Kreaturgefühl als verbindendes Element zwischen den verschiedenen theoretischen Quellen wie der monastischen Theologie, dem "modus spiritualis" und der Seelengrundlehre fungiert. Der Fokus liegt auf der intensiven Suche nach dem spirituellen Erlebnis im "Fünklein in der Seele" und dessen Rolle bei der Verbindung des Glaubens mit dem "Leib" und dem persönlichen Erleben des Göttlichen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Begriffe des Textes sind: "Kreaturgefühl", "modus spiritualis", "Seelengrundlehre", "monastische Theologie", "Wüstenväter", "religiöses Erlebnis", "Offenbarung", "Inspirationstheorie", "Selbstoffenbarung", "Gottesfreundliteratur", "Das Fünklein in der Seele", "Heinrich Seuse", "Johannes Tauler". Diese Schlüsselwörter verdeutlichen die Verbindung zwischen theologischen und mystischen Traditionen, die Rolle des persönlichen Erlebens in der spirituellen Erfahrung und die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Vernunft und Glauben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Fünklein in der Seele“?
Es ist ein zentraler Begriff der deutschen Mystik, der den innersten Kern der Seele beschreibt, in dem eine unmittelbare Vereinigung mit Gott möglich ist.
Welche Mystiker werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit befasst sich schwerpunktmäßig mit Heinrich Seuse und Johannes Tauler sowie deren Einflüssen aus der monastischen Theologie.
Was bedeutet „Kreaturgefühl“?
Das Kreaturgefühl beschreibt das Bewusstsein des Menschen über seine eigene Endlichkeit und Abhängigkeit von einem schöpferischen Ursprung.
Was ist monastische Theologie?
Es ist eine Form der Theologie, die stark in der klösterlichen Erfahrung und dem persönlichen religiösen Erleben verwurzelt ist, im Gegensatz zur rein rationalen Scholastik.
Welche Rolle spielen die Wüstenväter?
Die Spiritualität der frühen Wüstenväter gilt als eine der historischen Wurzeln für die spätere monastische Theologie und die deutsche Mystik.
- Quote paper
- Mohammad Hassan Heshmatifar (Author), 2023, Das Fünklein in der Seele. Das religiöse Erlebnis und das Kreaturgefühl in der monastischen Theologie und der deutschen Mystik des 14. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1378222