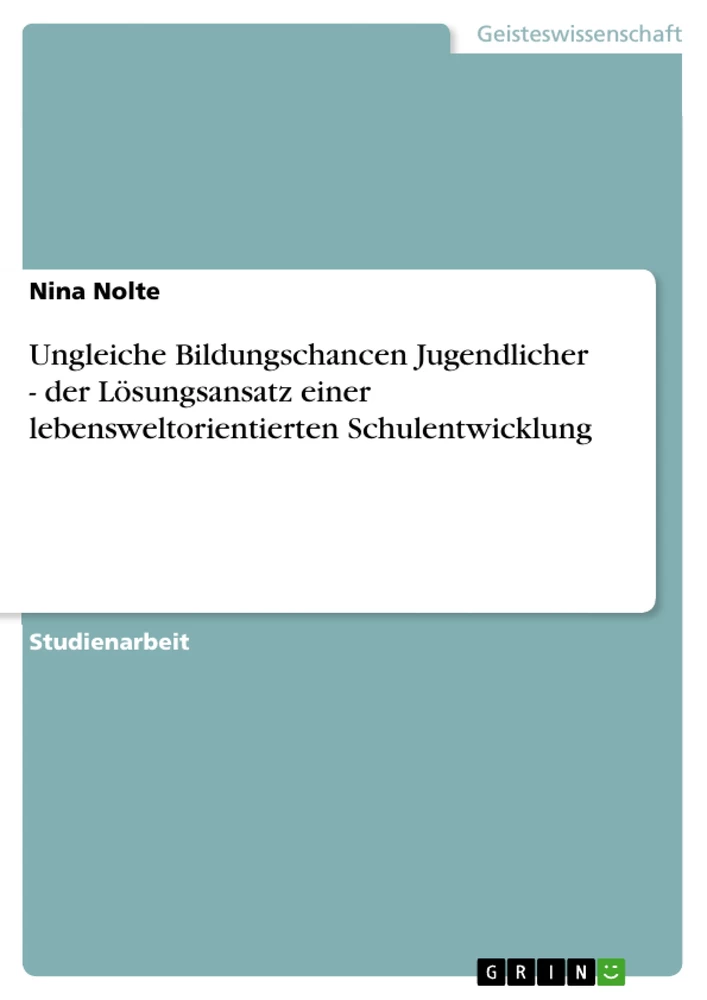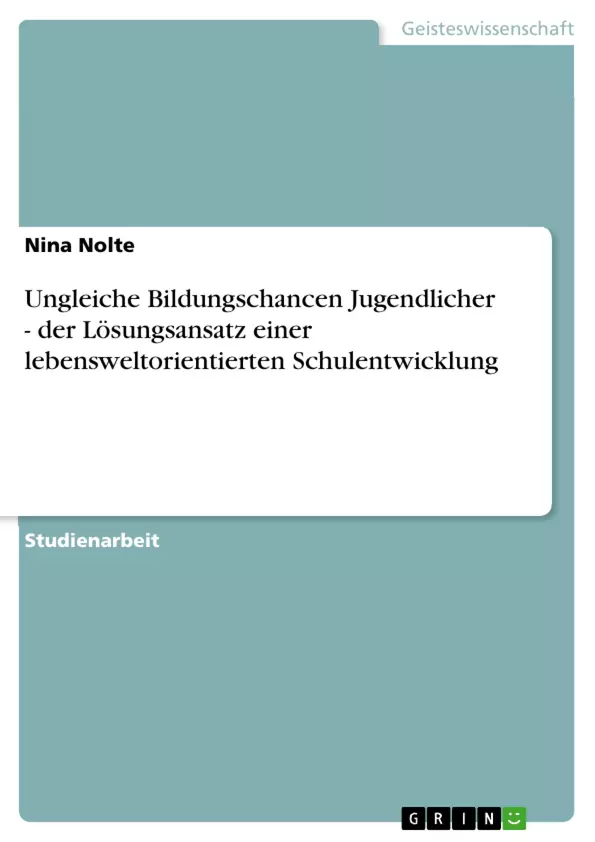Studien wie PISA und IGLU beweisen, was viele Theoretiker schon lange zur Diskussion stellen: Die
Evaluation des deutschen Schulsystems zeigt im internationalen Vergleich deutliche Mängel bei den
fachlichen und fachübergreifenden Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen. Besonderns auffällig
ist dabei, dass Bildung in hohem Maße von der sozialen Herkunft abhängt. Diese Arbeit soll sich
daher aus kultursoziologischer Perspektive mit den Ursachen beschäftigen, die für die Entstehung
dieser Chancenungleichheit im Schulsystem verantwortlich sind. Als möglicher Lösungsansatz soll
im Anschluss an diese Betrachtung das Modell einer „lebensweltorientierten Schulentwicklung“
diskutiert werden, welches einen stärkeren Bezug der Schulpolitik auf die Lebenswelten der
Schülerinnen und Schüler fordert. Die zentrale Fragestellung lautet also:
Welche gesellschaftlichen Selektionsmechanismen wirken bei der Entstehung von ungleichen
Bildungschancen Jugendlicher und könnte eine lebensweltorientierte Schulentwicklung Ansätze
liefern diese Ungleichheiten einzuebnen?
Da sich diese Arbeit schwerpunktmäßig auf Jugendliche bezieht, wird zunächst der zugrunde
liegende Jugendbegriff geklärt und die Folgen der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse auf
jugendliche Entwicklung werden aufgezeigt.
Anschließend folgt der Theorieteil der sich auf die Arbeiten des Soziologen Pierre Bourdieu bezieht
und davon ausgehend die besondere Bedeutsamkeit des Habitus und des kulturellen Kapitals
beschreibt. Daran schließen empirische Aspekte an, welche die vorherigen Ergebnisse stützen sollen
und den Zusammenhang zwischen Bildungschancen und sozialer Herkunft näher beleuchten.
Im Anschluss werden auf der Basis der bisherigen Ergebnisse Anforderungen an eine zeitgemäße
Schulpolitik mit integrativer Funktion formuliert, die bisher im Bereich der Schulentwicklung nur
ansatzweise erfüllt werden. Als mögliche Antwort auf diese Forderungen wird schließlich der
Lösungsansatz einer „lebensweltorientierten Schulentwicklung“ vorgestellt.
Da unter Bezugnahme der Ergebnisse des Theorieteils der Ansatz einer „lebensweltorientierten
Schulentwicklung“ diskutiert werden soll, wird im nächsten Kapitel eine Begriffsklärung
vorgenommen. Der Begriff der Lebenswelt wird erläutert und die bedeutsamsten Lebenswelten der
Jugendlichen – Familie, Peergroups und Schule- werden näher skizziert. In diesem Zusammenhang
wird auch auf die besondere Bedeutung sozialer Räume eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärung Jugend
- 2.1 Sozial-historische Entwicklung und gesellschaftliche Wandlungsprozesse
- 3 Die Bedeutung des kulturellen Kapitals nach Bourdieu
- 3.1 Ungleiche Bildungschancen und soziale Herkunft
- 4 Jugendliche Lebenswelten
- 4.1 Die Bedeutung von sozialen Räumen
- 4.2 Lebenswelt Familie
- 4.3 Lebenswelt Peergroups
- 4.4 Lebenswelt Schule - Funktionen und Aufgaben
- 5 Kultursoziologische Kritik und Anforderungen an Schulentwicklung
- 6 Das Modell der lebensweltbezogenen Schulentwicklung als Lösungsansatz
- 6.1 Diskussion der Anwendbarkeit
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht aus kultursoziologischer Perspektive die Ursachen für ungleiche Bildungschancen Jugendlicher in Deutschland. Sie analysiert gesellschaftliche Selektionsmechanismen, die zu dieser Ungleichheit beitragen, und diskutiert das Modell einer „lebensweltorientierten Schulentwicklung“ als möglichen Lösungsansatz. Die zentrale Frage lautet: Welche gesellschaftlichen Selektionsmechanismen wirken bei der Entstehung von ungleichen Bildungschancen Jugendlicher, und könnte eine lebensweltorientierte Schulentwicklung Ansätze liefern, diese Ungleichheiten auszugleichen?
- Der Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungschancen
- Die Bedeutung des kulturellen Kapitals nach Bourdieu
- Jugendliche Lebenswelten (Familie, Peergroups, Schule)
- Anforderungen an eine zeitgemäße, integrative Schulpolitik
- Das Modell der lebensweltorientierten Schulentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ungleicher Bildungschancen Jugendlicher ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den gesellschaftlichen Selektionsmechanismen und dem Potential einer lebensweltorientierten Schulentwicklung. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, beginnend mit einer Begriffsklärung von Jugend, über die Betrachtung des kulturellen Kapitals nach Bourdieu und jugendlicher Lebenswelten bis hin zur Diskussion des Lösungsansatzes der lebensweltorientierten Schulentwicklung.
2 Begriffsklärung Jugend: Dieses Kapitel klärt den verwendeten Jugendbegriff. Es zeigt auf, dass der Begriff im alltäglichen Sprachgebrauch und in wissenschaftlichen Kontexten unterschiedlich verstanden wird. Der Fokus liegt auf dem dynamischen, pluralistischen und sich wandelnden Charakter der Jugendphase im Kontext gesellschaftlicher Wandlungsprozesse. Die statische Vorstellung einer klar abgegrenzten Lebensphase wird kritisiert und durch ein komplexeres, individualisierteres Verständnis ersetzt.
2.1 Sozial-historische Entwicklung und gesellschaftliche Wandlungsprozesse: Dieses Kapitel beleuchtet die sozial-historische Entwicklung des Jugendbegriffs, beginnend mit der Industrialisierung und der damit verbundenen Verstädterung. Die Einführung der Schulpflicht und die zunehmende Bildungsexpansion werden als entscheidende Faktoren für die Ausdifferenzierung der Jugendphase hervorgehoben. Die Bildungsexpansion wird sowohl als Antwort auf den steigenden Bildungsbedarf als auch als Faktor, der zu "Qualifikationsüberschüssen" und Unsicherheit bei Jugendlichen führen kann, diskutiert. Der Einfluss der Individualisierungsthese von Ulrich Beck wird im Kontext der Bildungsexpansion erläutert, wobei die Herausforderungen und Risiken für Jugendliche mit schlechteren Voraussetzungen betont werden.
3 Die Bedeutung des kulturellen Kapitals nach Bourdieu: Dieses Kapitel befasst sich mit der Theorie Pierre Bourdieus und deren Relevanz für das Verständnis ungleicher Bildungschancen. Es erläutert den Begriff des kulturellen Kapitals und dessen Einfluss auf den schulischen Erfolg. Die Kapitel behandelt die Übertragung des kulturellen Kapitals von Generation zu Generation und deren Auswirkung auf die Bildungschancen von Jugendlichen unterschiedlicher sozialer Herkunft. Der Zusammenhang zwischen Habitus und kulturellem Kapital wird detailliert dargestellt.
4 Jugendliche Lebenswelten: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Lebenswelten von Jugendlichen und deren Bedeutung für ihre Bildung. Es untersucht den Einfluss sozialer Räume, der Familie, der Peergroups und der Schule auf die Entwicklung und das Lernen der Jugendlichen. Das Kapitel zeigt die Interdependenzen der verschiedenen Lebenswelten auf und wie diese die Chancen und Herausforderungen von Jugendlichen beeinflussen. Die Funktion und Aufgabe der Schule wird im Kontext dieser Analyse betrachtet.
5 Kultursoziologische Kritik und Anforderungen an Schulentwicklung: Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln werden in diesem Kapitel kritische Punkte der bestehenden Schulpolitik aus kultursoziologischer Perspektive beleuchtet und Anforderungen an eine zeitgemäße, integrative Schulpolitik formuliert. Hier wird die Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen von Jugendlichen und den Angeboten der Schule analysiert und die Notwendigkeit einer Veränderung der Schulentwicklung aufgezeigt. Es wird auf die Notwendigkeit einer integrativeren Schulpolitik hingewiesen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Voraussetzungen der Schüler gerecht zu werden.
6 Das Modell der lebensweltbezogenen Schulentwicklung als Lösungsansatz: Dieses Kapitel präsentiert das Modell der lebensweltorientierten Schulentwicklung als einen möglichen Lösungsansatz für die Problematik ungleicher Bildungschancen. Es erläutert die Grundprinzipien dieses Modells und diskutiert dessen Potenzial, die Schule stärker an die Lebenswelten der Schüler anzupassen und dadurch die Bildungschancen aller Jugendlichen zu verbessern. Die Anpassung der Schulpolitik an die Lebenswelten der Schüler und die damit verbundenen Herausforderungen und Möglichkeiten werden im Detail diskutiert.
Schlüsselwörter
Ungleiche Bildungschancen, Jugend, kulturelles Kapital, Pierre Bourdieu, Habitus, soziale Herkunft, Lebenswelten, Familie, Peergroups, Schule, Schulentwicklung, lebensweltorientierte Schulentwicklung, gesellschaftliche Selektionsmechanismen, Bildungsexpansion, Individualisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ungleiche Bildungschancen Jugendlicher
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht aus kultursoziologischer Perspektive die Ursachen für ungleiche Bildungschancen Jugendlicher in Deutschland. Sie analysiert gesellschaftliche Selektionsmechanismen, die zu dieser Ungleichheit beitragen, und diskutiert das Modell einer „lebensweltorientierten Schulentwicklung“ als möglichen Lösungsansatz. Die zentrale Frage lautet: Welche gesellschaftlichen Selektionsmechanismen wirken bei der Entstehung von ungleichen Bildungschancen Jugendlicher, und könnte eine lebensweltorientierte Schulentwicklung Ansätze liefern, diese Ungleichheiten auszugleichen?
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungschancen, die Bedeutung des kulturellen Kapitals nach Bourdieu, jugendliche Lebenswelten (Familie, Peergroups, Schule), Anforderungen an eine zeitgemäße, integrative Schulpolitik und das Modell der lebensweltorientierten Schulentwicklung. Sie beinhaltet eine Begriffsklärung von "Jugend" unter Berücksichtigung sozial-historischer Entwicklungen und gesellschaftlicher Wandlungsprozesse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und einer Begriffsklärung von Jugend, einschließlich einer Betrachtung der sozial-historischen Entwicklung und gesellschaftlicher Wandlungsprozesse. Es folgt ein Kapitel zur Bedeutung des kulturellen Kapitals nach Bourdieu und eine Analyse jugendlicher Lebenswelten (Familie, Peergroups, Schule). Anschließend wird kultursoziologische Kritik an der bestehenden Schulpolitik geübt und Anforderungen an eine zeitgemäße, integrative Schulpolitik formuliert. Schließlich wird das Modell der lebensweltbezogenen Schulentwicklung als Lösungsansatz vorgestellt und diskutiert.
Was ist die Bedeutung des kulturellen Kapitals nach Bourdieu?
Die Arbeit erläutert den Begriff des kulturellen Kapitals nach Bourdieu und dessen Einfluss auf den schulischen Erfolg. Sie behandelt die Übertragung des kulturellen Kapitals von Generation zu Generation und deren Auswirkung auf die Bildungschancen von Jugendlichen unterschiedlicher sozialer Herkunft. Der Zusammenhang zwischen Habitus und kulturellem Kapital wird detailliert dargestellt.
Welche Rolle spielen jugendliche Lebenswelten?
Die Arbeit analysiert verschiedene Lebenswelten von Jugendlichen (Familie, Peergroups, Schule) und deren Bedeutung für ihre Bildung. Sie untersucht den Einfluss dieser Lebenswelten auf die Entwicklung und das Lernen der Jugendlichen und zeigt die Interdependenzen zwischen ihnen auf.
Was ist das Modell der lebensweltbezogenen Schulentwicklung?
Das Modell der lebensweltorientierten Schulentwicklung wird als möglicher Lösungsansatz für ungleiche Bildungschancen präsentiert. Es erläutert die Grundprinzipien dieses Modells und diskutiert dessen Potenzial, die Schule stärker an die Lebenswelten der Schüler anzupassen und dadurch die Bildungschancen aller Jugendlichen zu verbessern.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Bedeutung gesellschaftlicher Selektionsmechanismen bei der Entstehung ungleicher Bildungschancen und diskutiert das Potential der lebensweltorientierten Schulentwicklung als Lösungsansatz. Ein Fazit fasst die zentralen Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ungleiche Bildungschancen, Jugend, kulturelles Kapital, Pierre Bourdieu, Habitus, soziale Herkunft, Lebenswelten, Familie, Peergroups, Schule, Schulentwicklung, lebensweltorientierte Schulentwicklung, gesellschaftliche Selektionsmechanismen, Bildungsexpansion, Individualisierung.
- Quote paper
- Nina Nolte (Author), 2008, Ungleiche Bildungschancen Jugendlicher - der Lösungsansatz einer lebensweltorientierten Schulentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/137660