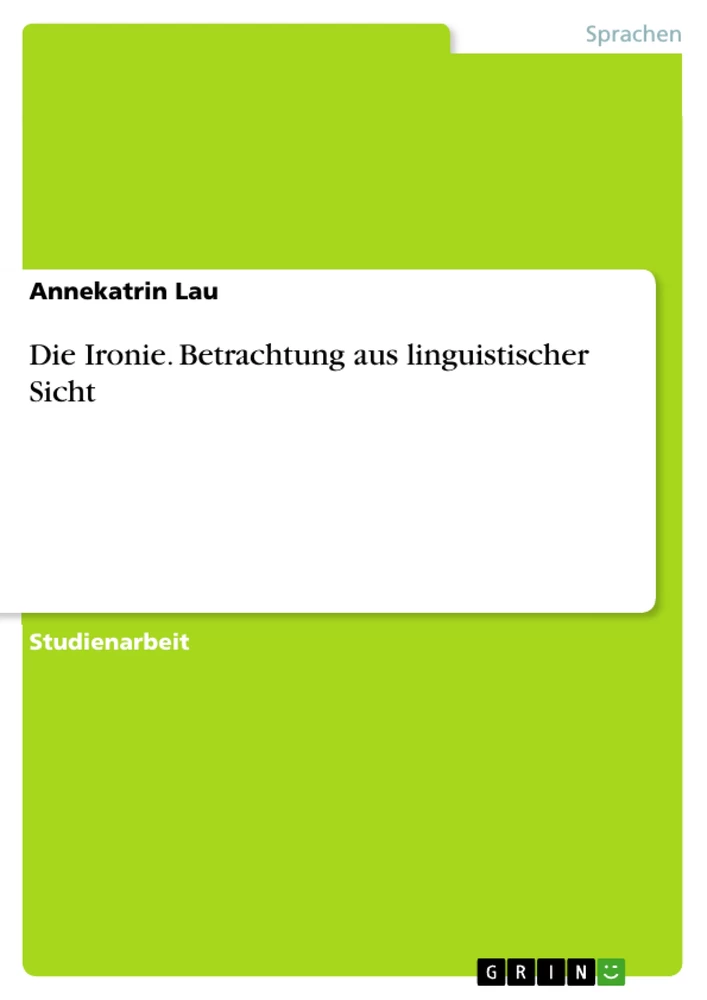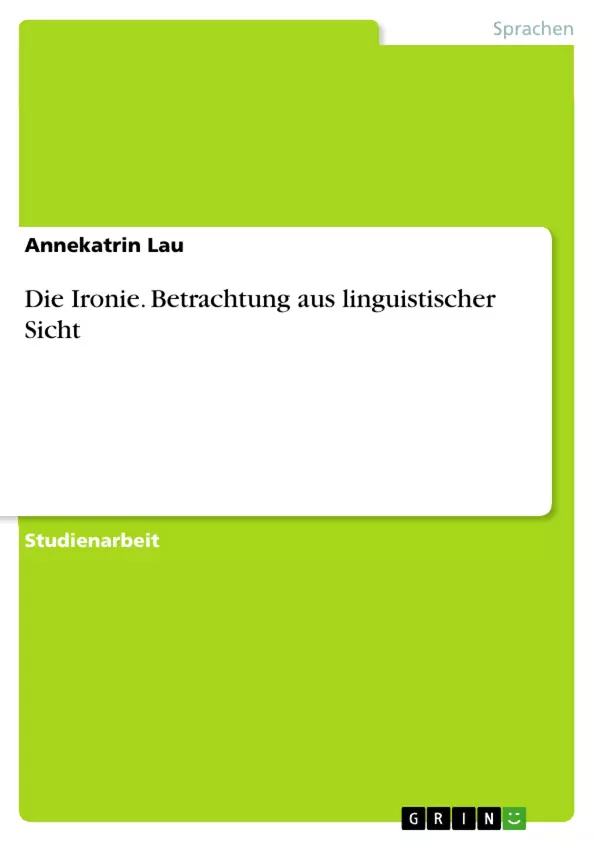In dieser Hausarbeit beschäftige ich mich mit dem sehr umfangreichen Thema der Ironie und ihre Betrachtungsweise aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Sehr viele Sprachwissenschaftler haben sich seit den sechziger Jahren intensiv mit dem Phänomen Ironie auseinandergesetzt und sind teilweise auf sehr unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf die Verwendung von Ironie im Sprachgebrauch sowie ihrer sprachlichen Markierung gekommen. Im ersten Teil der Arbeit widme ich mich den Definitionen für Ironie sowie ihrer geschichtlichen Vergangenheit. In einem weiteren Schritt werden Eigenschaften der Ironie vorgestellt, um ihre Vielfältigkeit aufzuzeigen und anschließend die dadurch entstehende Problematik der Einordnung der Ironie in eine sprachwissenschaftliche Kategorie. Da es in der einschlägigen Literatur die unterschiedlichsten Ansätze und Theorien zur Klassifizierung der Ironie gibt, habe ich mich für die am weit verbreiteten Erklärungsmodelle entschieden, um einen kleinen Einblick in die Ironie als linguistisches Problem geben zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Ironie
- Definitionen
- Problematik der Ironie - Definition
- Ironie und Linguistik
- Ironie im Wandel der Zeit
- Ironie in der Antike
- Ironie in der Romantik
- Ironie in der Moderne
- Eigenschaften der Ironie
- Indirektheit
- Ironiesignale
- Kontext- und Situationsabhängigkeit
- Verstoß gegen Konversationsmaximen
- Wertung
- Humor/Komik
- Sprachästhetik
- Ironie als linguistisches Problem
- Erste sprachwissenschaftliche Ansätze
- Erklärungsmodelle
- Pragmatik
- Theorie der konversationellen Implikatur
- Echoic Mention Theory
- Sprechakttheorie
- Pragmatik
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das komplexe Phänomen der Ironie aus sprachwissenschaftlicher Perspektive. Sie beleuchtet verschiedene Definitionen, die historische Entwicklung und charakteristische Eigenschaften der Ironie. Ein Schwerpunkt liegt auf der Problematik der Einordnung von Ironie in sprachwissenschaftliche Kategorien und der Vorstellung verschiedener Erklärungsmodelle.
- Definition und Problematik des Ironiebegriffs
- Historische Entwicklung des Ironieverständnisses
- Charakteristische Eigenschaften und Merkmale der Ironie
- Sprachwissenschaftliche Ansätze zur Erklärung von Ironie
- Die Ironie als linguistisches Problem
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die sprachwissenschaftliche Betrachtung der Ironie. Sie erwähnt die divergierenden Ergebnisse sprachwissenschaftlicher Forschung zum Thema Ironie im Sprachgebrauch und deren sprachlicher Markierung. Die Arbeit gliedert sich in Definitionen und historische Entwicklung der Ironie, deren Eigenschaften und die Problematik ihrer Einordnung in sprachwissenschaftliche Kategorien. Schließlich werden verbreitete Erklärungsmodelle vorgestellt.
Der Begriff Ironie: Dieses Kapitel beginnt mit der Präsentation verschiedener Definitionen von Ironie, wobei der Aspekt der Verstellung als zentral hervorgehoben wird. Es wird jedoch auch die Limitation dieser Definitionen aufgezeigt, da Ironie mehr umfasst als lediglich das Gegenteil des Gemeinten auszudrücken. Die Arbeit illustriert die Schwierigkeiten der Einordnung von Ironie, da sie sich nicht auf alle Formen von Ironie anwenden lässt und konventionalisierte Ironie ausser Acht lässt. Die Grenzen der „Gegenteilsdefinition“ werden an Beispielen verdeutlicht, die den Kontext und die Sprechereinstellung als entscheidend für das Verständnis von Ironie hervorheben. Der Verstoß gegen Sprechaktbedingungen wird als weiterer wichtiger Aspekt diskutiert.
Ironie im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung des Ironieverständnisses. Es beginnt mit der Antike, in der die Ironie als Ausdruck des offenen Denkens im Kontext des Übergangs von Aristokratie zur Demokratie beschrieben wird. Sokrates wird als zentrale Figur hervorgehoben, dessen Methode der Erkenntnisgewinnung durch Dialoge und die damit verbundene sokratische Ironie detailliert erklärt werden. Das Kapitel betont die Bedeutung des Wandels gesellschaftlicher Normen und den Fokus auf den Menschen als wichtige Faktoren für die Entstehung der Ironie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachwissenschaftliche Analyse der Ironie
Was ist der Inhalt dieser sprachwissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Ironie aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Sie beinhaltet eine Einleitung, ein Inhaltsverzeichnis, die Definition und historische Entwicklung der Ironie, ihre charakteristischen Eigenschaften und die Schwierigkeiten ihrer Einordnung in sprachwissenschaftliche Kategorien. Darüber hinaus werden verschiedene Erklärungsmodelle vorgestellt, inklusive pragmatischer Ansätze wie der Theorie der konversationellen Implikatur und der Echoic Mention Theory.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter verschiedene Definitionen von Ironie und deren Problematik, die historische Entwicklung des Ironieverständnisses von der Antike über die Romantik bis zur Moderne, die charakteristischen Eigenschaften von Ironie (Indirektheit, Ironiesignale, Kontext- und Situationsabhängigkeit, Verstoß gegen Konversationsmaximen, Wertung, Humor/Komik, Sprachästhetik), sprachwissenschaftliche Ansätze zur Erklärung von Ironie (Pragmatik, Sprechakttheorie), sowie die sokratische Ironie.
Welche sprachwissenschaftlichen Ansätze werden zur Erklärung von Ironie vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene sprachwissenschaftliche Ansätze, um Ironie zu erklären. Im Fokus stehen pragmatische Theorien, insbesondere die Theorie der konversationellen Implikatur und die Echoic Mention Theory. Zusätzlich wird die Sprechakttheorie als Erklärungsmodell für Ironie diskutiert.
Wie wird die historische Entwicklung des Ironieverständnisses dargestellt?
Die historische Entwicklung der Ironie wird von der Antike (mit Fokus auf Sokrates und der sokratischen Ironie) über die Romantik bis zur Moderne nachgezeichnet. Der Wandel gesellschaftlicher Normen und der Fokus auf den Menschen als wichtige Faktoren für die Entstehung und Entwicklung von Ironie werden hervorgehoben.
Welche Probleme ergeben sich bei der sprachwissenschaftlichen Einordnung von Ironie?
Die Arbeit betont die Schwierigkeiten, Ironie in eindeutige sprachwissenschaftliche Kategorien einzuordnen. Die Grenzen traditioneller Definitionen, die sich oft auf den Gegensatz zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten konzentrieren, werden aufgezeigt. Die Kontext- und Situationsabhängigkeit von Ironie und der Verstoß gegen Konversationsmaximen stellen weitere Herausforderungen für eine umfassende sprachwissenschaftliche Beschreibung dar.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Begriff Ironie (inkl. Definitionen und Problematik), Ironie im Wandel der Zeit (Antike, Romantik, Moderne), Eigenschaften der Ironie, Ironie als linguistisches Problem (inkl. erster sprachwissenschaftlicher Ansätze und Erklärungsmodelle), Zusammenfassung.
- Quote paper
- Annekatrin Lau (Author), 2005, Die Ironie. Betrachtung aus linguistischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/136773