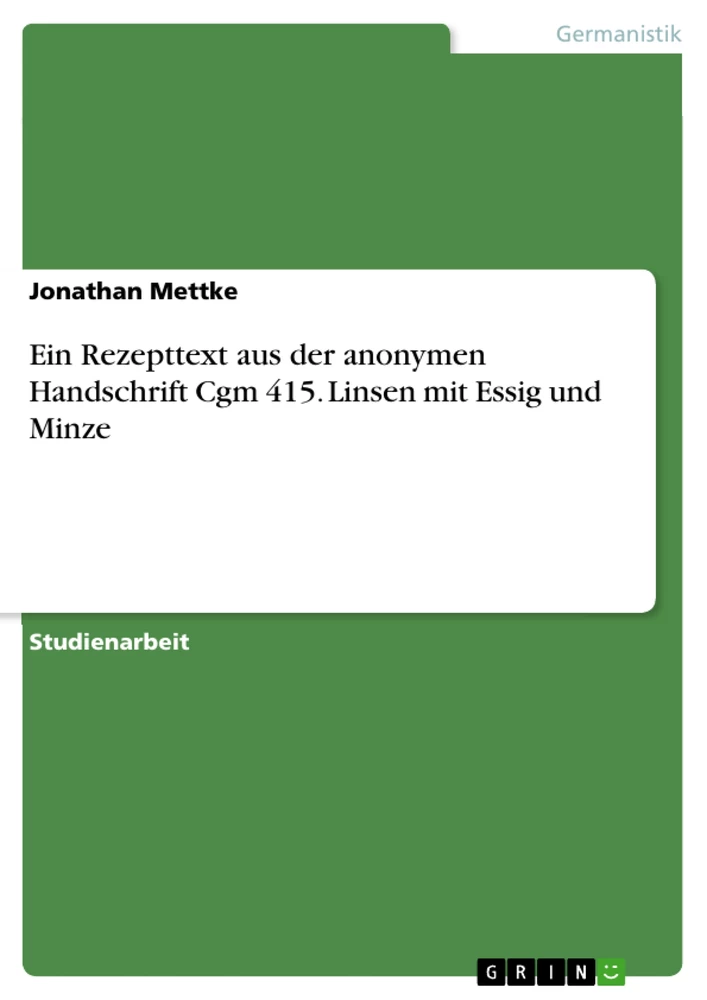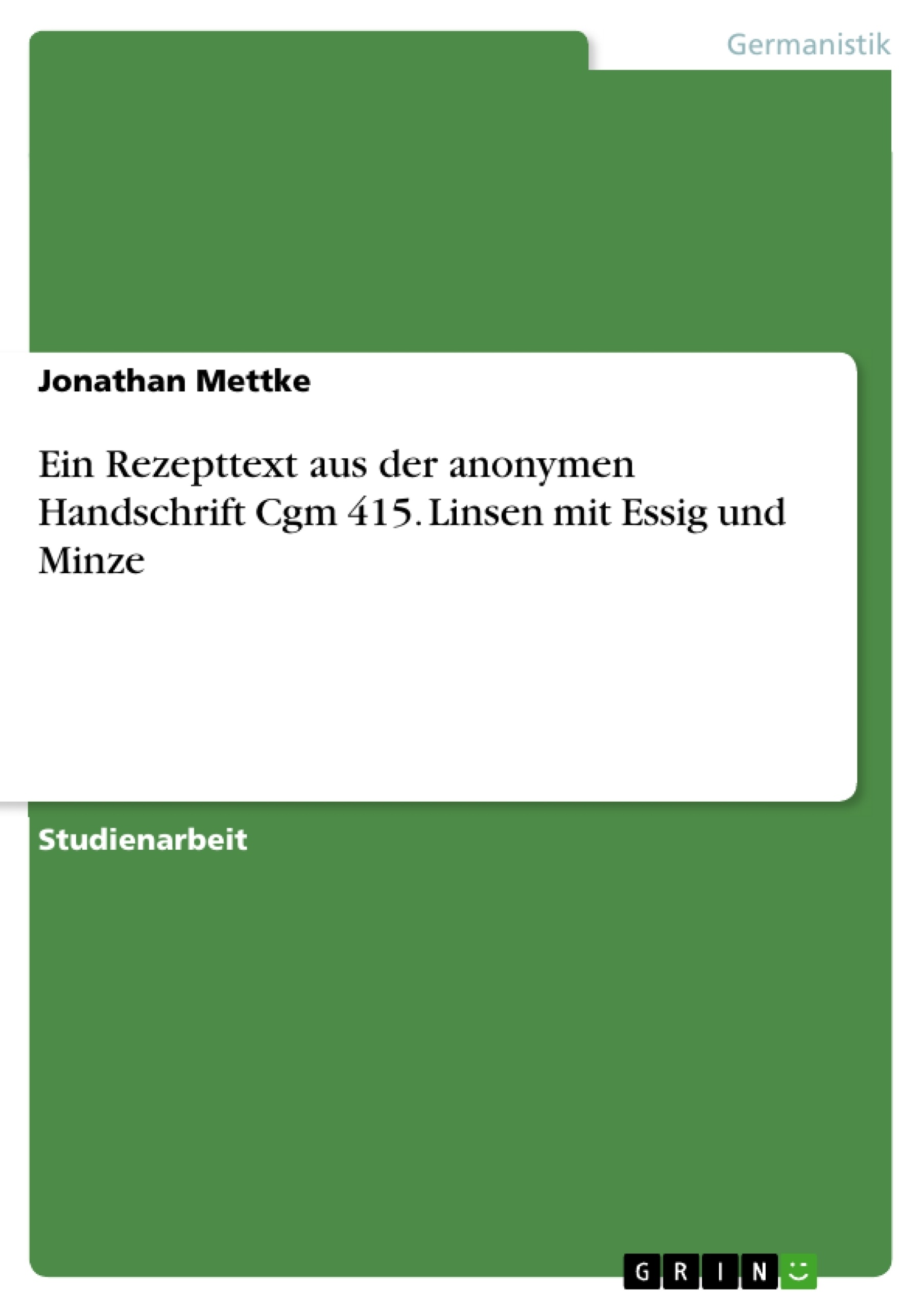Zentraler Forschungsgegenstand der vorliegenden Hausarbeit ist das 155. Rezept der in der Handschrift Cgm 415 eingepflegten anonymen Rezeptsammlung. Die Handschrift besteht aus zwei Faszikeln, die von zwei verschiedenen Verfassern stammen. Die erste der beiden Faszikel setzt sich aus vier verschiedenen Teilen zusammen, die jedoch thematisch eine gewisse Kohärenz aufweisen. Der erste Teil mit dem Titel "Das pitch von den chosten" klärt unter anderem nach den Regeln der Vier-Säfte-Lehre darüber auf, welche Lebensmittel in welcher Art und Weise konsumiert werden sollten, um bei Gesundheit bleiben, oder von Krankheiten geheilt werden zu können. Im zweiten Teil der Handschrift klärt die Abhandlung "De vindemiis" über die Lehre vom Weinbau auf.
Es folgt im dritten Teil jene anonyme Rezeptsammlung, die auch das in dieser Arbeit untersuchte Rezept beinhaltet. Insgesamt umfasst das Kochbuch mehr als 160 Kochrezepte.4 Den Abschluss der Handschrift bildet ein Heilmittellexikon, welches verschiedene Heilmittel in alphabetischer Reihenfolge auflistet und über deren Wirkungen und Anwendungen aufklärt.5 Die Handschrift wird in der Bayerischen Staatsbibliothek in München verwahrt. Eine nutzerfreundliche Lesefassung des darin enthaltenden Kochbuches wurde 2013 im Rahmen der Masterarbeit von Natascha Stefanie Chantal Guggi erstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Inhaltliche Erschließung des Rezepttextes
- Linsengerichte in anderen mittelalterlichen Quellen
- Die Linse in ihren Eigenschaften als Nahrungsmittel
- Arabische Kochrezeptsammlungen des Mittelalters
- Europäische Kochrezeptsammlungen des Mittelalters und der Antike
- Linsengerichte in der (frühen) Neuzeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Rezept Nr. 155 einer anonymen mittelalterlichen Rezeptsammlung (Handschrift Cgm 415, Bayerische Staatsbibliothek München). Ziel ist die inhaltliche Erschließung des Rezeptes, einschließlich der Analyse der verwendeten Zutaten und ihrer Bedeutung im Kontext der mittelalterlichen Ernährung und Medizin.
- Analyse des mittelalterlichen Linsenrezeptes und seiner Zubereitung
- Interpretation der verwendeten Zutaten im Kontext der mittelalterlichen Medizin (Humoralpathologie)
- Vergleich mit anderen mittelalterlichen Linsengerichten und Quellen
- Untersuchung der geschichtlichen und kulturellen Bedeutung von Linsen als Nahrungsmittel
- Erläuterung mittelhochdeutscher Fachbegriffe
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung: Diese Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit: Rezept Nr. 155 aus der Handschrift Cgm 415, eine anonyme mittelalterliche Rezeptsammlung, wird als zentraler Forschungsgegenstand vorgestellt. Die Handschrift selbst wird kurz beschrieben, mit ihren verschiedenen Teilen und dem Kontext innerhalb der Bayerischen Staatsbibliothek. Die Arbeit von Natascha Stefanie Chantal Guggi (2013) als Grundlage für die Lesefassung des Rezeptes wird erwähnt.
Inhaltliche Erschließung des Rezepttextes: Dieses Kapitel präsentiert den Rezepttext in mittelhochdeutscher und neuhochdeutscher Fassung. Es folgt eine detaillierte Analyse des Rezeptes, unterteilt in fünf Abschnitte: die Einstiegsformel, die Zubereitung (mit den Schritten des Schälen, Kochens und der Zugabe verschiedener Zutaten), Hinweise zur Verfeinerung des Gerichtes, die Benennung des Gerichts ("Almansar") und eine Schlussformel mit einer Variante ("Tasil"). Die Bedeutung schwer zu deutender Begriffe wie "Agrest" und "Obsomagora" wird ausführlich erörtert und mit Bezug auf verschiedene Quellen erläutert.
Linsengerichte in anderen mittelalterlichen Quellen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Eigenschaften von Linsen als Nahrungsmittel im Mittelalter, im Kontext der Humoralpathologie. Die Primärqualitäten der Linse (kalt und trocken) und ihre Auswirkungen auf die vier Körpersäfte werden erläutert. Die Kapitel beschreibt die in mittelalterlichen Quellen beschriebenen positiven und negativen Wirkungen von Linsen auf den menschlichen Körper und gibt Hinweise zur Zubereitung, um die negativen Effekte zu mindern und die positiven zu verstärken.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Kochrezepte, Handschrift Cgm 415, Linsengericht, mittelhochdeutsche Sprache, Humoralpathologie, Ernährung im Mittelalter, Agrargeschichte, Gewürze, Heilmittel, medizinische Fachtermini, "Agrest", "Obsomagora", Rezeptanalyse, Sprachgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur mittelalterlichen Rezeptsammlung Cgm 415, Rezept Nr. 155
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Rezept Nr. 155 aus der anonymen mittelalterlichen Rezeptsammlung Cgm 415 der Bayerischen Staatsbibliothek München. Der Fokus liegt auf der inhaltlichen Erschließung des Rezeptes, der Analyse der Zutaten und deren Bedeutung im Kontext der mittelalterlichen Ernährung und Medizin.
Welche Aspekte werden im Einzelnen untersucht?
Die Analyse umfasst die detaillierte Untersuchung des Rezepttextes (mittelhochdeutsch und neuhochdeutsch), die Interpretation der Zutaten im Hinblick auf die Humoralpathologie, einen Vergleich mit anderen mittelalterlichen Linsengerichten, die geschichtliche und kulturelle Bedeutung von Linsen als Nahrungsmittel und die Erklärung mittelhochdeutscher Fachbegriffe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Hinführung, die inhaltliche Erschließung des Rezepttextes, einen Abschnitt über Linsengerichte in anderen mittelalterlichen Quellen (inkl. arabischen und europäischen Quellen und der Besprechung der Eigenschaften von Linsen als Nahrungsmittel) und einen Abschnitt über Linsengerichte in der frühen Neuzeit. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist Rezept Nr. 155 der Handschrift Cgm 415. Zusätzlich werden andere mittelalterliche Kochrezeptsammlungen (arabische und europäische), sowie relevante Literatur zur mittelalterlichen Ernährung, Medizin und Sprachgeschichte herangezogen. Die Arbeit von Natascha Stefanie Chantal Guggi (2013) dient als Grundlage für die Lesefassung des Rezeptes.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Mittelalterliche Kochrezepte, Handschrift Cgm 415, Linsengericht, mittelhochdeutsche Sprache, Humoralpathologie, Ernährung im Mittelalter, Agrargeschichte, Gewürze, Heilmittel, medizinische Fachtermini, "Agrest", "Obsomagora", Rezeptanalyse, Sprachgeschichte.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung besteht in der umfassenden inhaltlichen Erschließung des mittelalterlichen Linsenrezeptes, einschließlich der Interpretation der Zutaten und der Einordnung in den historischen Kontext der mittelalterlichen Ernährung und Medizin. Der Vergleich mit anderen Quellen soll die Bedeutung dieses spezifischen Rezeptes verdeutlichen.
Welche Bedeutung haben die verwendeten Zutaten im Kontext der Humoralpathologie?
Die Arbeit erläutert die Bedeutung der im Rezept verwendeten Zutaten im Kontext der mittelalterlichen Humoralpathologie. Die Primärqualitäten der Linse (kalt und trocken) und deren Auswirkungen auf die vier Körpersäfte werden diskutiert, sowie Möglichkeiten der Zubereitung zur Optimierung der Wirkung.
Wie wird der Rezepttext präsentiert und analysiert?
Der Rezepttext wird sowohl in mittelhochdeutscher als auch in neuhochdeutscher Fassung präsentiert. Die Analyse gliedert sich in Abschnitte zu Einstiegsformel, Zubereitungsschritten, Hinweise zur Verfeinerung, Namensgebung des Gerichts ("Almansar") und Schlussformel mit Varianten ("Tasil"). Schwierige Begriffe wie "Agrest" und "Obsomagora" werden detailliert erklärt.
- Quote paper
- Jonathan Mettke (Author), 2023, Ein Rezepttext aus der anonymen Handschrift Cgm 415. Linsen mit Essig und Minze, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1365220