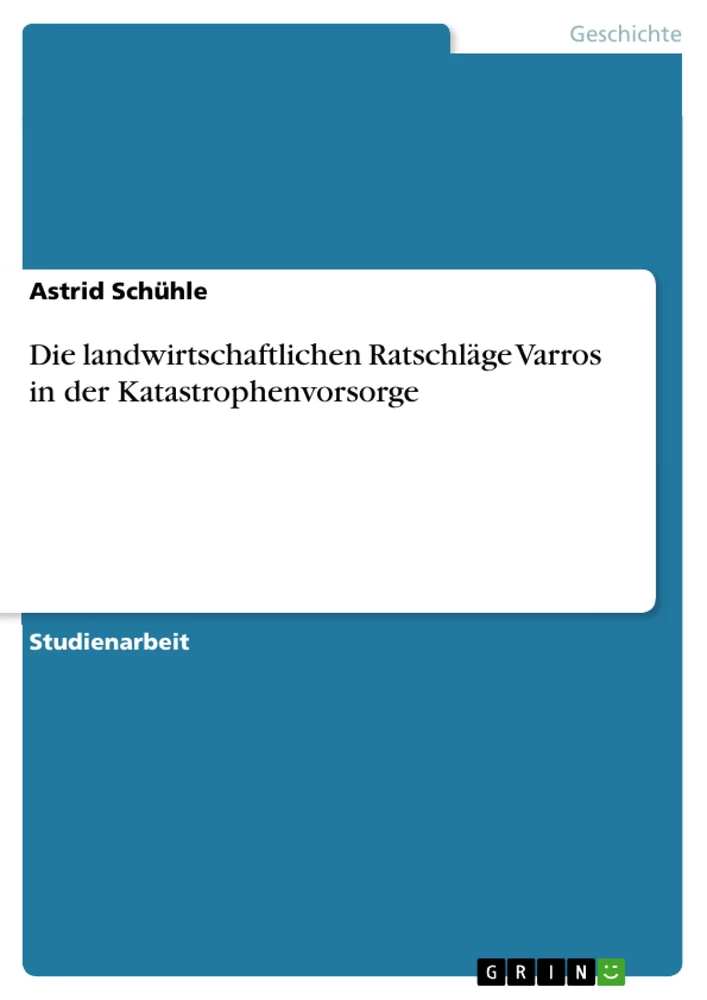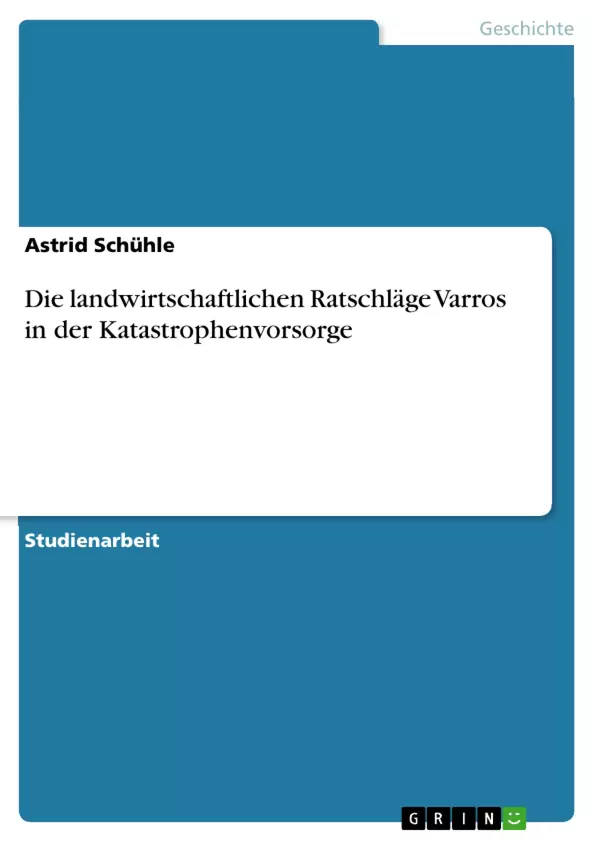37 v.Chr. schrieb Marcus Terentius Varro seine Trilogie De re rustica. In diesem Buch legte er nicht nur landwirtschaftliche Grundsätze dar, sondern auch Planungsempfehlungen für die Anlage eines Gutshofes. Varro erläuterte welche Pflanzen auf welchem Boden und welcher Lage angebaut und wie welche Tiere gehalten und vermehrt werden sollten. Dabei deckte er alle für diese Region landwirtschaftlich relevanten Tiere, vom Rind bis zur Schnecke ab.
In dieser Arbeit werden ausgewählte Ratschläge Varros auf ihren Nutzen zur Katastrophenvorsorge hin geprüft. Dazu werden acht Ratschläge aus allen drei Büchern vorgestellt und deren Inhalt erläutert. Diese acht Quellen stammen aus allen drei Büchern und decken die Teilbereiche Gutsplanung, Ackerbau und Tierhaltung ab. Nach einem Überblick darüber, an wen Varro sich mit seinen Büchern wandte und den historischen Kontext wird kurz auf die Form der Bücher eingegangen. Im Anschluss werden anhand der acht ausgewählten Quellen auf ihren Nutzen in der Vorsorge hin untersucht. Dazu werden verschiedene Kategorien der Vorsorge geschaffen und die ausgewählten Quellen in diese einsortiert, um dann einzuschätzen, wie weit sich Varros Werk tatsächlich eignet, sich vor Katastrophen zu schützen.
Neben Übersetzungen des Buches, zum Beispiel durch Flach, ist das Leben Varros und damit auch seine Erfahrungen im landwirtschaftlichen Bereich gut dokumentiert, unter anderem in den Werken von Ax. Fellmeth und Bommer haben sich außerdem intensiv mit der Ernährung in der Antike beschäftigt und zur modernen Landwirtschaft gibt es ebenso zahlreiche Literatur, zum Beispiel von Diepenbrock.
Inhalt
1. Einleitung
2. Inhaltsangabe
3. Analyse und Interpretation
3.1. Adressaten
3.2. Historischer Kontext
3.3. StilundSprache
3.4. Aussagen und Argumente
4. Bewertung
5. Quellen- und Literaturverzeichnis
5.1. Quellen
5.2. Literatur
1 Einleitung
37 v.Chr. schrieb Marcus Terentius Varro seine Trilogie De re rustica. In diesem Buch legte er nicht nur landwirtschaftliche Grundsätze dar, sondern auch Planungsempfehlungen für die Anlage eines Gutshofes. Varro erläuterte welche Pflanzen auf welchem Boden und welcher Lage angebaut und wie welche Tiere gehalten und vermehrt werden sollten. Dabei deckte er alle für diese Region landwirtschaftlich relevanten Tiere, vom Rind bis zur Schnecke ab.
In dieser Arbeit werden ausgewählte Ratschläge Varros auf ihren Nutzen zur Katastrophenvorsorge hin geprüft. Dazu werden acht Ratschläge aus allen drei Büchern vorgestellt und deren Inhalt erläutert. Diese acht Quellen stammen aus allen drei Büchern und decken die Teilbereiche Gutsplanung, Ackerbau und Tierhaltung ab. Nach einem Überblick darüber, an wen Varro sich mit seinen Büchern wandte und den historischen Kontext wird kurz auf die Form der Bücher eingegangen. Im Anschluss werden anhand der acht ausgewählten Quellen auf ihren Nutzen in der Vorsorge hin untersucht. Dazu werden verschiedene Kategorien der Vorsorge geschaffen und die ausgewählten Quellen in diese einsortiert, um dann einzuschätzen, wie weit sich Varros Werk tatsächlich eignet, sich vor Katastrophen zu schützen.
Neben Übersetzungen des Buches, zum Beispiel durch Flach1, ist das Leben Varros und damit auch seine Erfahrungen im landwirtschaftlichen Bereich gut dokumentiert, unter anderem in den Werken von Ax2. Fellmeth3 und Bommer4 haben sich außerdem intensiv mit der Ernährung in der Antike beschäftigt und zur modernen Landwirtschaft gibt es ebenso zahlreiche Literatur, zum Beispiel von Diepenbrock.5
Marcus Terentius Varro
Marcus Terentius Varro wurde 116 v. Chr. geboren, entweder in Reate oder in Rom. Aufgewachsen sei er laut Ax jedoch in Rom, allerdings sei über seine Eltern nichts bekannt und auch nicht über deren Stand. Im Anschluss an eine politische und militärische Karriere war Varro fast 30 Jahre lang ungestört schriftstellerisch tätig und verstarb fast neunzigjährig. Ein Großteil seiner Schriften ist verloren gegangen, einen Überblick zumindest über die Anzahl und Titel der von ihm geschaffenen Werke verschafftjedoch ein Katalog des Hieronymus: 74 Schriften in rund 620 Büchern.6
De re rustica
Varros De re rustica stellt in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahme in seinen Werken dar. Zum einen, weil die meisten seiner Werke kultur- oder sprachwissenschaftliche Werke oder Dichtungen waren, zum anderen aber auch, weil sie das einzige vollständig erhaltene Werk Varros sind.7
Die De re rustica besteht aus insgesamt drei Büchern, die thematisch aufgeteilt worden sind. Das erste Buch ist am umfangreichsten und beschäftigt sich mit dem Ackerbau und mit der Planung des Gutes. Das zweite Buch handelt von den größeren Nutztieren wie Rindern und das dritte Buch von Hoftieren wie Geflügel.
Grundlage für seine Bücher bildeten die ursprünglich 28 Bücher des Mago, Cassius Dionysius hatte diese zu 20 Bücher zusammengefasst. Diophanes von Nikaia kürzte diese wiederum zu sechs Bänden zusammen, aus denen Varro die vorliegenden 3 Bücher schuf.8
2 Inhaltsangabe
Bei den ausgewählten Quellen handelt es sich um insgesamt acht verschiedene Ausschnitte aus allen drei Büchern. Diese wurden zur übersichtlicheren Bearbeitung hier in drei Kategorien eingeteilt.
Gutsplanung
In den beiden ausgewählten Quellen dieser Kategorie gab Varro Hinweise darauf, was beim Bau des Hofgebäudes beachtet werden müsse. Dafür geht er zum einen auf die grundsätzliche Lage des Gutsgebäudes ein, es sollte am Ausläufer eines bewaldeten Berges liegen. Unmittelbare Nähe zu einem Fluss sollte genauso wie sumpfiges Gelände gemieden werden.9 Außerdem erklärt er, dass die Ausrichtung sowohl des Gutshauses an sich als auch von dessen Fenstern, Türen und Säulenumgängen sachgerecht geplant werden müsste.10
Ackerbau
In zwei von den drei hier ausgewählten Quellen geht es um die richtige Auswahl der Pflanzen. Dazu teilte Varro zum einen das Gelände grundsätzlich in drei Höhenlagen ein: das Flachland, das Hügelland und das Bergland. Er wies darauf hin, dass bei der Auswahl der Anpflanzungen die jeweilige Höhenlage aufgrund klimatischer Unterschiede berücksichtigt werden müsse.11 Zum anderen ging er darauf ein, wie sonnig oder schattig ein Anbaugebiet und damit zusammenhängend, wie hoch die Bodenfeuchtigkeit sei.12
In der dritten Quelle beschrieb Varro dagegen jahreszeitabhängige Aufgaben: die Bodenvorbereitung im Frühjahr, das Mähen im Sommer, die Weinlese im Herbst und das Beschneiden von Bäumen im Winter. Zusätzlich nannte er weitere Kriterien für die jeweiligen Tätigkeiten, zum Beispiel trockenes Wetter oder Regen.13
Tierhaltung
In den letzten drei Quellen gab Varro Ratschläge für die Tierhaltung. Er benannte konkrete Begattungszeiträume, unter anderem mit Hilfe des Auf- und Untergangs von Sternen und Sternbildern.14 Weiterhin erläuterte er die Standortbedingungen für eine erfolgreiche Schneckenzucht, diese sollten einen schattigen, tauigen Platz haben.15 Im letzten Abschnitt ging Varro auf die Häufigkeit der Honigernte und deren Einschränkungen ein.16
3 Analyse und Interpretation
3.1 Adressaten
In der Einleitung zum ersten Band der De re rustica gab Varro selber Auskunft darüber, wann und für wen er alle drei Bücher schrieb. So schrieb er, dass er selbst bereits 80 Jahre alt sei, was das Jahr auf 36 v.Chr. festlegt und widmete alle drei Bücher seiner Ehefrau Fundania.17 Im zweiten Band dagegen nahm er diese Widmung teilweise wieder zurück und beschränkte sie nachträglich auf den ersten Band. Den Zweiten beschrieb er jetzt als Gefallen für seinen Freund Turranius Niger,18 den dritten Band widmete er seinem Freund Pinnius.19
Flach begründet Varros Änderung der Widmung seiner Bücher damit, dass entweder die Namen oder das Betätigungsfeld mit dem Inhalt des jeweiligen Buches übereinstimmt. Seine Frau Fundania hatte sich gerade einen fundus, ein Gut, gekauft, ihr wurde das Buch über den Ackerbau gewidmet. Turranius Niger war durch die Herdenwirtschaft zu seinem Vermögen gekommen, ihm wurde das Buch über dir Großviehhaltung gewidmet. Und bei Pinnius sieht Flach eine Verbindung zu pinna, der Feder. Ihm wurde das Buch, dass unter anderem von Geflügelhaltung handelt, gewidmet.20
Insgesamt ist erkennbar, dass sich De re rustica an Gutsbesitzer oder Gutsverwalter richtet. Nicht nur die Widmungen sind ein deutlicher Hinweis. Die Bücher beinhalten zwar ausführliche Anweisungen welche Tätigkeiten wann erledigt werden sollten, es fehlt aber die Anleitung wie diese Tätigkeiten durchzuführen sind. Einen Nutzen ziehen daher nur diejenigen Personen aus den Büchern, die mit den planerischen Aspekten eines Gutes beauftragt sind. Dabei sind die Ratschläge trotzdem sehr präzise, in 1,17,2 geht Varro zum Beispiel genau darauf ein, wie der Boden im Frühjahr vorbereitet muss und welchen konkreten Zweck diese Einzeltätigkeit hat.
3.2 Historischer Kontext
Obwohl Varro alle drei Bücher laut seinen eigenen Angaben in einem engen zeitlichen Zusammenhang entworfen und geschrieben hatte, führen Unregelmäßigkeiten wie zum Beispiel die Änderungen in der Widmung dazu, dass über den tatsächlichen Zeitpunkt des Schreibens diskutiert wird. Dieter Flach führt René Martin als einen Vertreter derjenigen Geschichtswissenschaftler an, die vermuten, dass Varro das erste Buch bereits 55 v. Chr. verfasst habe. Dass Zweite sei demnach irgendwann zwischen 55 und 37 v. Chr. geschrieben worden. Wenn das erste Buch gemäß Martins Argumentation 55 v.Chr. geschrieben wurde, dann verschiebt sich das Gespräch, dass laut Varros Aussage „neulich“ geführt wurde von vor 37 v. Chr. auf vor 56 v. Chr. Der Begründung Martins, dass Varro sich auf Lucullus beziehe und dieser daher zu diesem Zeitpunkt noch leben müsse, widerspricht Flach. Er argumentiert, dass Lucullus Ruf noch so bekannt sei, dass Varro sich durchaus auch nach seinem Tod noch auf ihn beziehen könnte. Flachs Hauptargument ist jedoch der Mangel an Fehlern in der Zeitebene. Alle anderen Schriftstellern, selbst Cicero, seien Wechsel in der Zeitebene unterlaufen, wenn sie nachträglich Dialoge in der Vergangenheit ansiedelten. Solche Fehler seien Varro in keinem seiner drei Bände nachzuweisen.21
Flach schlussfolgert also, dass Varro alle drei Bücher in kurzem zeitlichem Abstand 37 v. Chr. geschrieben habe. Dementsprechend siedelt er das Gespräch, dass im ersten Bandwiedergegeben wird zwischen 45 v. Chr. und 37 v. Chr. an. Argumente, die beweisen sollen, dass das Buch schon früher geschrieben wurde lehnt er damit ab, dass sie darauf beruhen, dass Varro Fehler in den Zeitebenen unterliefen. Durch die Tatsache, dass Varros eigene Aussage eben keine Fehler verursacht, gilt es für Flach damit als naheliegender, dass alle drei Bücher in nur kurzem zeitlichem Abstand geschrieben wurden.
Er weist ebenfalls daraufhin, dass der krampfhafte Versuch, nur grob umschriebene Geschehnisse unpassenden Ereignissen zuzuordnen, offensichtlich fehlerbehaftet sei. Als Beispiel nennt er hier die Aussage, dass Varro seinen Stab und seine Sklaven auf Korfu vor einer Seuche geschützt hätte. Heurgon behauptet, dass sich diese Aussage auf den Seeräuberkrieg bezogen hätte. Flach argumentiert jedoch, dass dieser im Frühjahr stattgefunden habe, eine Jahreszeit eher untypisch für Seuchen. Der Bürgerkrieg dagegen passe jahreszeitlich zu den zeitlichen Angaben Varros.22
3.3 Stil und Sprache
Varros gesamtes Werk De re rustica ist geprägt durch Varros Aussage gleich zu Beginn der Einleitung, dass er sich aufgrund seiner bereits 80 Lebensjahre besonders beeilen müsse23 und dies spiegelt sich in allen drei Bänden wider. Das Ergebnis führt zu einer gemischten Rezeption. So lobte Columella Varros Werk für den Fortschritt in der Darstellungsform, die drei Bücher bestehen aus einer Mischung verschiedener literarischer Formen. Neben dem aristotelischen und herakleidischen Dialog finden sich auch immerwiederTextteile im Stil der mennipeischen Satire.24
Quintilian und Augustinus dagegen warfen ihm fehlende Sorgfalt mit den daraus entstehenden Mängeln vor.25 Flach weist ihm häufige Wechsel vom Singular ins Plural nach, ebenso habe Varro das Subjekt oft entweder gar nicht erst benannt oder dessen Wechsel nicht angezeigt. Neben einem regelmäßigen Wechsel zwischen der Hochsprache und der Umgangssprache wirken einige Passagen geradezu geschwollen in ihrer Ausdrucksweise, so ließ er die Bodenarten ihre verschiedenen Stufen „erklimmen“.26
Die Flüchtigkeit in Varros Arbeit wird laut Flach auch deutlich, wenn er während des Schreibens seine eigenen Pläne für die Struktur des Buches wechselt.27 So habe Varro mehrfach Informationen angekündigt und diese dann später vergessen, Quellen gebe er oft nur ungenau wieder. Dies weise darauf hin, dass Varro seine Bücher ohne Vorausplanung schuf, statt eine vorher ausgearbeitete Struktur zu nutzen.28 Flach vermutet daher, dass Varro seine Bücher einem Schreiber hastig diktierte und sich auch nicht die Zeit genommen hätte, diese am Ende durchzusehen und zu überarbeiten. Dies sei aber kein neues oder ungewöhnliches Verhalten gewesen, sondern bereits in anderen Werken Varros erkennbar.29 Zusammenfassend beschreibt Flach De re rustica als einen Text, das in seiner Form und seinem Inhalt Varros Persönlichkeit und Erfahrungen als Politiker, Militär, Gutsbesitzer und Gelehrter widerspiegelt.30
3.4 Aussagen und Argumente
Bei den Ratschlägen Varros ist grundsätzlich zu beobachten, dass er zwar beschreibt Was getan werden muss, aber nicht Wie. Gleichzeitig gibt er nur selten, und wenn dann nur sehr kurz, ein Warum an.31 Es bleibt bei dem übergeordneten Zweck, den Varro gleich am Anfang angegeben hat: Möglichst ertragreiches Wirtschaften.32
Gutsplanung
Die Ratschläge Varros lassen sich grob in zwei Teile untergliedern. Zum einen die Ratschläge, mit deren Hilfe von vornherein ein optimaler Standort für ein Gutshaus gewählt werden soll. Zum anderen diejenigen, mit denen standortbedingte Nachteile ausgeglichen werden sollen. Ein Gutshaus sollte so am Ausläufer eines bewaldeten Berges liegen, dass es im Winter möglichst sonnig liege und im Sommer möglichst schattig. Die erhöhte Lage schützt vor Überschwemmungen und wenn der Berg bewaldet ist33, schützt dies vor Erdrutschen. Außerdem hilft die Lage, das Klima im Haus zu regulieren. Sumpfige Gebiete sollte man genauso wie Flussufer meiden, im Sommer sei es sonst schwül und im Winter kühle die Luft stark ab. Außerdem berge der Sumpf viele Krankheitserreger.34
Zum Ausgleich vorhandener Nachteile forderte Varro zu baulichen Maßnahmen auf. Dazu wies er darauf hin, dass auch die Lage von Türen und Fenstern bedeutend sei. Diese sollten nicht in Richtung des Flussufers gebaut sein und bei Bedarf verlegt werden.35 36 37
Ackerbau
Im Bereich des Ackerbaus werden beispielhaft drei unterschiedliche Quellen aus dem ersten Buch betrachtet. Varro gab unterschiedliche Kriterien vor, wie das Land eingeteilt werden solle. Diese überlappen sich gegenseitig und sollten helfen, zu entscheiden, welche Pflanzen an welchen Ort angebaut werden. Dazu unterteilte er das Land unter anderem in unterschiedliche Höhenlagen und nach Besonnung sowie Bodenfeuchtigkeit. Für beide Einteilungen gab er im Anschluss konkrete Vorschläge, welche Pflanzen am besten geeignet wären. So wurde im Abschnitt über die Höhenlagen das Flachland als geeignet für Saatfelder ausgewiesen, die, wenn sie überwiegend trockenen Boden haben, für Bohnen genutzt werden sollten. Wenn sie schattig liegen, solle Spargel angebaut werden und nur wenn sie sonnig liegen, solle Gemüse angebaut werden.[36],[37] So baute Varro im Laufe des Textes ein Schema auf, dass mit aktuellen landwirtschaftlichen Grundsätzen konform ist38 und mit dessen Hilfe auch ein unerfahrener Gutsbesitzer Entscheidungen treffen konnte.
Neben Anbauratschlägen gab Varro außerdem Hinweise zu Tätigkeiten, die auf einem Gut anfallen. Auch diese wurden nach unterschiedlichen Kriterien eingeteilt, unter anderen nach dem Zeitraum, in dem sie anfallen. Genannte Einteilungen sind unter anderem der Mondumlauf, also der Monat, und die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten selbst decken jeweils drei Monate ab und bildeten damit einen großen Zeitrahmen, für die genannten Tätigkeiten. Hier ließ Varro einen großen Spielraum zu, den er durch das Wetter einschränkte. So grenzte er den Zeitraum für das Pflügen auf mehrere, aufeinanderfolgende sonnige Tage ein, die Weinlese solle bei trockenem Wetter stattfinden und der Baumschnitt nach dem Regen.39
Tierhaltung
Auch im Rahmen der Tierhaltung werden drei unterschiedliche Quellen betrachtet. Im ersten Ausschnitt gab Varro genaue Anweisungen, zu welchem Zeitpunkt Schafe und Schweine begattet werden sollen. So sollen Sauen bis Ende März begattet werden, sie tragen dann etwa 4 Monate und ferkeln Ende Juli. Gesäugt werden die Ferkel dann zwei Monate,40 und erst zu diesem Zeitpunkt sei das Grünfutter im Herbst wieder kräftig genug, so dass die Sau reichhaltige Milch produzieren kann.41 Das Schaf dagegen soll zwischen September und Dezember begattet werden. Es trägt 5 Monate und säugt dann für 4 weitere Monate. Hier legte Varro den Zeitpunkt der Begattung so, dass die Mutterschafe im Frühjahr neues Gras fressen können und das milde Wetter die Lämmer schont.42
Im zweiten Ausschnitt geht Varro auf die Haltungsbedingungen von Schnecken ein, so erläuterte er die natürlichen Bedingungen, die für eine erfolgreiche Haltung notwendig wären. Der Platz sollte schattig und tauig sein, falls kein geeigneter Platz vorhanden sei, müsse dieser von Hand angelegt werden.43
Im dritten Ausschnitt behandelte Varro die Bienenernte. Hier nannte er Vorgaben zu drei Zeiträumen, in denen Honig dem Stock entnommen werden könne, und zwar Ende Mai, am Sommerende und im November mit Einschränkungen. Wieviel Honig dann entnommen werden dürfe, sei von der Ergiebigkeit des Stocks abhängig. Das Maximum wäre jedoch ein Drittel, einem nicht so ertragreichen Stock dürfe gar nichts entnommen werden. Diesen Honig bräuchte der Stock, um sicher überwintern zu können und so auch eine zukünftige Ernte zu ermöglichen.44
4 Bewertung
Anhand der diskutierten Auswahl an Ratschlägen Varros lassen sich diese mit Bezug auf die Katastrophenvorsorge in direkte, lang- oder kurzfristig wirkende Maßnahmen und indirektwirkende Maßnahmen einteilen.
Die Ratschläge sowohl zur Lage als auch zur Bauweise der Gutsgebäude sind direkte, langfristige Vorsorgemaßnahmen. Einmal gebaute Gebäude lassen sich nur kostenintensiv ändern oder ganz neu anlegen. Diese Ratschläge müssen zwar bereits in der Planungsphase des Guts berücksichtigt werden, gewähren dafür aber langfristig Schutz. So bietet die von Varro vorgeschlagene Lage des Gutshauses dauerhaft sowohl Schutz vor Hochwasser als auch vor Erdrutschen. Dieser Schutz betrifft nicht nur das Leben und die Gesundheit der Bewohner, sondern auch die dort lagernden Vorräte. Der erlangte Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen, ist ebenfalls dauerhaft verfügbar und verringert das Risiko an Erkrankungen und an verderbenden Vorräten.
Als direkte, aber nur kurzfristig wirksame Ratschläge, lassen sich die Ratschläge bezeichnen, die der Lebensmittelversorgung dienen. Sie müssen jedes Jahr aufs Neue berücksichtigt werden, wirken deshalb nur kurzfristig statt dauerhaft. Am wichtigsten sind an dieser Stelle, die Ratschläge, die helfen zu entscheiden wo Getreide angebaut werden soll und was beim Anbau berücksichtigt werden muss, da Getreide das Hauptnahrungsmittel war.45 46 47 Schweinefleisch stellte die beliebteste Fleischsorte dar[46],[47] und dementsprechend wichtig war eine ausreichende Nachzucht. Da Fleisch aber keine alltägliche Nahrungsquelle war, sondern eher Zukost48 waren die Ratschläge zum Getreideanbau wichtiger.
Als letzte Gruppe zählen die Ratschläge, die in erster Linie indirekte Vorsorgemaßnahmen betreffen. Dazu zählen zum einen die Produkte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, sondern aufgrund ihres hohen Marktwertes hergestellt werden, wie Schnecken oder Honig. Zum anderen zählen dazu Produkte wie Wolle, die zwar nicht täglich, aber doch regelmäßig benötigt wurden. Sie waren aber im Katastrophenfall nicht zum Überleben notwendig.
Zusammenfassend fällt auf, dass Varro die Problematik der Katastrophenvorsorge nur im Bereich der Krankheiten direkt anspricht. Andere Problematiken, wie Überschwemmungen oder Erdrutsche werden nicht erwähnt, obwohl Teile seiner Ratschläge so konzipiert sind, dass sie das Risiko mindern, von solchen Katastrophen betroffen zu werden. Die erste der drei Gruppen eben, indem das Risiko gemindert wird Katastrophensituationen ausgesetzt zu werden. Die zweite, indem sie witterungs- oder auch jahreszeitlich bedingten Verlusten und dadurch entstehenden Hungersnöten vorbeugt. Die letzte Gruppe ist im Rahmen der Katastrophenvorsorge nur indirekt hilfreich, da sie ermöglichen finanzielle Reserven anzulegen und so im Katastrophenfall dringend benötigte Waren einzukaufen.
Dieser Überblick zeigt, dass alle Ratschläge in der De re rustica einzeln bewertet werden müssen und deren Nutzen stark schwankt. So kann auch keine pauschale Aussage getroffen werden, wie nützlich diese drei Bücher für die Katastrophenvorsorge sind. Das hängt immer von weiteren Faktoren, wie der Katastrophe, vor der geschützt werden soll, ab und vom jeweiligen Quellenausschnitt.
5 Quellen- und Literaturverzeichnis
5.1 Quellen
Flach, Dieter: Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft.
Darmstadt 1996, 1997, 2002.
Flach, Dieter: Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft. Buch 1.
Darmstadt 1996.
Flach, Dieter: Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft. Buch 2.
Darmstadt 1997.
5.2 Literatur
Ax, Wolfram: Lateinische Lehrer Europas. Fünfzehn Portraits von Varro bis Erasmus von Rotterdam. Köln 2005.
Bommer, Sigwald: Die Ernährung der Griechen und Römer. Planegg 1943.
Diepenbrock, Wulf und Ellmer u.a.: Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung: Grundwissen Bachelor. Stuttgart 2016.
Fellmeth, Ulrich: Brot und Politik : Ernährung, Tafelluxus und Hunger im antiken Rom. Stuttgart [u.a.] 2001.
Flach, Dieter: RömischeAgrargeschichte. München 1990.
Metzger, Birgit: Erst stirbt der Wald, dann du!: Das Waldsterben als westdeutsches Politikum (1978-1986). Frankfurt 2015.
[...]
1 Dieter Flach: Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft. Darmstadt 1996, 1997, 2002.
2 Wolfram Ax: Lateinische Lehrer Europas. Fünfzehn Portraits von Varro bis Erasmus von Rotterdam. Köln 2005.
3 Ulrich Fellmeth: Brot und Politik : Ernährung, Tafelluxus und Hunger im antiken Rom. Stuttgart [u.a.] 2001.
4 Sigwald Bommer: Die Ernährung der Griechen und Römer. Planegg 1943.
5 Wulf Diepenbrock und Ellmer u.a.: Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung: Grundwissen Bachelor. Stuttgart 2016.
6 Ax, Lateinische Lehrer Europas, S. 1-4.
7 Ax, Lateinische Lehrer Europas, S. 5-10.
8 Dieter Flach: Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft. Buch 2. Darmstadt 1997, S. 7.
9 Varro rust. 1,12,1
10 Varro rust. 1,4,4
11 Varro rust. l,6,2-6
12 Varro rust. 1,23,5
13 Varro rust. 1,27,2-3
14 Varro rust. 2,1,18
15 Varro rust. 3,14,2
16 Varro rust. 3,16,34
17 Varro rust. 1,1,1.
18 Varro rust. 2, praef. 6.
19 Varro rust. 3,1,9.
20 Dieter Flach: Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft. Buch 1. Darmstadt 1996, S. 8f.
21 Flach, Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft. Buch 1, S. 10-12.
22 Flach, Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft. Buch 1, S. 7-15.
23 Varro rust. 1,1,1.
24 Flach, Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft. Buch 1, s. xi.
25 Ebd., S. 36f.
26 Varro rust. 1,9,3.
27 Flach, Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft. Buch 1, s. 37-42.
28 Ebd., s. 14.
29 Ebd., S. 7.
30 Flach, Marcus Terentius Varro, Gespräche über die Landwirtschaft. Buch 1, S. 44.
31 In 1,17,3 gibt Varro zwar die Anweisung Bäume zu beschneiden, geht aber nicht auf den Vorgang oder auf besondere Anforderungen unterschiedlicher Baumarten ein. Hier verlässt er sich darauf, dass das durchführende Personal diese kennt. Im gleichen Abschnitt nennt Varro den Zeitraum für die Weinlese. Er geht aber weder auf den Zweck der Baumschnittarbeiten ein noch darauf, warum es zur Weinlese trocken sein soll.
32 Varro rust. 1,1,2.
33 Metzger Birgit: Erst stirbt der Wald, dann du!: Das Waldsterben als westdeutsches Politikum (1978-1986). Frankfurt 2015, S. 391.
34 Varro rust. 1,12,1.
35 Varro rust. 1,4,4.
36 Varro rust. 1,6,2.
37 Varro rust. 1,23,5.
38 Diepenbrock, Ellmer u.a., Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung: Grundwissen Bachelor, S. 12.
39 Varro rust. 1,17,2-3.
40 Varro rust. 2,1,18-20.
41 Dieter Flach: Römische Agrargeschichte. München 1990, S. 312.
42 Dieter Flach: Römische Agrargeschichte. München 1990, S. 304.
43 Varro rust. 3,14,2.
44 Varro rust. 3,16,34.
45 Fellmeth, Brot und Politik : Ernährung, Tafelluxus und Hunger im antiken Rom, S. 20.
46 Bommer, Die Ernährung der Griechen und Römer, S. 64f.
47 Fellmeth, Brot und Politik : Ernährung, Tafelluxus und Hunger im antiken Rom, S. 32.
Häufig gestellte Fragen zu "De re rustica" (Marcus Terentius Varro)
Was ist "De re rustica" und wer war Marcus Terentius Varro?
"De re rustica" ist eine Trilogie über die Landwirtschaft, die 37 v. Chr. von Marcus Terentius Varro geschrieben wurde. Varro (116-27 v. Chr.) war ein römischer Gelehrter, Schriftsteller und Landwirt.
Was sind die Hauptthemen von "De re rustica"?
Die Bücher behandeln verschiedene Aspekte der Landwirtschaft, darunter die Planung von Gutshöfen, den Ackerbau und die Tierhaltung. Varro gibt Ratschläge zu Pflanzenwahl, Bodennutzung, Tierzucht und vielem mehr.
An wen richtete sich Varro mit "De re rustica"?
Die Bücher richteten sich an Gutsbesitzer oder Gutsverwalter und enthielten Anweisungen welche Tätigkeiten wann erledigt werden sollten. Es fehlte jedoch die Anleitung, wie diese Tätigkeiten durchzuführen sind. Einen Nutzen ziehen daher nur diejenigen Personen aus den Büchern, die mit den planerischen Aspekten eines Gutes beauftragt sind.
Wie ist "De re rustica" aufgebaut?
Das Werk besteht aus drei Büchern: Das erste Buch behandelt Ackerbau und Gutsplanung, das zweite Buch befasst sich mit größeren Nutztieren (z.B. Rindern), und das dritte Buch handelt von Hoftieren wie Geflügel.
Welche Ratschläge gibt Varro zur Gutsplanung?
Varro empfiehlt, Gutshöfe an Ausläufern bewaldeter Berge zu errichten, um im Winter Sonne und im Sommer Schatten zu haben. Die Nähe zu Flüssen oder Sümpfen sollte vermieden werden. Auch die Ausrichtung von Türen und Fenstern ist zu beachten.
Welche Ratschläge gibt Varro zum Ackerbau?
Varro unterteilt das Land in Höhenlagen (Flachland, Hügelland, Bergland) und gibt Empfehlungen für die geeigneten Pflanzen je nach Lage, Besonnung und Bodenfeuchtigkeit. Er gibt auch jahreszeitabhängige Aufgaben vor (Bodenvorbereitung im Frühjahr, Mähen im Sommer, Weinlese im Herbst, Baumschnitt im Winter).
Welche Ratschläge gibt Varro zur Tierhaltung?
Varro gibt Ratschläge zu Begattungszeiten (z.B. für Schafe und Schweine), Haltungsbedingungen (z.B. für Schnecken) und zur Honigernte bei Bienen.
Inwiefern können Varros Ratschläge zur Katastrophenvorsorge beitragen?
Die Ratschläge zur Lage und Bauweise von Gutsgebäuden sind langfristige Vorsorgemaßnahmen gegen Hochwasser und Erdrutsche. Die Anbauratschläge helfen, die Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Die Tierhaltung kann finanzielle Reserven schaffen.
Wie bewertet die vorliegende Arbeit den Nutzen von "De re rustica" für die Katastrophenvorsorge?
Der Nutzen der Ratschläge variiert stark und hängt von der Art der Katastrophe ab. Einzelne Ratschläge müssen individuell bewertet werden.
Wie ist Varros Schreibstil?
Varros Schreibstil wird als gemischt rezipiert. Columella lobt den Fortschritt in der Darstellungsform, Quintilian und Augustinus kritisieren mangelnde Sorgfalt. Varro wechselt häufig zwischen Singular und Plural und verwendet sowohl Hochsprache als auch Umgangssprache.
- Quote paper
- Astrid Schühle (Author), 2020, Die landwirtschaftlichen Ratschläge Varros in der Katastrophenvorsorge, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1363940