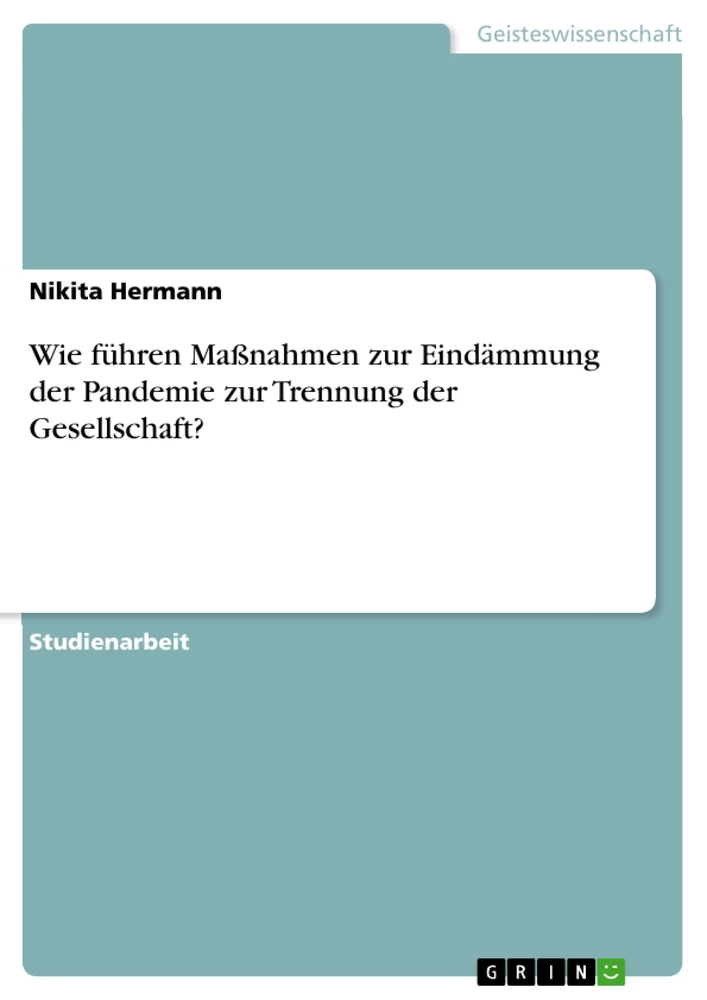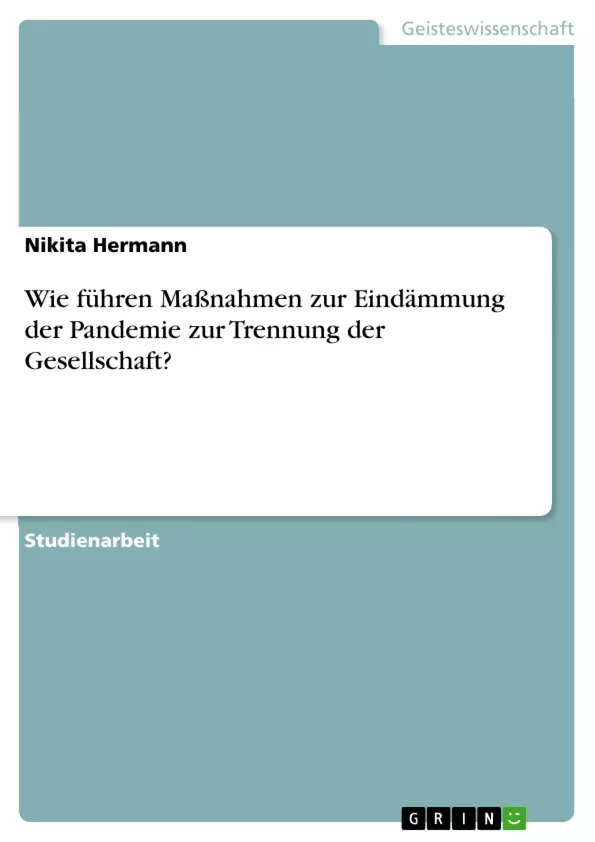Die gesellschaftliche Reproduktion, also das Bestehen der Gesellschaft in ihrer speziellen Form, verläuft nach Habermas in zwei verschiedenen Bereichen. Diese zwei Bereiche, oder auch Sphären, betrachtet er aus der Sicht des sozial handelnden Individuums, wobei das „System“ die Sphäre ist, in der zweckrational und erfolgsorientiert gehandelt wird, wohingegen die „Lebenswelt“ die Sphäre ist, in der verständigungsorientiert und kommunikativ gehandelt wird.
System und Lebenswelt sind zwei leittragende Begriffe in der Theorie des kommunikativen Handelns, mit ihnen versucht Habermas die zeitgenössische Sicht auf die Gesellschaft und ihren Wandel zu ordnen, und seine eigene Perspektive auf das Krisenpotential der Gegenwartsgesellschaft zu schildern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zu Jürgen Habermas
- 2. Die Theorie des kommunikativen Handelns
- 3. System und Lebenswelt
- 3.1 Die Kolonialisierung der Lebenswelt
- 3.2 Protestpotentiale
- 4. Gesellschaftliche Spaltungen durch die Corona-Pandemie
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas und analysiert das Verhältnis zwischen System und Lebenswelt. Dabei wird insbesondere die Kolonialisierung der Lebenswelt durch das System untersucht und die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Spaltung im Kontext der Corona-Pandemie beleuchtet.
- Die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas
- Das Verhältnis von System und Lebenswelt
- Die Kolonialisierung der Lebenswelt durch das System
- Protestpotentiale in der Gesellschaft
- Gesellschaftliche Spaltungen durch die Corona-Pandemie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 stellt Jürgen Habermas und sein Werk vor. Es werden seine wichtigsten Stationen im akademischen Kontext und seine Bedeutung für die Frankfurter Schule erläutert. Darüber hinaus wird seine kritische Gesellschaftstheorie und der Theoriestreit mit Niklas Luhmann behandelt.
- Kapitel 2 beleuchtet die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas. Es werden die Kernpunkte seiner soziologischen Handlungstheorie und Gesellschaftstheorie vorgestellt, sowie die Bedeutung des Konzepts für die Analyse von Konflikten zwischen System und Lebenswelt.
- Kapitel 3 widmet sich den Begriffen System und Lebenswelt. Es werden die jeweiligen Sphären des Handelns und ihre Charakteristika erläutert, sowie die Herausforderungen der Kolonialisierung der Lebenswelt durch das System beschrieben.
- Kapitel 4 untersucht die gesellschaftlichen Spaltungen, die durch die Corona-Pandemie hervorgerufen wurden. Dabei wird der Zusammenhang mit der Theorie des kommunikativen Handelns und der Kolonialisierung der Lebenswelt hergestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind: Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, System und Lebenswelt, Kolonialisierung der Lebenswelt, Protestpotentiale, gesellschaftliche Spaltungen, Corona-Pandemie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Habermas unter "System" und "Lebenswelt"?
Die Lebenswelt ist der Bereich kommunikativen Handelns und der Verständigung; das System (Markt/Bürokratie) ist der Bereich zweckrationalen Handelns.
Was bedeutet die "Kolonialisierung der Lebenswelt"?
Dass systemische Imperative (Geld, Macht) in Bereiche vordringen, die eigentlich auf Verständigung basieren, und diese dadurch zerstören.
Wie führte die Corona-Pandemie zu gesellschaftlichen Spaltungen?
Maßnahmen wurden oft systemisch-administrativ durchgesetzt, was die kommunikative Verständigung in der Lebenswelt einschränkte und Protestpotentiale weckte.
Wer ist Jürgen Habermas?
Ein bedeutender deutscher Soziologe und Philosoph der Frankfurter Schule, bekannt für seine Theorie des kommunikativen Handelns.
Was sind Protestpotentiale in diesem Kontext?
Reaktionen der Lebenswelt auf Übergriffe des Systems, die sich in sozialen Bewegungen oder Widerstand gegen staatliche Eingriffe äußern.
- Quote paper
- Nikita Hermann (Author), 2023, Wie führen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zur Trennung der Gesellschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1359930