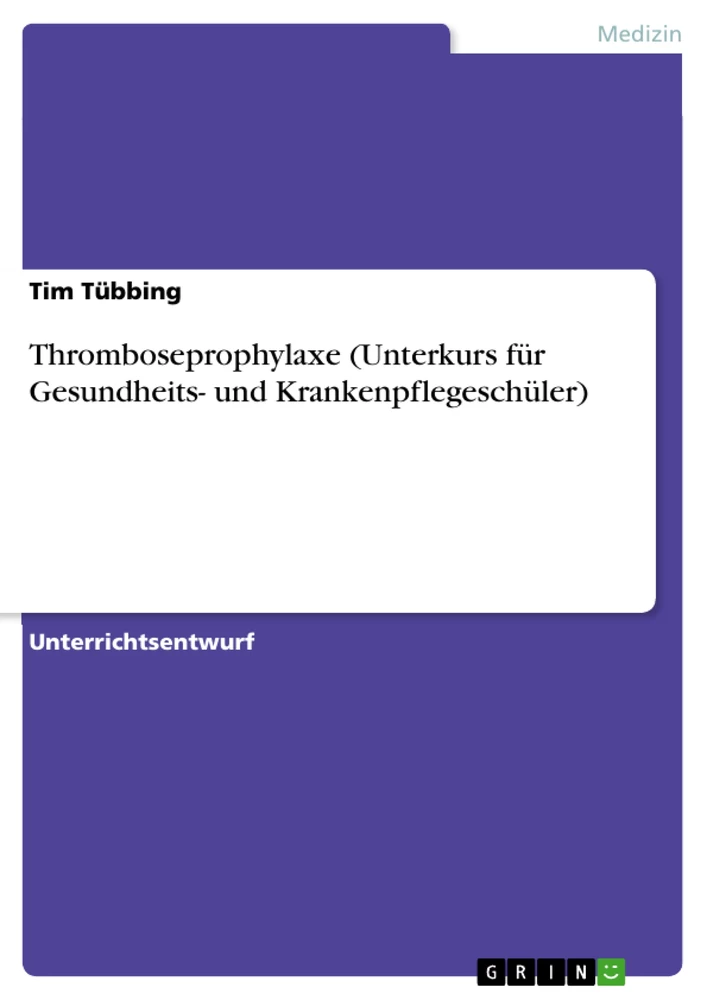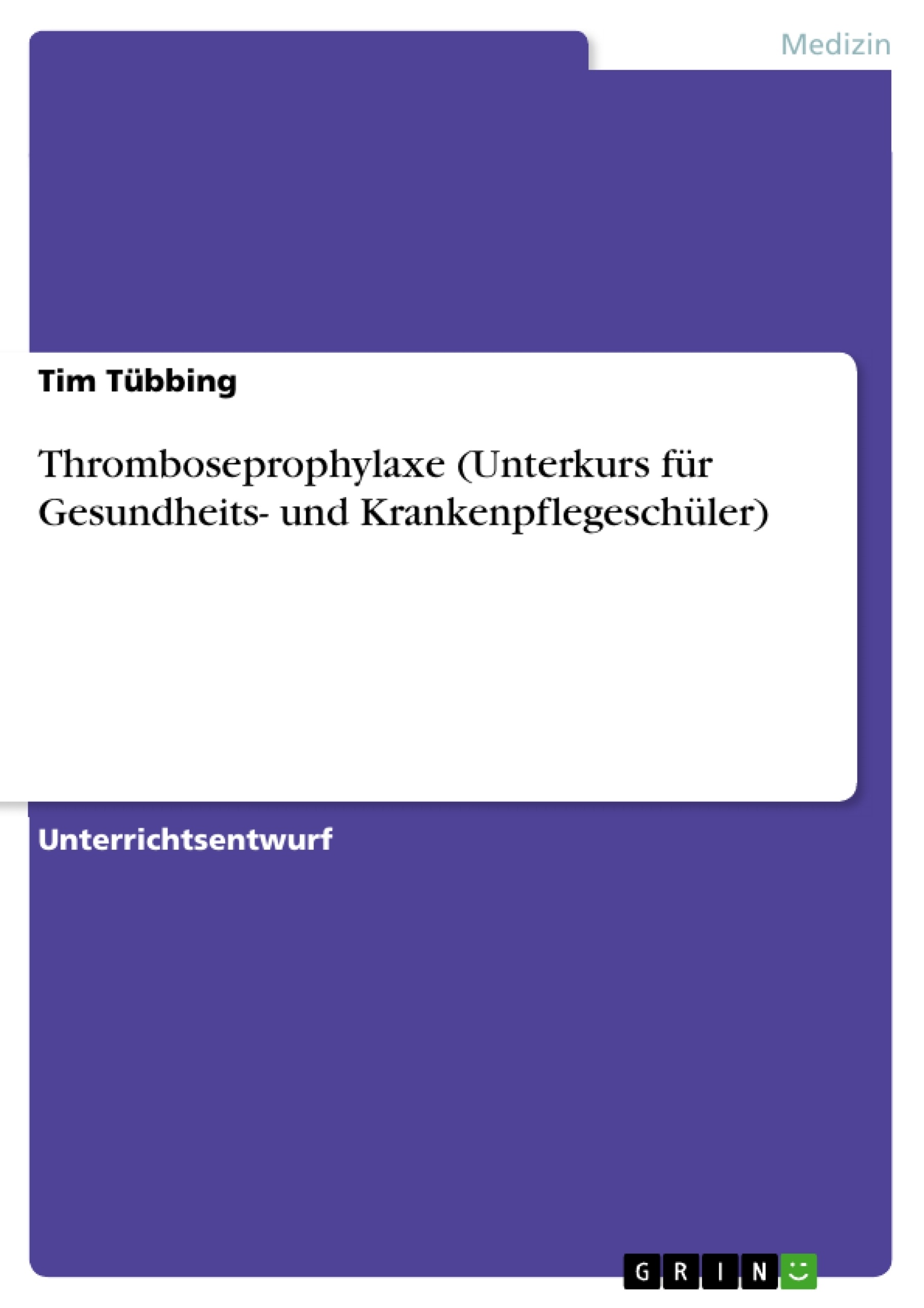Das Thema der Lehrprobe ist die Thromboseprophylaxe im Unterkurs der Gesundheits- und Krankenpflegeschüler. Ziele sind, dass die Schüler:innen in der Lage sind, Maßnahmen zur Thromboseprophylaxe entsprechend der Risikogefährdung der Patienten zuzuordnen, aktive Bewegungsübungen zur Thromboseprophylaxe anzuleiten und durchzuführen und Atemübungen zur Thromboseprophylaxe durchzuführen.
Außerdem sollen sie verstehen, dass die Flüssigkeitszufuhr eine wichtige Rolle bei der Thromboseprophylaxe einnimmt, die Wirkungsweise der medizinischen Thrombosestrümpfe kennen, diese im Pflegealltag adäquat zuteilen können und in der Lage sein, diese auszumessen. Die Auszubildenden sollen auch den Unterschied zwischen medizinischen Thrombosestrümpfen und medizinischen Kompressionsstrümpfen kennen, wissen, was ein Kompressionsverband ist und wie sie ihn anlegen, wissen was Antikoagulantien sind und kennen die wichtigsten Wirkungen und Nebenwirkungen dieser.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sachanalyse
- Definition Thrombose
- Physiologische Hämodynamik
- Virschow Trias
- Risikofaktoren
- Expositionelle Risikofaktoren
- Dispositionelle Risikofaktoren
- Maßnahmen zur Thromboseprophylaxe
- Bewegungsübungen
- Atemübungen
- Flüssigkeitszufuhr
- Medizinische Thrombosestrümpfe
- Medizinische Kompressionsstümpfe
- Antikoagulantien (Gerinnungshemmer)
- Weitere physikalische Maßnahmen
- Literaturverzeichnis
- Bedingungsanalyse
- Informationen zur Lerngruppe
- Curriculare Eingebundenheit
- Rahmenbedingungen
- Lehrvoraussetzungen
- Persönliche Voraussetzungen
- Thematische Voraussetzungen
- Lernziele in Form von Kompetenzangaben
- Didaktische Strukturierung des Unterrichts
- Selbstreflexion
- Fotodokumentation
- Anhang
- Fallausschnitte/Arbeitsblätter
- PowerPoint
- Reflexion der Begleitperson
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zur Thromboseprophylaxe zielt darauf ab, angehenden Gesundheits- und Krankenpflegeschülern das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die für die Prävention von Thrombosen im klinischen Alltag unerlässlich sind. Die Lehrprobe soll die Schüler mit den grundlegenden physiologischen und pathophysiologischen Prozessen der Thrombosebildung vertraut machen und ihnen die wichtigsten Risikofaktoren, sowie die geeigneten prophylaktischen Maßnahmen vorstellen.
- Definition und Pathophysiologie der Thrombose
- Virschow'sche Trias und die Entstehung von Thrombosen
- Identifizierung von Risikofaktoren für Thrombosen
- Bedeutung und Anwendung von prophylaktischen Maßnahmen
- Integration des Themas in die praktische Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Entwurf stellt das Thema der Thromboseprophylaxe im Kontext der Gesundheits- und Krankenpflegeschule vor und beschreibt die Zielgruppe, das Lehrerteam und den Rahmen des Unterrichts.
Sachanalyse
Dieser Abschnitt erläutert die Definition der Thrombose und beleuchtet die physiologische Hämodynamik, die für das Verständnis der Blutbewegung im Gefäßsystem relevant ist. Des Weiteren wird die Virschow'sche Trias als entscheidender Faktor für die Thromboseentstehung vorgestellt. Darüber hinaus werden Risikofaktoren für Thrombosen, sowohl expositionelle als auch dispositionelle, detailliert dargestellt.
Bedingungsanalyse
Dieser Abschnitt geht auf die Lerngruppe, die curriculare Einbindung des Themas und die Rahmenbedingungen des Unterrichts ein. Zudem werden die Voraussetzungen für den Lernerfolg, sowohl in Bezug auf die persönlichen Fähigkeiten der Schüler, als auch hinsichtlich des Vorwissens zum Thema, beschrieben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe des Unterrichtsentwurfs sind Thrombose, Thromboseprophylaxe, Hämodynamik, Virschow'sche Trias, Risikofaktoren, Gerinnungshemmer, Bewegungsübungen, Atemübungen, Flüssigkeitszufuhr, Medizinische Kompressionsstümpfe, Pflegeinterventionen und Prävention.
- Quote paper
- Tim Tübbing (Author), 2018, Thromboseprophylaxe (Unterkurs für Gesundheits- und Krankenpflegeschüler), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1358848