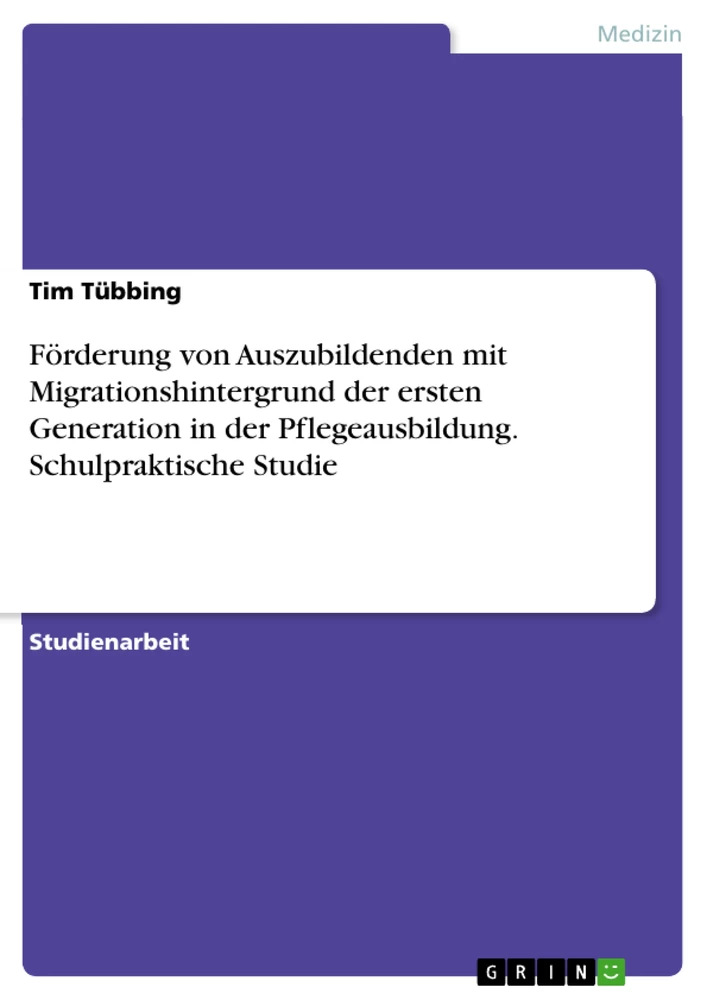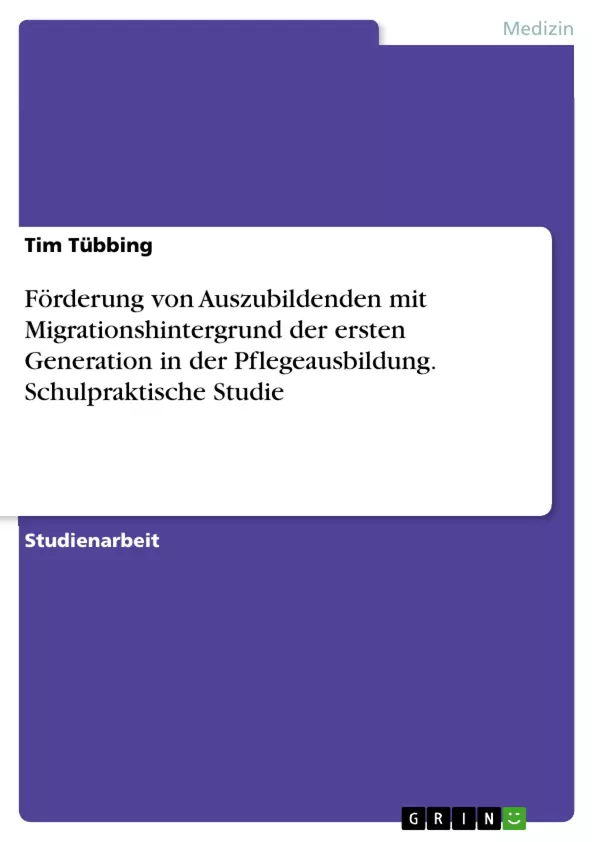In Deutschland gibt es einen Mangel an Pflegekräften, der unter anderem damit kompensiert werden soll, dass gezielt Menschen aus dem Ausland für eine Pflegeausbildung in Deutschland angeworben werden. Diese Menschen mit Migrationshintergrund in erster Generation stehen in der Pflegeausbildung vor großen Herausforderungen. Die Konzepte der Bundesregierung berücksichtigen einige dieser Herausforderungen, denen sich die Auszubildenden stellen müssen. Die schulpraktische Studie zeigt jedoch, dass die Herausforderungen und der damit verbundene Unterstützungsbedarf der Ausbildung weit über die bestehenden Konzepte hinausgeht.
Die Studie hat daher das Ziel, die Herausforderungen der Auszubildenden zu identifizieren und daraus entstehende Unterstützungsbedarfe zu identifizieren. Die Fragestellung der Forschung lautet daher: Welche Unterstützung wünschen sich die Auszubildenden mit Migrationshintergrund in der ersten Generation durch die Pflegeschule?
Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde ein qualitatives Studiendesign mit einem problemzentrierten Interview gewählt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Auszubildenden auf drei Ebenen Herausforderungen begegnen und somit auch auf drei Ebenen Unterstützungsbedarfe haben. Die erste Ebene ist der private Bereich, der Auszubildenden. Aufgrund der kulturellen und bürokratischen Unterschiede benötigen sie Unterstützung. Der praktische Bereich der Pflegeausbildung stellt die Auszubildenden vor weitere Herausforderungen, wie z.B. das fehlende Verständnis für die Aufgaben in der Pflegepraxis. Der größte Unterstützungsbedarf besteht jedoch im theoretischen Bereich der Pflegeausbildung, der zahlreiche Herausforderungen für die Auszubildenden mit sich bringt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
- 1.
- .1
- 2. STAND DER FORSCHUNG
- 3. VORGEHEN UND METHODIK.
- 4. DAS PROBLEMZENTRIERTE INTERVIEW
- 4.1.
- 4.2.
- .3
- .3
- 4.3.
- 4.4.
- 5. DIE AUSWERTUNG.
- 5.1.
- .5
- 5.2.
- 6. ERGEBNISSE
- 6.1.
- 6.2.
- 7. DISKUSSION
- 7.1.
- 7.2.
- 8. SCHLUSSFOLGERUNG....
- 9. LITERATURVERZEICHNIS
- 10. ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- 11. TABELLENVERZEICHNIS
- 12. ANHANG
- 12.1. MEILENSTEINE..
- 12.2. DETAILPLANUNG.
- 12.3. KURZFRAGEBOGEN
- 12.3.1. Kurzfragebogen Proband 1..
- Kurzfragebogen Proband 2....
- Kurzfragebogen Proband 3..
- Kurzfragebogen Proband 4.....
- 12.4. KODIERLEITFADEN
- 12.5. DER INTERVIEWLEITFADEN
- 12.6. AUSWERTUNGSHIRACHIEN DER KATEGORIEN
- 12.6.1. Kategorie: Vorwissen zur Ausbildung.
- 12.6.2. Kategorie: Herausforderung.
- 12.6.3. Kategorie: Integration
- 12.6.4. Kategorie: vorhandene Unterstützung.
- 12.6.5. Kategorie: Lernbegleitung.
- 12.6.6. Kategorie: Unterstützungsbedarf in der Schule.
- 12.6.7. Kategorie: Sprache.
- 12.6.8. Kategorie: Sonstiges.
- 12.6.9. Kategorie: Konzepte .
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie zielt darauf ab, die Herausforderungen von Auszubildenden mit Migrationshintergrund in der ersten Generation in der Pflegeausbildung zu identifizieren und daraus resultierende Unterstützungsbedarfe zu ermitteln.
- Integration in die deutsche Kultur und das Bildungssystem
- Sprachliche und kommunikative Herausforderungen
- Spezifische Bedürfnisse in der praktischen und theoretischen Ausbildung
- Unterstützungsbedarfe im schulischen und außerschulischen Bereich
- Entwicklung eines Konzepts zur Begleitung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Fachkräftemangels in der Pflege und die Relevanz der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Fokus. Der aktuelle Forschungsstand zu den Herausforderungen von Auszubildenden mit Migrationshintergrund wird in Kapitel 2 beleuchtet. Kapitel 3 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Studie, insbesondere das problemzentrierte Interview und die Auswertungsmethode. Die Ergebnisse der Interviews werden in Kapitel 6 präsentiert, wobei die Herausforderungen der Auszubildenden auf verschiedenen Ebenen analysiert werden. Die Diskussion in Kapitel 7 setzt die Ergebnisse in Bezug zur bestehenden Forschung und zu Programmen der Bundesregierung und entwickelt ein erweitertes Unterstützungsmodell.
Schlüsselwörter
Migrationshintergrund, Pflegeausbildung, Integration, Herausforderungen, Unterstützungsbedarfe, problemzentriertes Interview, qualitative Forschung, Triple-Win-Programm, Sprachbarrieren, Kulturverständnis, Lernbegleitung, Konzeptentwicklung
- Arbeit zitieren
- Tim Tübbing (Autor:in), 2022, Förderung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund der ersten Generation in der Pflegeausbildung. Schulpraktische Studie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1358844