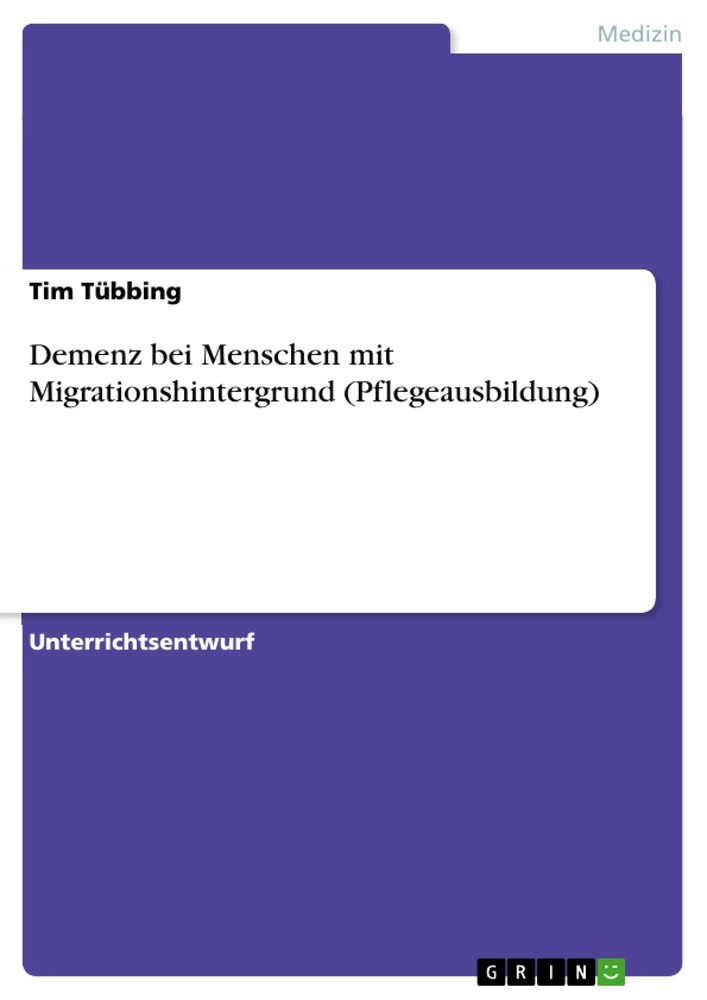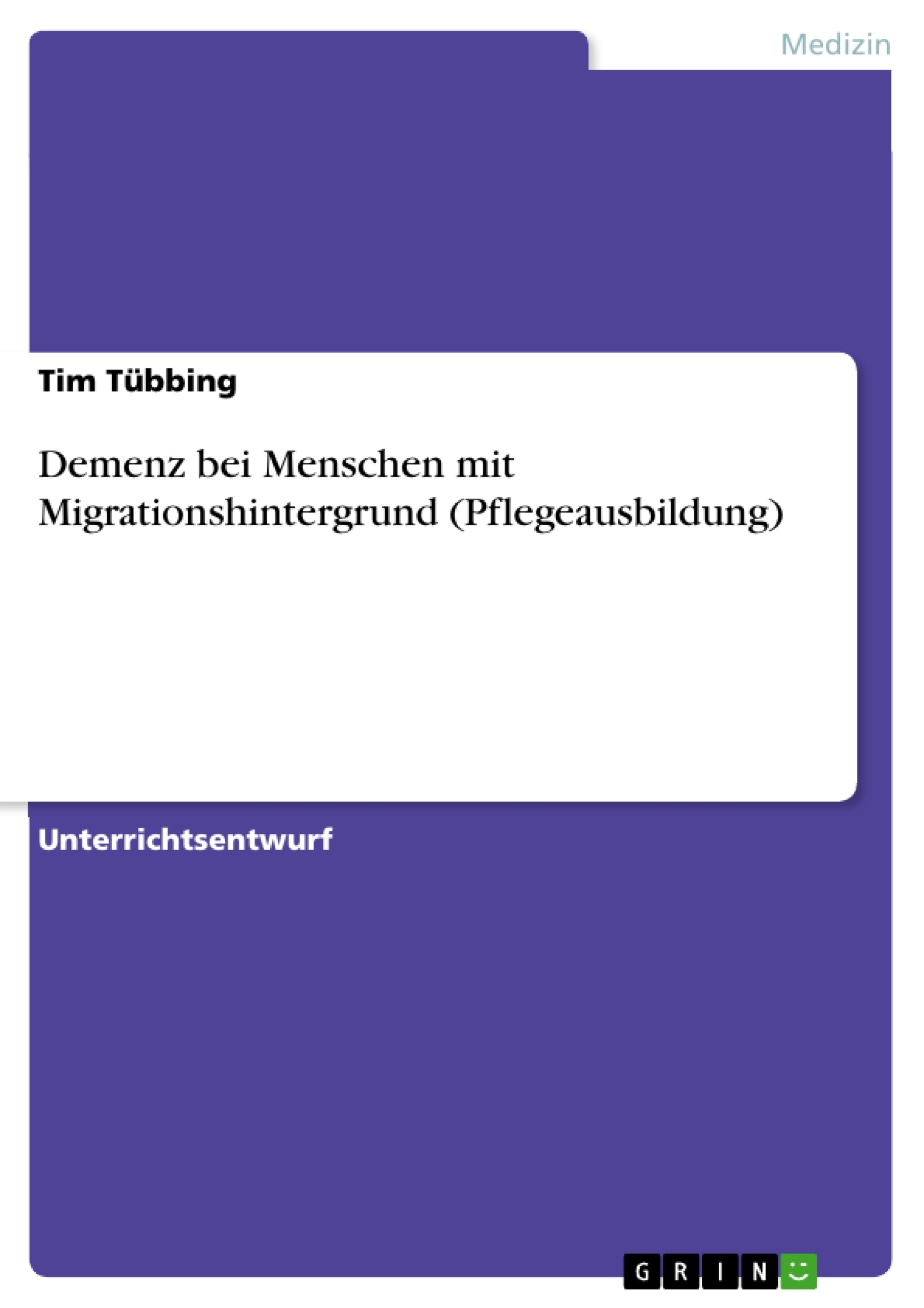Das Thema der Hausarbeit ist eine Unterrichtsplanung zum Thema Demenzerkrankungen in Kombination mit Migrationshintergrund. Für die Auszubildenden und Pflegekräfte ist es von großer Relevanz, mit Menschen umgehen zu können, die an Demenz erkrankt sind, daher beschäftigt sich ein Hauptteil der konstruierten Lerninsel mit Konzepten, die den Umgang mit Menschen mit Demenz ermöglichen. In der 90-minütigen Unterrichtssequenz geht es speziell um das Thema Validation nach Naomi Feil.
Die Hausarbeit beginnt mit der Vorstellung und Begründung der gewählten Fallsituation. Anschließend wird aus der Fallsituation „Yusuf spricht plötzlich kein Deutsch mehr“ eine heuristische Matrix nach Darmann-Fink (2010) erstellt, um mögliche Themen aus der Fallsituation abzuleiten. Daraufhin wird eine Lerninsel erstellt, die didaktisch reduziert und analysiert wird. Zu dem Thema Validation nach Naomi Feil wird eine Sachanalyse durchgeführt, die mit einer systematischen Literaturrecherche in drei Datenbanken beginnt. Die Literaturrecherche wird vorgestellt, bevor die Ergebnisse der Literaturrecherche nach aktuellem wissenschaftlichem Stand in der Arbeit beschrieben werden. Bei der anschließen Bedingungsanalyse werden die Voraussetzungen der Lernenden und Lehrenden zu dem Thema Validation und Umgang mit Demenz eingeschätzt und die institutionellen und curricularen Einbettungen beschrieben.
Zum Ende der Hausarbeit werden die zu erreichenden Kompetenzen der Lernenden festgelegt und darauf aufbauend wird der konkrete Unterrichtsverlauf geplant. Der Unterrichtsverlauf ist angelehnt an das didaktische Konzept von Meyer und beinhaltet ein Rollenspiel zur Sicherung des Lerninhalts.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Pflegedidaktische Begründung des Themas
- 2.1. Begründung des Falls:
- 2.2. Begründung nach Hundenborn (2010):
- 2.3. Pflegedidaktische Reflexion anhand der heuristischen Matrix nach Darmann- Finck (2010)
- 2.4. Konstruktion der Lerninsel
- 2.5. Begründete Auswahl eines Themas aus einer Lernsequenz der Lerninsel
- 2.6. Didaktische Analyse
- 2.7. Didaktische Reduktion
- 3. Sachanalyse
- 3.1. Die Recherche
- 3.2. Validation nach Naomi Feil
- 3.2.1. Grundannahmen
- 3.2.2. Anwendung individueller Validation
- 3.2.3. Validationstechniken
- 3.2.4. Evidenz
- 3.2.5. Bedingungsanalyse
- 4. Bedingungsanalyse
- 4.1. Der Lernende
- 4.2. Der Lehrende
- 4.3. Die Schule
- 4.4. Unterrichtszusammenhang
- 5. Beschreibung der Kompetenzen
- 6. Der Unterrichtsverlauf
- 7. Literaturverzeichnis
- 8. Anhangsverzeichnis
- 9. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Unterrichtsplanung zum Thema Demenzerkrankungen bei Menschen mit Migrationshintergrund. Ziel ist es, eine Unterrichtssequenz zu entwickeln, die Auszubildende und Pflegekräfte befähigt, effektiv mit Menschen mit Demenz umzugehen, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Kommunikationsschwierigkeiten im interkulturellen Kontext. Die 90-minütige Unterrichtssequenz fokussiert auf das Thema Validation nach Naomi Feil.
- Umgang mit Demenz erkrankten Menschen mit Migrationshintergrund
- Kommunikationsschwierigkeiten in interkulturellen Pflegekontexten
- Validation als Methode zur Unterstützung von Menschen mit Demenz
- Praktische Anwendung von Validationstechniken in der Pflegepraxis
- Didaktische Konzeption einer Lerninsel zum Thema Demenz und interkulturelle Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und gibt einen Überblick über die Relevanz von Demenzerkrankungen und Migration im deutschen Kontext. Kapitel 2 befasst sich mit der pflegedidaktischen Begründung des Themas, indem es die gewählte Fallsituation vorstellt und mit Hilfe der heuristischen Matrix nach Darmann-Fink (2010) mögliche Themen ableitet. Anschließend wird eine Lerninsel entworfen, die didaktisch reduziert und analysiert wird. Kapitel 3 beinhaltet die Sachanalyse zum Thema Validation nach Naomi Feil. Die Recherche wird vorgestellt und die Ergebnisse der Literaturrecherche nach aktuellem wissenschaftlichem Stand werden beschrieben. Die Bedingungsanalyse in Kapitel 4 setzt sich mit den Voraussetzungen der Lernenden und Lehrenden sowie den institutionellen und curricularen Einbettungen auseinander. Kapitel 5 beschreibt die zu erreichenden Kompetenzen der Lernenden, und im Anschluss daran wird in Kapitel 6 der konkrete Unterrichtsverlauf geplant.
Schlüsselwörter
Demenz, interkulturelle Pflege, Validation, Naomi Feil, Migrationshintergrund, Kommunikation, Lerninsel, Unterrichtsplanung, Pflegekräfte, Auszubildende, heuristische Matrix, Bedingungsanalyse, Kompetenzen, Unterrichtsverlauf.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Validation nach Naomi Feil?
Validation ist eine Kommunikationsmethode für den Umgang mit desorientierten, sehr alten Menschen (insb. bei Demenz), die darauf abzielt, deren Gefühle zu akzeptieren und zu validieren, statt sie zu korrigieren.
Warum ist der Migrationshintergrund bei Demenzpatienten relevant?
Menschen mit Demenz verlieren oft ihre Zweitsprache (Deutsch) und kehren zu ihrer Muttersprache zurück, was besondere Anforderungen an die interkulturelle Pflege stellt.
Was ist eine "Lerninsel" in der Pflegeausbildung?
Eine Lerninsel ist ein didaktisches Konzept, bei dem Auszubildende anhand einer konkreten Fallsituation praxisnahe Kompetenzen in einem geschützten Rahmen erwerben.
Wie geht man mit Patienten um, die plötzlich kein Deutsch mehr sprechen?
Hier helfen Validationstechniken, nonverbale Kommunikation und das Verständnis für die Biografie des Patienten, um trotz Sprachbarrieren eine vertrauensvolle Pflegebeziehung aufzubauen.
Welche Rolle spielt die Sachanalyse bei der Unterrichtsplanung?
Die Sachanalyse dient der systematischen Aufarbeitung des aktuellen wissenschaftlichen Stands zu einem Thema (z.B. Validation), um fundierte Lerninhalte zu vermitteln.
- Quote paper
- Tim Tübbing (Author), 2021, Demenz bei Menschen mit Migrationshintergrund (Pflegeausbildung), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1358840