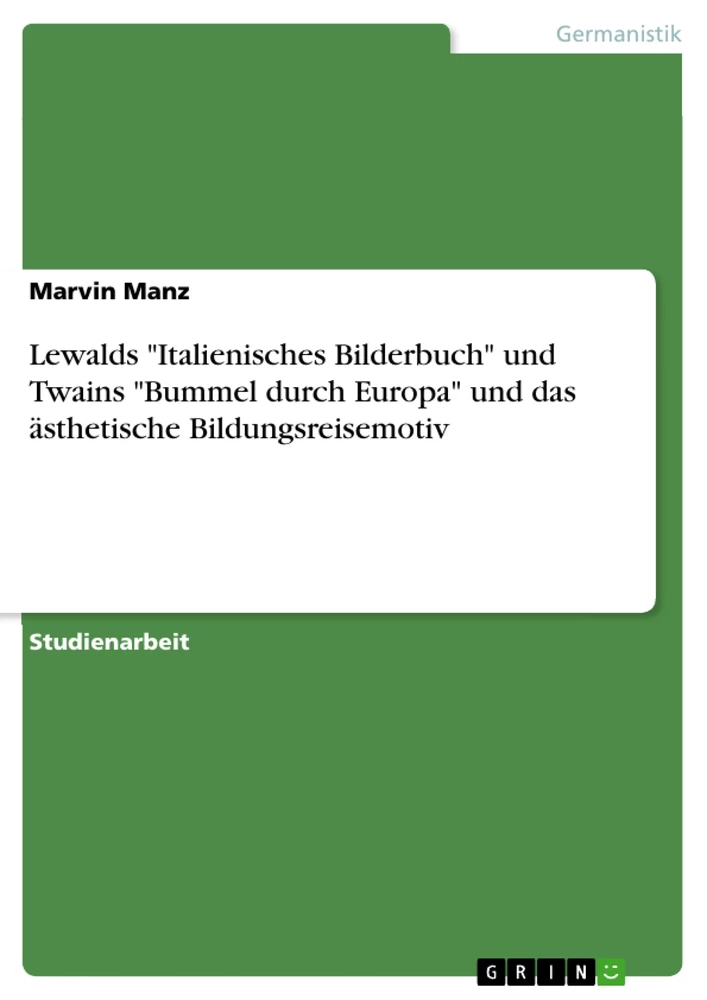Das Ziel der Seminararbeit besteht darin Reiseberichte von Fanny Lewald und Mark Twain miteinander zu vergleichen und die Gemeinsamkeiten sowie die Unterscheidungsmerkmale herauszuarbeiten und diese anhand des Stils der zu dieser Zeit vorherrschenden ästhetischen Bildungsreise zu vergleichen. Dabei wird die These untersucht, dass sich Mark Twains Reisebericht stark von Fanny Lewalds Aufzeichnungen unterscheidet. Die Formen von Reiseberichten sowie die generelle europäische Haltung bezüglich des Reisens wird von Twain parodiert. Währenddessen besteht die These, dass Fanny Lewalds Reisebericht sich mit dem Stil der ästhetischen Bildungsreise deckt.
Zu Beginn der Seminararbeit wird kurz die Entwicklung des Reisens beschrieben. Dabei wird auch auf die entsprechenden Reisemotive eingegangen und schließlich die ästhetisch motivierte Bildungsreise skizziert, über welche der Hauptteil der Seminararbeit eingeleitet wird. Im Hauptteil dieser Seminararbeit werden daraufhin die genannten Reiseberichte untersucht: Fanny Lewalds "Italienisches Bilderbuch" und Mark Twains "Bummel durch Europa". Sowohl Lewald als auch Twain besuchen auf ihrer Reise durch Italien die Stadt Mailand. Die Berichte der beiden Autoren über diese Stadt werden einzeln analysiert, wobei die zentralen Elemente der Berichte im Vordergrund stehen werden. Außerdem werden beide Berichte mit dem Stil der ästhetischen Bildungsreise verglichen. Folgend werden beide Reiseberichte miteinander verglichen, um zu untersuchen, wie viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede sie aufweisen. Abschließend wird im Schlussteil ein Fazit gezogen, in welchem die Ergebnisse der Kontrastanalyse zusammengefasst werden. Dabei wird auch die aufgestellte These bestätigt oder entkräftet.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- AUFBAU DER SEMINARARBEIT
- DIE ENTWICKLUNG DES REISENS
- FANNY LEWALD - ITALIENISCHES BILDERBUCH (1847)
- FANNY LEWALD - EINE FRAU AUF REISEN
- LEWALDS MAILAND-BERICHT
- MARK TWAIN – BUMMEL DURCH EUROPA (1880)
- MARK TWAIN UND DER HUMORISTISCHE REISEBERICHT
- MARK TWAINS MAILAND-BERICHT
- DIE MAILAND-BERICHTE IM VERGLEICH
- KONKLUSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht und vergleicht die Reiseberichte von Fanny Lewald und Mark Twain, insbesondere ihre Beschreibungen Mailands. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Werke im Kontext des ästhetischen Bildungsreisemotivs der damaligen Zeit herauszuarbeiten.
- Entwicklung des Reisens und des Reiseberichts
- Die Rolle der ästhetischen Bildungsreise in Lewalds und Twains Werken
- Analyse der Mailand-Beschreibungen in beiden Reiseberichten
- Vergleich des Schreibstils und der literarischen Strategien von Lewald und Twain
- Bewertung der Reiseberichte im Kontext des ästhetischen Bildungsreisemotivs
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Aufbau der Seminararbeit vor und beleuchtet kurz die Entwicklung des Reisens und die verschiedenen Reisemotive, die zur Entstehung der ästhetischen Bildungsreise führten.
- Kapitel 2 widmet sich Fanny Lewald und ihrem Werk "Italienisches Bilderbuch" (1847). Es beleuchtet die Bedeutung Lewalds als Frau auf Reisen und ihrer Rolle in der Emanzipationsbewegung. Außerdem wird ihr Bericht über Mailand näher betrachtet.
- Kapitel 3 analysiert Mark Twains "Bummel durch Europa" (1880) und seine humoristische Herangehensweise an das Reisemotiv. Auch hier steht die Analyse des Mailand-Berichts im Vordergrund.
- Kapitel 4 vergleicht die beiden Mailand-Berichte von Lewald und Twain, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf Schreibstil, Inhalt und literarische Mittel aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Reisebericht, Ästhetische Bildungsreise, Italien, Mailand, Fanny Lewald, Mark Twain, Vergleichende Analyse, Literaturwissenschaft, Reisemotive, Humor, Kritik, Gesellschaftliche Verhältnisse.
- Arbeit zitieren
- Marvin Manz (Autor:in), 2022, Lewalds "Italienisches Bilderbuch" und Twains "Bummel durch Europa" und das ästhetische Bildungsreisemotiv, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1357710