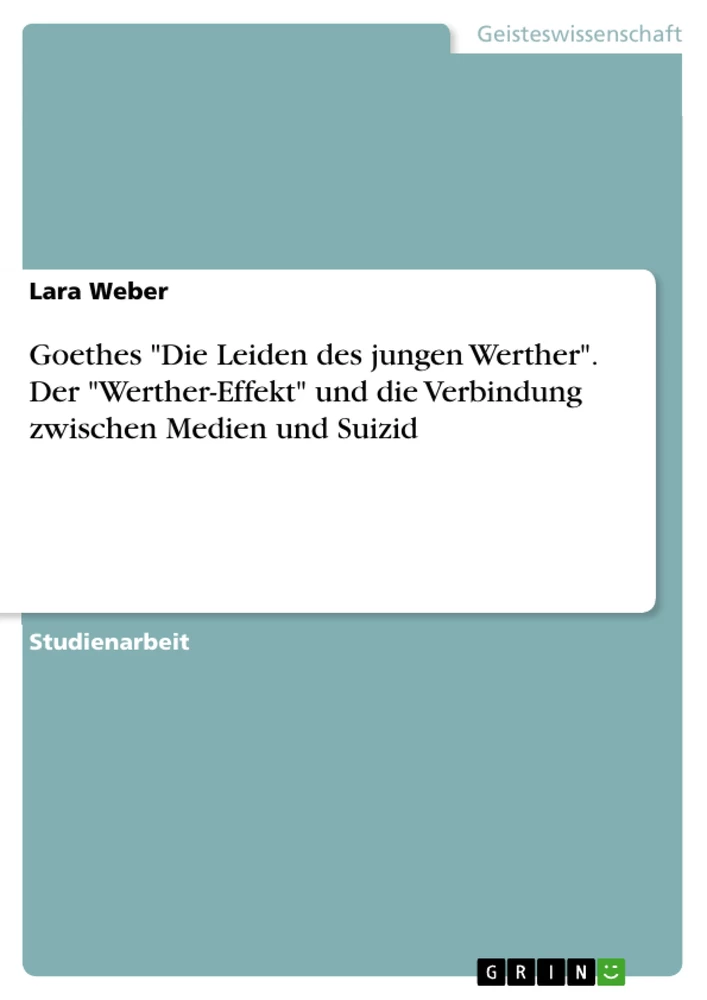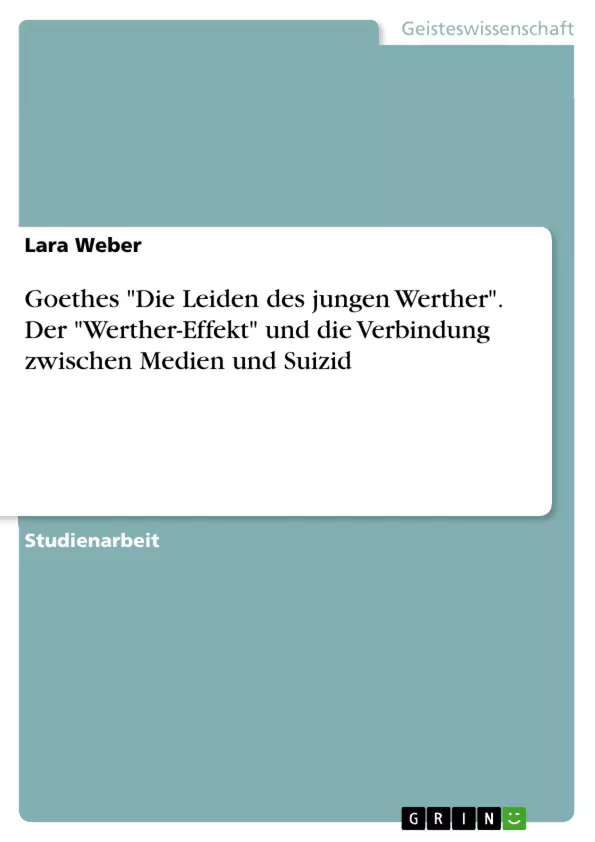Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema des "Werther-Effekts", genauer mit der Beziehung zwischen dem Konsum bestimmter Medien und der Suizidalrate.
Zu Beginn der Arbeit geht die Autorin auf die Definition des „Werther-Effekts“ und auf Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“ ein. Der Briefroman ist der Grundbaustein des heutzutage als „Werther-Effekt“ bekannten Phänomens. Mit diesem Werk löste Goethe wahrscheinlich den ersten Medienskandal der Moderne aus. Um den „Werther-Effekt“ als solchen verstehen und untersuchen zu können, ist es wichtig, kurz auf den Roman und seine Inhalte einzugehen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich dann mit einem praktischen Beispiel, an dem der Effekt, welcher den „Werther-Effekt“ hervorruft, deutlich gemacht wird. Dafür hat die Autorin das Thema Medien und Suizid gewählt, da dies das Hauptgebiet ist, indem der „Werther-Effekt“ auftritt. Sie möchte zeigen, welchen Einfluss falsche Berichterstattung über Suizid auf die Suizidenten hat und was es dabei zu achten gilt. Im letzten Abschnitt der Hausarbeit wird dann ein Gegenbeispiel, der sogenannte „Papageno-Effekt“, aufgezeigt. Dieser stellt das genaue Gegenteil des „Werther-Effekts“ dar und zeigt, was eine sensible und neutrale Berichterstattung über Suizid bei den Rezipienten bewirken kann und dass es wichtig ist, vorsichtig mit diesem Thema umzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Der ,,Werther-Effekt“ & „Die Leiden des jungen Werther“
- Praxisbeispiel - Medien & Suizid
- Gegenbeispiel – Der „Papageno-Effekt“
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem „Werther-Effekt“, einem Phänomen, das durch Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“ bekannt wurde. Die Arbeit untersucht die Definition des Effekts, seine praktische Anwendung im Kontext von Medienberichterstattung über Suizid und präsentiert das Gegenbeispiel des „Papageno-Effekts“.
- Definition des „Werther-Effekts“
- Analyse der Rolle von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“
- Praktische Anwendung des „Werther-Effekts“ in der Medienberichterstattung
- Untersuchung der Auswirkungen von Suizidberichterstattung
- Einführung des „Papageno-Effekts“ als Gegenbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz des „Werther-Effekts“ für die heutige Medienlandschaft. Der erste Abschnitt des Hauptteils widmet sich der Definition des „Werther-Effekts“ und der Analyse von Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“ als Ursprung des Phänomens. Der zweite Abschnitt beleuchtet die Anwendung des „Werther-Effekts“ in der Praxis und untersucht die Auswirkungen von Suizidberichterstattung in den Medien. Der dritte Abschnitt des Hauptteils stellt den „Papageno-Effekt“ als Gegenbeispiel vor und zeigt auf, wie eine sensible und neutrale Berichterstattung über Suizid positive Effekte erzielen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf folgende Schlüsselwörter: „Werther-Effekt“, „Suizid“, „Medienberichterstattung“, „Goethes ‚Die Leiden des jungen Werther‘“, „Papageno-Effekt“, „Nachahmungseffekte“, „Suizidprävention“, „sensible Berichterstattung“.
- Arbeit zitieren
- Lara Weber (Autor:in), 2022, Goethes "Die Leiden des jungen Werther". Der "Werther-Effekt" und die Verbindung zwischen Medien und Suizid, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1356910